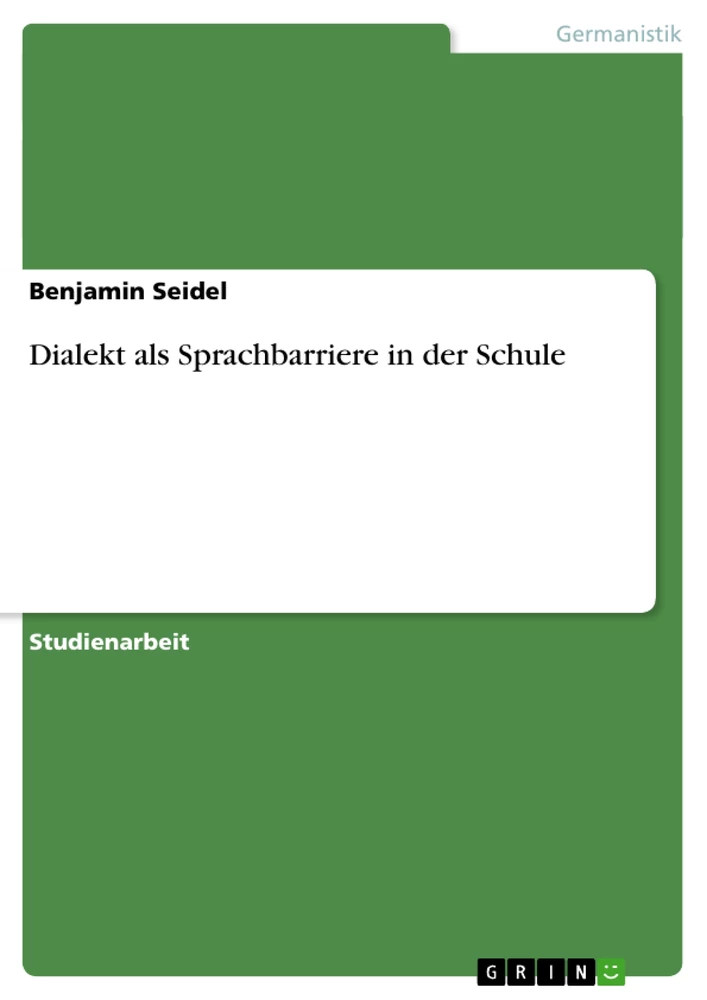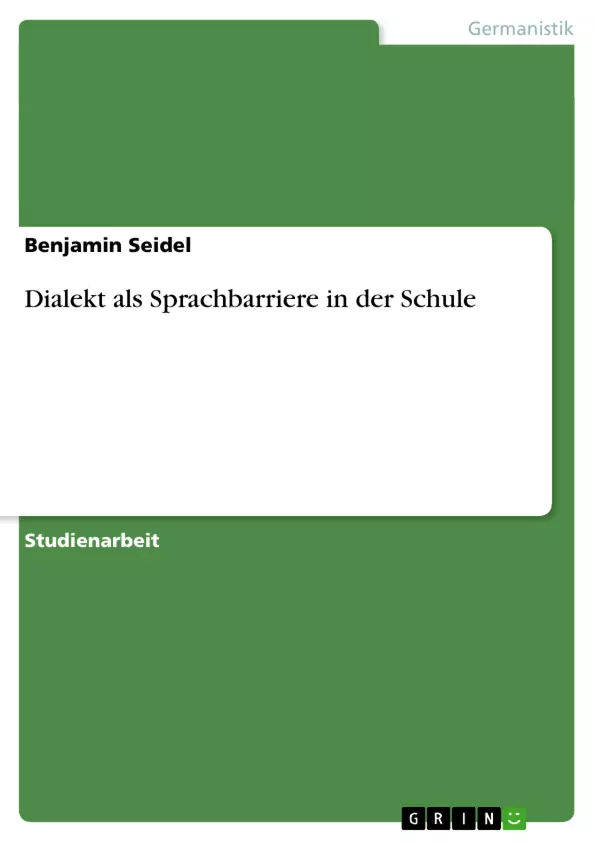Ist das Thema „Dialekt als Sprachbarriere passé?“, fragt Ulrich Ammon im Titel eines seiner Aufsätze. Tatsächlich wird das Thema ‚Dialekt und Schule’ jedenfalls längst nicht mehr so ausführlich diskutiert, wie vor 20 bis 30 Jahren. Dies bweisen Einblicke in entsprechende Einführungen oder Gesamtdarstellungen. Die bkannten „Sprachhefte für den Deutschunterricht: Dialekt / Hochsprache kontrastiv“ weden längst nicht mehr aufgelegt, geschweige denn wird mit ihnen praktisch in den Schulen gearbeit.
Wenn heute über Dialekt nachgedacht wird, dann stehensozialidentifikatorische Funtionen im Vordergrund, während Barrierewirkungen nicht zur Sprache komme. Es scheint, als werde sich um die Dialekte selber Sorgen gemacht, sind sie doch aus mannigfaltigen Gründen, vor allem durch soziale Mobilität und den Einfluss der Mas-senmedien, im Verschwinden begriffen, nicht jedoch um die Dialektsprecher selber und die „Barrierewirkung, die der Dialekt haben könnte.
Die Gründe dafür sind zahlreich: Die gesellschaftspolitische Fragestellung, die zwangs-läufig eng mit der Frage nach dem Dialekt als Sprachbarriere verbunden ist, ist in den Hintergrund getreten. Der zunehmende Anteil der Migrantenkinder in den Schulen hat eine neue Dimension der Sprachdebatte gebracht, der vielleicht dringlicher und auffällger ist, als die Dialektdebatte. Und schließlich hat sich die Einstellung der Wissenschaft zu Dialekten und Varietäten in den letzten Jahren dahin gehend geändert, dass sie grundsätzlich als der Standardsprache gleichwertig angesehen werden. Hinzu kommt, dass, wie schon gesagt, die Dialekte sowieso seltener gesprochen wer-den.
Heißt das, dass die Diskussion überflüssig geworden ist? Die Forschungen, vor allem aus den siebziger Jahren, die später noch näher vorgestellt werden sollen, haben gezeigt, dass Dialektsprecher größere schulische Probleme haben, als Schüler , die auch die Standardsprache beherrschen. Hat sich an dieser Feststellung seitdem etwas geändert? Jüngere Untersuchungen scheinen dies nicht zu bestätigen.Es scheint so, als habe sich an dem eigentlichen Problem nicht viel geändert, auch wenn die Diskussion trotzdem abgeflacht ist.
Die Arbeit untersucht Theorien hinter der Dialekt-Diskussion, stellt Untersuchungen zum Forschungsbereich Dialekt und Schule vor und zieht sprachdidaktische Schlussfolgerungen.
Inhaltsverzeichnis
- DIE DISKUSSION IN DEN LETZTEN 30 JAHREN
- THEORIEN HINTER DER DIALEKT-DISKUSSION
- SPRACHBARRIERE UND DEFIZITHYPOTHESE
- DIFFERENZHYPOTHESE UND MARKIERTHEITSMODELL
- UNTERSUCHUNGEN ZUM FORSCHUNGSGEBIET,DIALEKT UND SCHULE'
- EMPIRISCHE FORSCHUNGEN
- ERGEBNISSE
- Orthografie
- Grammatik
- Auswirkungen auf die Text- und Diskursebene
- Dialekt und Sozialschichtzugehörigkeit
- Hörereinstellungen
- Variationskompetenz
- METHODISCHE PROBLEME
- SPRACHDIDAKTISCHE SCHLUSSFOLGERUNGEN
- LITERATURVERZEICHNIS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Diskussion über Dialekt und Schule in den letzten 30 Jahren und analysiert die Entwicklung des Themas. Sie beleuchtet verschiedene Theorien, empirische Forschungsdaten und methodische Probleme, die mit dem Einfluss von Dialekten auf den schulischen Erfolg zusammenhängen.
- Der Wandel der Dialekt-Diskussion im Laufe der Zeit
- Theorien zur Sprachbarriere und Defizithypothese
- Empirische Forschungsergebnisse zum Einfluss von Dialekten auf die schulische Leistung
- Methodische Probleme bei der Erforschung von Dialekt und Schule
- Sprachdidaktische Schlussfolgerungen für den Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beleuchtet die Entwicklung der Dialekt-Diskussion in den letzten 30 Jahren. Es wird der Wandel von der Fokussierung auf den Dialekt als Sprachbarriere hin zu einer stärkeren Berücksichtigung der sozialidentifikatorischen Funktionen von Dialekten dargestellt.
- Kapitel zwei untersucht die Theorien hinter der Dialekt-Diskussion, insbesondere die Sprachbarrieren-Theorie von Basil Bernstein und die Defizithypothese. Es werden verschiedene Interpretationen der Sprachbarriere, wie die kommunikative, sprachstrukturelle und kognitive Barriere, erläutert.
- Das dritte Kapitel widmet sich empirischen Forschungsarbeiten zum Einfluss von Dialekten auf die schulische Leistung. Es werden Ergebnisse zu verschiedenen Aspekten wie Orthografie, Grammatik, Auswirkungen auf die Text- und Diskursebene, Dialekt und Sozialschichtzugehörigkeit, Hörereinstellungen und Variationskompetenz zusammengefasst.
- Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit methodischen Problemen bei der Erforschung von Dialekt und Schule. Es werden kritische Punkte bei der Durchführung von empirischen Studien beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Dialekt, Schule, Sprachbarriere, Defizithypothese, empirische Forschung, Sprachdidaktik, Variationskompetenz, soziale Mobilität, Standardsprache, Sprachvariation, und Sprachwandel.
Häufig gestellte Fragen
Gilt Dialekt heute noch als Sprachbarriere in der Schule?
Obwohl die öffentliche Diskussion abgeflacht ist, zeigen Untersuchungen, dass Dialektsprecher weiterhin größere schulische Probleme haben können als Schüler mit Standardsprachkompetenz.
Was besagt die Defizithypothese von Basil Bernstein?
Sie geht davon aus, dass bestimmte Sprachvarietäten (wie Dialekte) strukturelle und kognitive Defizite aufweisen, die den Bildungserfolg behindern.
Wie beeinflusst Dialekt die Leistungen in Orthografie und Grammatik?
Empirische Forschungen zeigen, dass dialektale Einflüsse zu spezifischen Fehlern in der Rechtschreibung und im Satzbau der Standardsprache führen können.
Was ist die Differenzhypothese?
Im Gegensatz zur Defizithypothese sieht sie Dialekte als der Standardsprache gleichwertige Systeme an, die lediglich anders strukturiert sind.
Warum wird das Thema "Dialekt und Schule" seltener diskutiert?
Gründe sind der Fokus auf Migrantensprachen, die abnehmende Zahl der Dialektsprecher und eine geänderte Einstellung der Wissenschaft zur Gleichwertigkeit von Varietäten.
- Citar trabajo
- Benjamin Seidel (Autor), 2003, Dialekt als Sprachbarriere in der Schule, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/17777