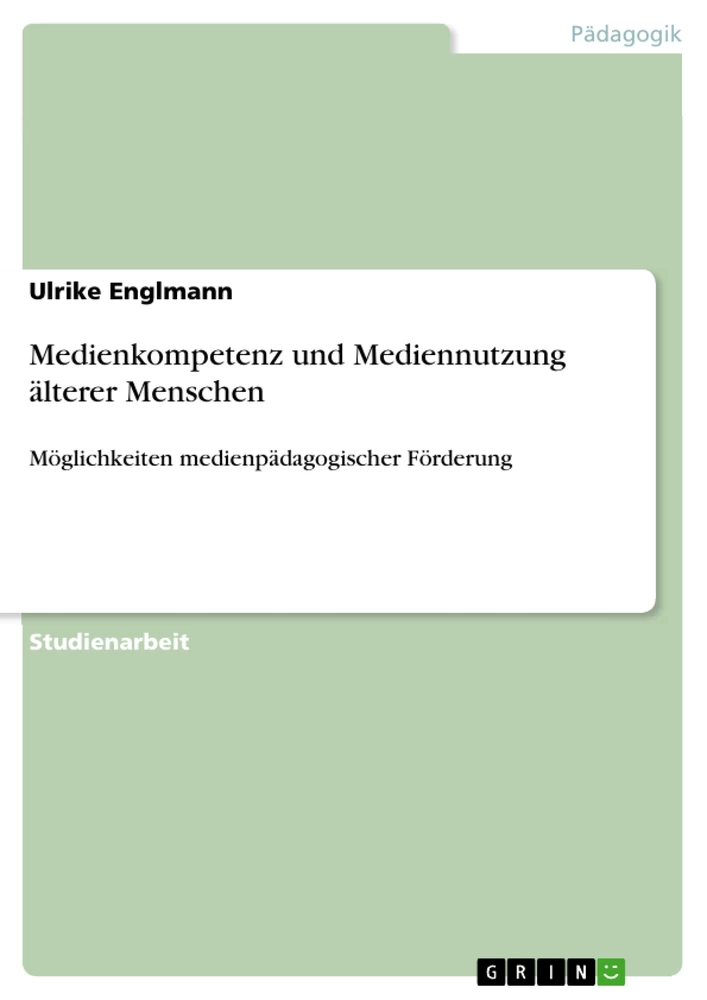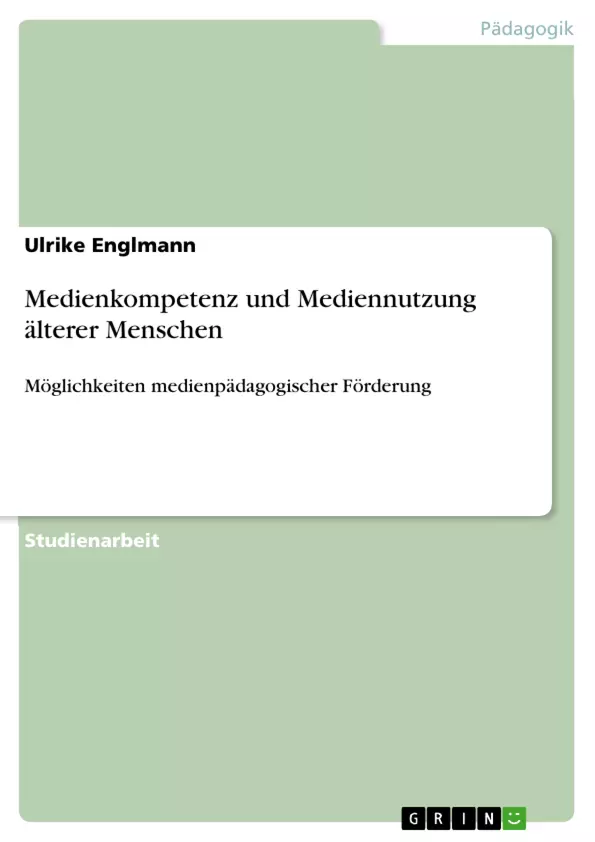Die heutige Wissens- und Informationsgesellschaft ist in hohem Maße medienvermittelt. Medien beeinflussen nicht nur unser Denken, unsere Einstellungen und Werte, sondern auch unseren Alltag und Lebensstil in vielfältiger Weise. Wir nutzen selbstverständlich Tageszeitungen, Bücher, Radio und Fernsehen, Video, Mobiltelefone oder das Internet. Das Fernsehen stellt in diesem Zusammenhang ein fast schon traditionelles Medium dar, wohingegen Mobiltelefone und das Internet als „neue“ Medien bezeichnet werden (Bachmair 2010, S. 5). Der technische Fortschritt vollzieht sich mit rasanter Geschwindigkeit, die Auswirkungen auf die einzelnen Bevölkerungsgruppen sind unterschiedlich. Während Kinder und Jugendliche heute mit den neuen Medien aufwachsen und - letztlich auch aufgrund der Gefahren, die die Nutzung der neuen Medien mit sich bringen kann - im Fokus medienpädagogischer Förderung stehen, geraten ältere Menschen zunehmend in Gefahr von der gesellschaftlichen Entwicklung ausgeschlossen zu werden. Im Fokus der Anbieter stehen sie meist nur dort wo sie als zahlungskräftige Klientel gesehen werden. Aufgrund eigener Vorbehalte, Ängste, Lernwiderstände oder anders gelagerter Bedürfnisse findet ein teilweiser Rückzug aus dem gesellschaftlichen Leben statt. Laut Branchenverband Bitkom steht die Nutzung neuer Medien durch ältere Menschen trotz der demografischen Entwicklung in Deutschland noch immer in einem Missverhältnis zur Bevölkerungsstruktur. 20 % der Deutschen sind heute 65 Jahre oder älter, aber nur 11 % der Internet-Nutzer sind Senioren. Der „digitale Graben“ zwischen den Generationen besteht fort (Bitkom 2010a, S. 1).
Ausgehend von der Beschreibung der Lebenssituation und dem Mediennutzungsverhalten älterer Menschen, will diese Arbeit – unter Bezugnahme auf Lernvoraussetzungen, die lerntheoretischen Bezüge und das Konzept des Lebenslangen Lernens - Ansätze zur Förderung der Medienkompetenz älterer Menschen aufzeigen. Abschließend werden exemplarisch bereits bestehende Angebote zur Förderung der Medienkompetenz beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche Grundlagen
- Ältere Menschen
- Medienkompetenz
- Die Lebenssituation älterer Menschen
- Soziale Lage
- Mediennutzung
- Zugangbarrieren und Hemmschwellen
- Medienkompetenzentwicklung
- Lernvoraussetzungen älterer Menschen
- Lerntheoretische Bezüge
- Konzept des Lebenslangen Lernens
- Möglichkeiten medienpädagogischer Förderung
- Ansätze zur Bildungsarbeit mit älteren Menschen
- Angebote zur Förderung der Medienkompetenz
- Fazit und Ausblick
- Literaturverzeichnis
- Verweis auf Internetseiten
- Abbildungs- und Tabellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Medienkompetenz und Mediennutzung älterer Menschen in der heutigen Wissens- und Informationsgesellschaft. Sie untersucht die Lebenssituation älterer Menschen im Kontext der Mediennutzung und analysiert die Herausforderungen bei der Entwicklung von Medienkompetenz in dieser Altersgruppe. Die Arbeit beleuchtet die Lernvoraussetzungen älterer Menschen, die lerntheoretischen Bezüge und das Konzept des Lebenslangen Lernens. Im Fokus stehen Möglichkeiten der medienpädagogischen Förderung, um die Medienkompetenz älterer Menschen zu verbessern und sie in die digitale Gesellschaft zu integrieren.
- Die Lebenssituation und Mediennutzung älterer Menschen
- Zugangbarrieren und Hemmschwellen für die Mediennutzung
- Lernvoraussetzungen und Lerntheoretische Bezüge im Kontext der Medienkompetenzentwicklung
- Das Konzept des Lebenslangen Lernens und seine Bedeutung für die Medienkompetenz älterer Menschen
- Möglichkeiten medienpädagogischer Förderung und bestehende Angebote
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Kontext der Arbeit vor und beleuchtet die Bedeutung von Medienkompetenz in der heutigen Gesellschaft. Sie zeigt auf, dass ältere Menschen zunehmend von der gesellschaftlichen Entwicklung ausgeschlossen werden, wenn sie nicht an den neuen Medien teilhaben. Die Arbeit konzentriert sich auf die Gruppe der älteren Menschen ab dem Eintritt ins Rentenalter.
Das Kapitel "Begriffliche Grundlagen" definiert die Begriffe "Ältere Menschen" und "Medienkompetenz". Es wird die demografische Entwicklung in Deutschland betrachtet und die Bedeutung von Medienkompetenz als lebenslange Lernfähigkeit betont.
Das Kapitel "Die Lebenssituation älterer Menschen" analysiert die soziale Lage, die Mediennutzung und die Zugangbarrieren und Hemmschwellen für ältere Menschen. Es zeigt, dass die Gruppe der Älteren nicht homogen ist und dass es erhebliche Unterschiede im Bildungsniveau, der Einkommenssituation und der Mediennutzung gibt.
Das Kapitel "Medienkompetenzentwicklung" beleuchtet die Lernvoraussetzungen älterer Menschen, die lerntheoretischen Bezüge und das Konzept des Lebenslangen Lernens. Es wird die Bedeutung von Selbststeuerung, Kompetenzentwicklung und informellen Lernen für die Medienkompetenzentwicklung älterer Menschen hervorgehoben.
Das Kapitel "Möglichkeiten medienpädagogischer Förderung" stellt Ansätze zur Bildungsarbeit mit älteren Menschen vor und beschreibt bestehende Angebote zur Förderung der Medienkompetenz. Es zeigt, dass es vielfältige Initiativen und Programme gibt, die den Zugang zu den neuen Medien für ältere Menschen erleichtern und ihre Medienkompetenz verbessern wollen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Medienkompetenz, Mediennutzung, ältere Menschen, Lebenslanges Lernen, Medienpädagogik, Bildungsarbeit, Zugangbarrieren, Hemmschwellen, Lernvoraussetzungen, Lerntheoretische Bezüge, Angebote zur Förderung der Medienkompetenz. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen und Möglichkeiten der Medienkompetenzentwicklung älterer Menschen in der heutigen Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter dem "digitalen Graben" zwischen den Generationen?
Damit ist die Kluft in der Mediennutzung gemeint: Während fast alle Jugendlichen online sind, nutzt nur ein kleiner Teil der Senioren (Stand 2010 ca. 11 %) das Internet.
Welche Barrieren hindern ältere Menschen an der Nutzung neuer Medien?
Zu den Hemmschwellen zählen persönliche Vorbehalte, Ängste vor der Technik, Lernwiderstände sowie fehlende altersgerechte Angebote der Anbieter.
Warum ist Medienkompetenz im Alter wichtig?
In einer medienvermittelten Gesellschaft schützt Medienkompetenz vor sozialer Ausgrenzung und ermöglicht die Teilhabe am modernen Alltag und Lebensstil.
Welche Rolle spielt das "Lebenslange Lernen"?
Es bildet die Grundlage dafür, dass Kompetenzentwicklung nicht mit dem Renteneintritt endet, sondern durch informelles Lernen stetig gefördert werden muss.
Wie kann die Medienpädagogik Senioren unterstützen?
Durch gezielte Bildungsarbeit und niedrigschwellige Angebote können Berührungsängste abgebaut und die notwendigen Fertigkeiten für die digitale Welt vermittelt werden.
- Quote paper
- Ulrike Englmann (Author), 2011, Medienkompetenz und Mediennutzung älterer Menschen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/177962