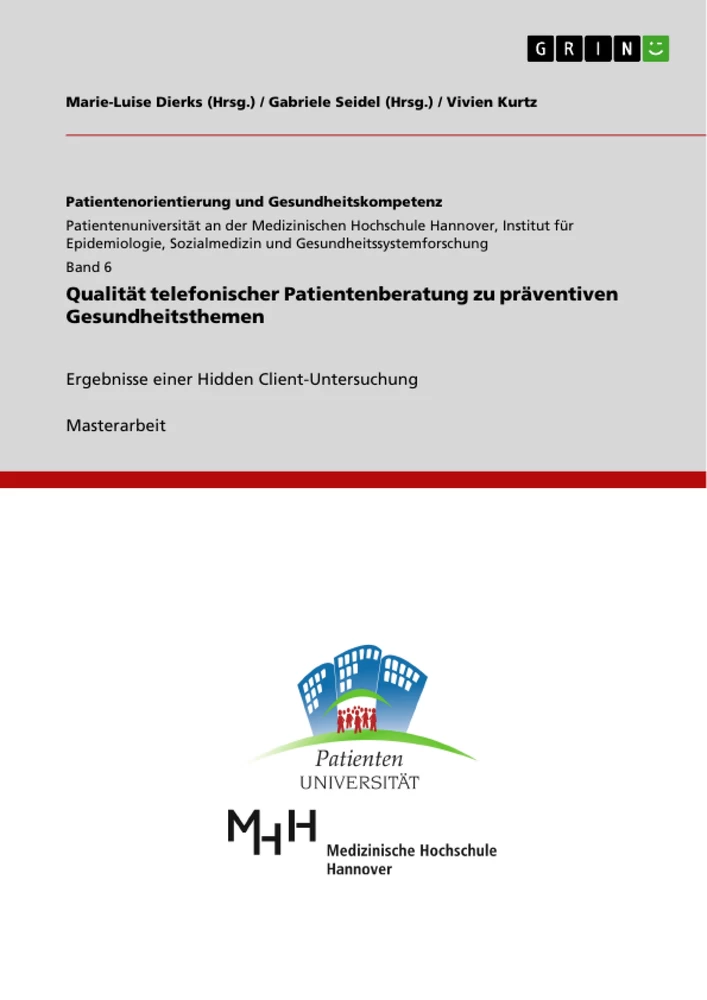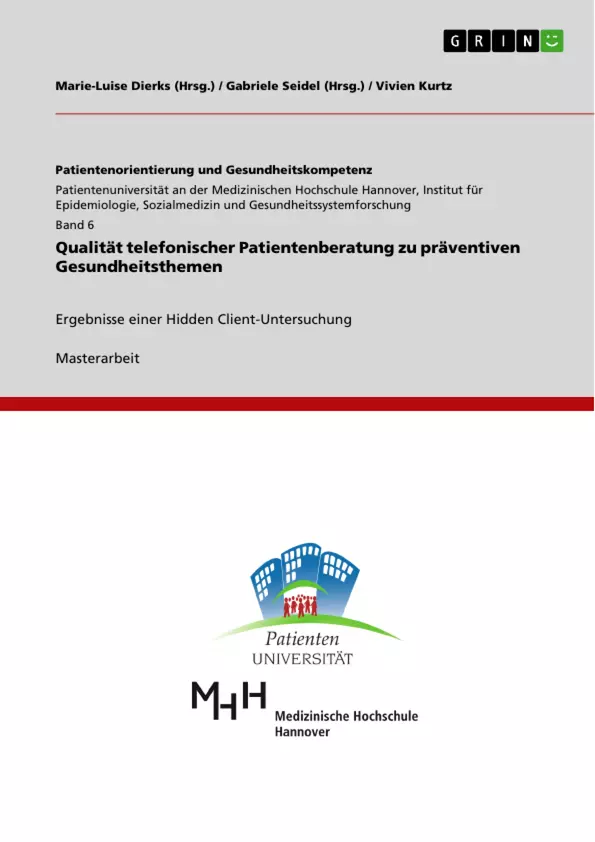Zur Untersuchung der Qualität sowie der inhaltlichen Schwerpunkt¬setzungen „un¬ab¬hän-giger“ und „abhängiger“ Patientenberatungsinsti¬tu¬tionen (Beratungsstellen der unab¬hän¬gi¬gen Ver¬brau¬cher- und Patientenbera¬tung nach § 65b SGB V, Hotlines bzw. Call-Center ge¬setz¬licher Krankenkassen und Ärztekammern) wurde eine explorative Stu¬die mit ver¬deckten Testnutzern, so genannten „Hidden Clients“, durch¬ge¬führt. Ausgewertet wurden As¬pek¬te der Struktur- und Prozess¬qua¬lität der Bera-tun¬gen, die kommunikativen Kom¬petenzen der Berater sowie die Informationsqualität. Zur Auswertung wurden sowohl quantitative als auch qua¬li¬ta¬tive Me¬tho¬den herangezogen.
Die Ergebnisse der Hidden Client-Untersuchung verdeutlichen, dass die Bera-tungsqualität der verschiedenen Institutionen der „unabhängigen“ und „abhän¬gigen“ Patientenberatung und -in¬formation an vielen Stellen ihrer Strukturen, Prozesse und Ergebnisse optimierbar ist. Die Beratungsinhalte entsprachen zwar größtenteils dem ei-genen Selbstverständnis der Be¬ra¬tungsinstitutionen, waren je¬doch unvoll¬ständig und zum Teil fehlerhaft. Zudem zeigten sich un¬terschiedliche Schwerpunktsetzungen in den Be¬ra¬tungen. Diskutiert werden die Resultate der vorliegenden Untersuchung hinsichtlich spezifischer Ver¬bes¬serungs¬möglichkeiten in den ver¬schiedenen Institutionen, der eingesetzten Untersuchungs¬methode sowie der Wei¬ter¬ent¬wicklung der prä¬ventiven bzw. gesund¬heits¬bezo¬genen Patien¬tenbera¬tung und -in¬formation. Opti¬mie-rungspotenziale ergeben sich vor allem für die Erreichbarkeit, die In¬for¬ma¬tions¬qua¬li¬tät, die Schulung von Beratern, die Spezifizierung der Angebote und für die Kooperation zwischen unterschiedlichen Anbietern.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Zielsetzung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Patientenberatung und -information in Deutschland — ein Überblick
- 2.1.1 Informations- und Beratungsangebote für Nutzer
- 2.1.2 Ziele, Aufgaben und Themen der Patientenberatung und -information
- 2.1.2.1 Patientenberatung und -information als Clearing- bzw. Beschwerdestelle
- 2.1.2.2 Patientenberatung und -information als Wegweiser- und Vermittlungsstelle
- 2.1.2.3 Patientenberatung und -information als Anlauf- bzw. Kontaktstelle
- 2.1.3 Institutionen der Patientenberatung und -information in Deutschland
- 2.2 Einrichtungen der „abhängigen" Patientenberatung und -information
- 2.2.1 Patientenberatung und -information durch Leistungserbringer am Beispiel der Arzte bzw. Arztekammern
- 2.2.1.1 Information, Beratung und Aufklärung durch Arzte
- 2.2.1.2 Ziele, Aufgaben und Themen der Patientenberatung und -information bei Arztekammern
- 2.2.1.3 Erfahrungen mit Angeboten der Patientenberatung und -information bei Arztekammern
- 2.2.2 Patientenberatung und -information durch Kostenträger am Beispiel der gesetzlichen Krankenkassen
- 2.2.2.1 Ziele, Aufgaben und Themen der Patientenberatung und -information bei gesetzlichen Krankenkassen
- 2.2.2.2 Patientenberatung und -information bei Hotlines bzw. Call-Centern der gesetzlichen Krankenkassen
- 2.2.2.3 Erfahrungen mit Angeboten der Patientenberatung und -information von gesetzlichen Krankenkassen
- 2.2.1 Patientenberatung und -information durch Leistungserbringer am Beispiel der Arzte bzw. Arztekammern
- 2.3 Einrichtungen der „unabhängigen" Patientenberatung und -information
- 2.3.1 Patientenberatung und -information durch von Leistungserbringern und Kostenträgern unabhängige Stellen im Gesundheitswesen
- 2.3.2 Unabhängige Verbraucher- und Patientenberatung nach S 65b SGB V
- 2.3.2.1 Ziele, Aufgaben und Themen der unabhängigen Verbraucher- und Patientenberatung nach S 65b SGB V
- 2.3.2.2 Erfahrungen mit Angeboten der unabhängigen Verbraucher- und Patientenberatung nach S 65b SGB V
- 2.4 Überprüfung der Qualität von Patientenberatung und -information
- 2.4.1 Aspekte der Qualität von Patientenberatung und -information
- 2.4.2 Untersuchung der Beratungsqualität durch versteckte Testnutzer
- 2.5 Zwischenfazit
- 2.1 Patientenberatung und -information in Deutschland — ein Überblick
- 3 Methode
- 3.1 Auswahl der Beratungsstellen
- 3.2 Testfälle
- 3.3 Rekrutierung und Schulung der verdeckten Testanrufer
- 3.4 Zeitraum und Anzahl der durchgeführten Testanrufe
- 3.5 Dokumentation der Testanrufe
- 3.6 Auswertung der Testanrufe
- 4 Ergebnisse der telefonischen Hidden Client-Untersuchung
- 4.1 Beratungen und Verweise der Testanrufer
- 4.2 Erreichbarkeit der Beratungsstellen
- 4.3 Annahme und Kosten der Gespräche
- 4.4 Dauer und Bearbeitung der Anfragen
- 4.5 Charakteristika der Berater
- 4.6 Umgang mit den Testanrufern während der Gespräche
- 4.7 Fokus der Beratungsgespräche
- 4.8 Kommunikative Kompetenzen der Berater
- 4.9 Inhaltsanalytische Auswertung der Beratungsinhalte
- 4.9.1 Inhalte der Beratung in den drei Testfällen
- 4.9.2 Inhalte der Beratung in den drei Beratungsinstitutionen
- 4.9.3 Bewertung der inhaltlichen Qualität der Beratungen
- 4.9.3.1 Bewertung anhand von Musterantworten externer Experten
- 4.9.3.2 Zusätzliche Bewertung anhand immanenter Kriterien der Institutionen
- 5 Diskussion
- 6 Zusammenfassung
- 7 Literatur
- 8 Abbildungsverzeichnis
- 9 Tabellenverzeichnis
- 10 Abkürzungsverzeichnis
- 11 Internetadressen der untersuchten Institutionen
- 12 Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit ist eine überarbeitete Version der Magisterarbeit in Public Health von Vivien Kurtz, verfasst im Studienschwerpunkt Gesundheitsförderung und präventive Dienste. Sie trägt den Titel „Qualität telefonischer Patientenberatung zu präventiven Gesundheitsthemen — Ergebnisse einer Hidden Client-Untersuchung bei unabhängigen Verbraucher- und Patientenberatungsstellen nach S 65b SGB V, gesetzlichen Krankenkassen und Ärztekammern".
- Die Qualität telefonischer Patientenberatung zu präventiven Gesundheitsthemen zu untersuchen.
- Die Informations- und Beratungsqualität verschiedener Patientenberatungsangebote transparent zu machen.
- Die inhaltlichen Schwerpunktsetzungen verschiedener Patientenberatungsangebote zu analysieren.
- Die unterschiedlichen Beratungsstrukturen und -prozesse in den verschiedenen Institutionen zu beleuchten.
- Die Stärken und Schwächen der „unabhängigen" und „abhängigen" Patientenberatung zu verdeutlichen.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 bietet einen umfassenden Überblick über die theoretischen Grundlagen der Patientenberatung und -information in Deutschland. Es werden verschiedene Formen der „abhängigen" und „unabhängigen" Patientenberatung vorgestellt, ihre Ziele, Aufgaben und Themenfelder beleuchtet und die Überprüfung der Qualität von Patientenberatung und -information diskutiert.
Kapitel 3 beschreibt die Methode der explorativen Hidden Client-Untersuchung, die zur Überprüfung der Beratungs- und Informationsqualität bei verschiedenen Patientenberatungsstellen eingesetzt wurde. Es werden die Auswahl der Beratungsstellen, die Entwicklung der Testfälle, die Rekrutierung und Schulung der Testanrufer sowie der Zeitraum und die Anzahl der durchgeführten Testanrufe erläutert. Zudem wird die Dokumentation der Testanrufe und ihre Auswertung mittels quantitativer und qualitativer Methoden beschrieben.
Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der Hidden Client-Untersuchung. Es werden die Beratungs- und Verweisstrukturen der verschiedenen Beratungsstellen, die Erreichbarkeit der Beratungsstellen, die Annahme und Kosten der Gespräche, die Dauer und Bearbeitung der Anfragen sowie die Charakteristika der Berater beschrieben. Zudem wird der Umgang der Berater mit den Testanrufern während der Gespräche und der inhaltliche Fokus der Beratungsgespräche analysiert. Die kommunikativen Kompetenzen der Berater werden anhand einer Schulnotenskala bewertet und die Beratungsinhalte mithilfe der inhaltsanalytischen Auswertung der Wortprotokolle untersucht. Die Ergebnisse der Bewertung der inhaltlichen Qualität der Beratungen anhand von Musterantworten externer Experten sowie anhand immanenter Kriterien der Institutionen werden ebenfalls dargestellt.
Kapitel 5 diskutiert die Ergebnisse der Untersuchung hinsichtlich ihrer Bedeutung für die drei Beratungsinstitutionen der unabhängigen Patientenberatung nach S 65b SGB V, der gesetzlichen Krankenkassen und der Ärztekammern sowie dortiger Optimierungspotenziale. Zudem werden Verbesserungsmöglichkeiten der eingesetzten Untersuchungsmethode herausgearbeitet. In einem Ausblick wird auf Möglichkeiten der zukünftigen Entwicklung einer präventiven bzw. gesundheitsbezogenen Patientenberatung und -information eingegangen. Die Untersuchungsergebnisse werden letztlich in Empfehlungen gebündelt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Förderschwerpunkt Lernen, den inklusiven und exklusiven Unterricht sowie die schulische Inklusion, insbesondere in Nordrhein-Westfalen. Empirische Forschungsergebnisse werden präsentiert, um die Rahmenbedingungen und Herausforderungen der inklusiven Beschulung von Kindern mit dem Förderschwerpunkt Lernen zu beleuchten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Bielefelder Längsschnittstudie (BiLieF-Projekt), die die Leistungsentwicklung und das Wohlbefinden von Schülern in inklusiven und exklusiven Förderarrangements vergleicht. Weitere Themen sind Förderempfehlungen, die Herausforderungen der Inklusion sowie Implikationen für die Schulentwicklung und Inklusionspraxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Hidden Client-Untersuchung?
Die Studie untersucht die Beratungsqualität von Hotlines der Krankenkassen, Ärztekammern und unabhängiger Beratungsstellen durch verdeckte Testanrufer.
Wie wurde die Qualität der Patientenberatung bewertet?
Bewertet wurden Strukturqualität, Prozessqualität, kommunikative Kompetenz der Berater sowie die inhaltliche Korrektheit der Informationen anhand von Experten-Musterantworten.
Welche Mängel wurden in der telefonischen Beratung festgestellt?
Die Ergebnisse zeigen, dass die Beratungsinhalte oft unvollständig oder teilweise fehlerhaft waren und die Erreichbarkeit sowie Informationsqualität optimiert werden müssen.
Gibt es Unterschiede zwischen "abhängiger" und "unabhängiger" Beratung?
Ja, die Arbeit beleuchtet unterschiedliche Schwerpunktsetzungen und Stärken/Schwächen zwischen Kassen-Hotlines (abhängig) und Stellen nach § 65b SGB V (unabhängig).
Welche Verbesserungsvorschläge leitet die Studie ab?
Empfohlen werden bessere Schulungen für Berater, eine engere Kooperation zwischen Anbietern und eine Spezifizierung der Beratungsangebote.
- Citation du texte
- Vivien Kurtz (Auteur), Marie-Luise Dierks (Éditeur de série), Gabriele Seidel (Éditeur de série), 2006, Qualität telefonischer Patientenberatung zu präventiven Gesundheitsthemen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178079