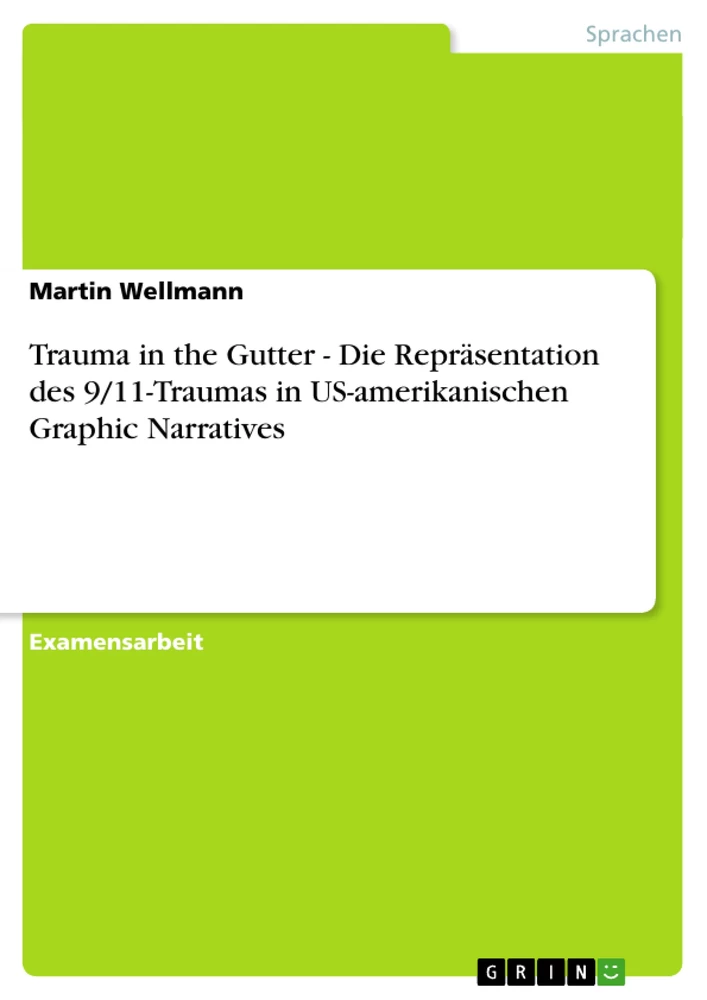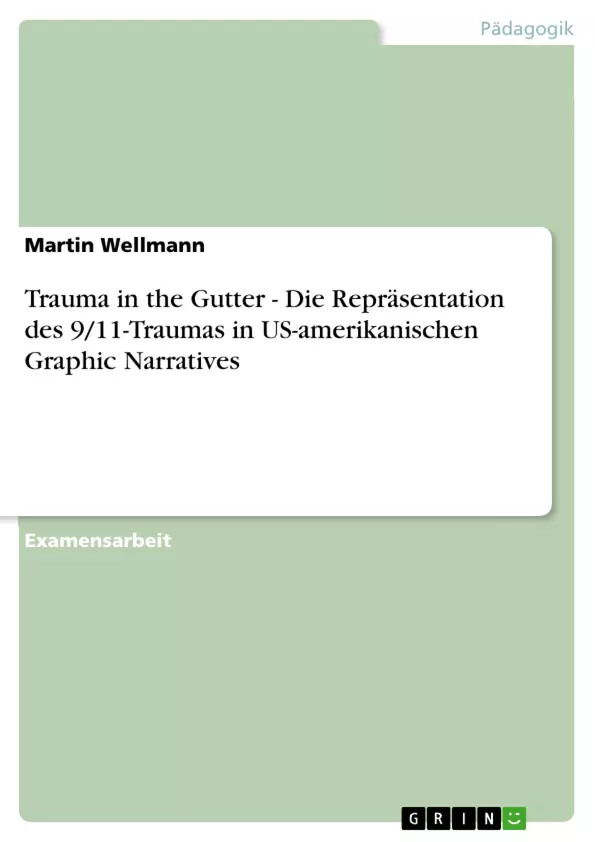Diese Arbeit zeigt, wie das Trauma des 11. Septembers in Graphic Narratives repräsentiert wird. Dazu wird in einem theoretischen Rahmen zunächst das Medium Graphic Narrative näher beschrieben. Dabei wird vor allem auf die Besonderheiten bezüglich der Repräsentationskraft des Mediums eingegangen. Danach folgt eine Erläuterung des psychologischen Konzepts des Traumas. Um eine differenzierte Analyse zu bieten, wird das Trauma-Phänomen auf zwei verschiedenen Ebenen untersucht: auf individueller und auf kollektiver Ebene.
Zur Erforschung von Traumata, die traditionell dem Bereich der Psychologie zugeordnet werden, kann die Literaturwissenschaft bemerkenswerterweise einen bedeutenden Beitrag leisten. Sie kann Grenzen überschreiten, und zu Gebieten vordringen, die der psychologischen Forschung allein verschlossen bleiben. Wie sich zeigen wird, eignet sich das Medium der Graphic Narrative besonders gut, um die rätselhafte Wirkungsweise des Traumas besser verstehen zu können.
Der Textkorpus für diese Arbeit wurde den beiden Untersuchungsebenen des Traumakonzepts entsprechend gewählt. Anhand avancierter Graphic Narratives, wie zum Beispiel den Werken von Art Spiegelman oder Peter Kuper, soll das Trauma auf individueller Ebene näher untersucht werden. Die Texte eignen sich hierfür besonders gut, da sie autobiografisch sind und auf persönlichen Erlebnissen, die die Autoren an jenem Morgen machten, beruhen. Die Auswirkungen des 11. Septembers auf kollektiver Ebene lassen sich besonders gut mithilfe sich an ein breiteres Publikum richtender Graphic Narratives zeigen. Zu den für diese Arbeit gewählten Texten zählen sowohl fiktive Superheldengeschichten, als auch verschiedene Reaktionen renommierter Graphic Narrative-Autoren der großen ‚Mainstream‘-Verlagshäuser.
Jede dieser Graphic Narratives wird auf besondere Aspekte hinsichtlich ihrer Repräsentationsfähigkeit von Trauma untersucht. In dieser Arbeit soll daher nicht nur bewiesen werden, dass sich Graphic Narratives dazu eignen Trauma zu repräsentieren, sondern dass die ‚bunten Heftchen‘ aufgrund ihrer vielseitigen Darstellungsmöglichkeiten es schaffen, das komplexe Phänomen des Traumas besonders gut in Wort und Bild zu fassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. SUPERMAVUND DER 12. SEPTEMBER 2001
- 2. UND GRAPHIC NARRATIVE - EINE MÉSALLL4NCE?
- 2.1 Graphic Narrative
- 2.1.1 Über ,Comics' und ,Graphic Novels' zu Graphic Narratives
- 2.1.2 Graphic Narrative— Ein Medium in Wort und Bild
- 2.1.3 Die Sprache der Graphic Narrative
- 2.1.4 Die Interaktion von Wort und Bild
- 2.2 Trauma
- 2.2.1 Die Geschichte des Traumas
- 2.2.2 Individuelles Trauma
- Ursache und Wirkung einer unsichtbaren Wunde
- Das individuelle Trauma des Art Spiegelman
- 2.2.3 Kollektives Trauma
- Massenhafte Traumatisierungen und Traumatisierung der Masse
- Das kollektive Trauma des I I. Septembers
- 2.3 Trauma und Narration
- 2.3.1 Die dreifache Paradoxie des Traumas
- 2.3.2 Die Repräsentation von Trauma in Graphic Narratives
- 2.3.3 Der Closure-Effekt in Peter Milligans rhe Unshredded Man
- 3. INDNIDUELLES TRAUNLA IN POST-9/ll-GRAPHIC NARRATIVES
- 3.1 Art Spiegelmans In the Shadow of No Towers
- 3.1.1 Die Architektur der , No Towers'
- 3.1.2 Trauma und Visualität in 'n the Shadow of No Towers
- 3_1.3 Trauma und Temporalität in In the Shadow of No Towers
- 3.2 Peter Kupers Stop Forgetting to Remember
- 3.2.1 Fiktion und Wirklichkeit in Stop Forgetting to Remember
- 3.2.2 Der 11. September in roter und schwarzer Tinte
- 3.3 Dean Haspiels 91101
- 3.3.1 Die Medialität des 9/11-Traumas in 91101
- 3.3.2 Die Realität des 9/11-Traumas in 91101
- 4. KOLLEKTIVES TRAUNA IN POST-9/11-GRAPHIC NARRATIVTS
- 4.1 J. Michael Straczvnskis The Amazing Spider-Man #36
- 4.1.1 Der 11. September als „narrativer Ground Zero'
- 4.1.2 Der 11. September durch die Augen des Superhelden
- 4.1.3 Der Superheld als stillerZeuge
- 4.1.4 Die Helden des 11. Septembers
- 4.2 9-11 — Artists Respond & Tell Stories
- 4.2.1 Heroisierende Erzählmuster
- 4.2.2 Stereotypisierende Erzählmuster
- 4.2.3 Deeskalierende und homogenisierende Erzählmuster
- 5. WORDS DON'T DO IT
- BIBLIOGRAPHIE
- ABBILDUNGSVERZEICHMS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Repräsentation des 9/11-Traumas in US-amerikanischen Graphic Narratives. Sie analysiert, wie dieses traumatische Ereignis in verschiedenen Werken verarbeitet und dargestellt wird, sowohl auf individueller als auch auf kollektiver Ebene. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie Graphic Narratives als Medium zur Veranschaulichung und Verarbeitung von Trauma eingesetzt werden können.
- Das Medium Graphic Narrative und seine Besonderheiten
- Das psychologische Konzept des Traumas auf individueller und kollektiver Ebene
- Die Repräsentation von Trauma in Graphic Narratives
- Die Auswirkungen des 9/11-Traumas auf die US-amerikanische Gesellschaft
- Die Rolle von Superhelden und Helden des Alltags in der Verarbeitung des 9/11-Traumas
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die kontroverse Superman-Ausgabe #596, die aufgrund ihrer expliziten Darstellung der Zerstörung der Twin Towers kurz nach den Terroranschlägen vom 11. September zurückgerufen wurde. Es wird gezeigt, wie die Ereignisse des 11. Septembers eine beispiellose Terrorwelle in den Vereinigten Staaten auslösten und zu einer massenhaften Traumatisierung führten.
Das zweite Kapitel stellt das Medium Graphic Narrative und das psychologische Konzept des Traumas vor. Es wird die Geschichte der Traumaforschung von den ersten Untersuchungen von Eisenbahnunfällen bis zur modernen Traumaforschung mit der Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) aufgezeigt. Darüber hinaus werden die unterschiedlichen Aspekte des Traumas auf individueller und kollektiver Ebene erläutert. Das Kapitel endet mit einer detaillierten Analyse des individuellen Traumas von Art Spiegelman, der sowohl den Holocaust als auch die Anschläge vom 11. September erlebte.
Das dritte Kapitel analysiert verschiedene Autographics, in denen das 9/11-Trauma auf individueller Ebene dargestellt wird. Es werden die Werke von Art Spiegelman, Peter Kuper und Dean Haspiel genauer betrachtet. Spiegelmans In the Shadow of No Towers zeigt, wie der Autor sein Trauma mithilfe von Visualität und Temporalität verarbeitet. Kupers Stop Forgetting to Remember thematisiert die Problematik der Abbildung von Fiktion und Wirklichkeit in einer Autobiografie. Haspiels 91101 stellt den Kontrast zwischen medialisierter und direkter Traumatisierung dar.
Das vierte Kapitel untersucht die Auswirkungen des 11. Septembers auf die US-amerikanische Gesellschaft und die Rolle von Superhelden und Helden des Alltags in der Verarbeitung des 9/11-Traumas. Anhand von J. Michael Straczynskis The Amazing Spider-Man #36 wird gezeigt, wie der Superheld mit der Katastrophe konfrontiert wird und seine Machtlosigkeit erlebt. Das Kapitel analysiert die Reaktionen der Graphic Narrative-Autoren als Kollektiv in den Sammelwerken 9-11 — Artists Respond & Tell Stories und 9-11 — The World's Finest Comic Book Writers & Artists Tell Stories to Remember. Es werden verschiedene Erzählmuster, wie heroisierende, stereotypisierende und deeskalierende Darstellungen, untersucht.
Das fünfte Kapitel, "Words Don't Do It", befasst sich mit den Grenzen der sprachlichen Ausdruckskraft angesichts von traumatischen Ereignissen. Es wird gezeigt, wie Bilder und Graphic Narratives eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung und Repräsentation von Trauma spielen können.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen Graphic Narratives, Trauma, 9/11, Superhelden, Helden des Alltags, US-amerikanische Gesellschaft, kollektives Trauma, individuelles Trauma, Repräsentation, Verarbeitung, Visualität, Temporalität, Fiktion, Realität, Medien, Kultur, Literatur, Kunst, Psychologie, Soziologie, Geschichte, Politik.
Häufig gestellte Fragen
Warum eignen sich Graphic Narratives zur Darstellung von Traumata?
Durch die Kombination von Bild und Text können Graphic Narratives die fragmentierte und oft schwer in Worte zu fassende Natur eines Traumas visualisieren und zeitliche Brüche darstellen.
Was ist ein kollektives Trauma im Kontext von 9/11?
Ein kollektives Trauma ist eine Erschütterung, die eine gesamte Gesellschaft betrifft. 9/11 veränderte das Sicherheitsgefühl und das kulturelle Selbstverständnis der USA nachhaltig.
Wie verarbeitete Art Spiegelman die Anschläge?
In seinem Werk 'In the Shadow of No Towers' nutzt er großformatige Tafeln und historische Comic-Stile, um seine persönliche Panik und die visuelle Überwältigung durch die Ereignisse darzustellen.
Welche Rolle spielten Superhelden-Comics nach 9/11?
Viele Mainstream-Comics (z. B. Spider-Man #36) thematisierten die Ohnmacht der Superhelden gegenüber realem Terror und rückten stattdessen die "Helden des Alltags" wie Feuerwehrleute in den Fokus.
Was bedeutet der 'Closure-Effekt' in Comics?
Closure beschreibt die mentale Ergänzung der Lücken zwischen den einzelnen Panels durch den Leser. Bei Trauma-Darstellungen kann dies genutzt werden, um das Unaussprechliche anzudeuten.
- Citar trabajo
- Martin Wellmann (Autor), 2009, Trauma in the Gutter - Die Repräsentation des 9/11-Traumas in US-amerikanischen Graphic Narratives, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178292