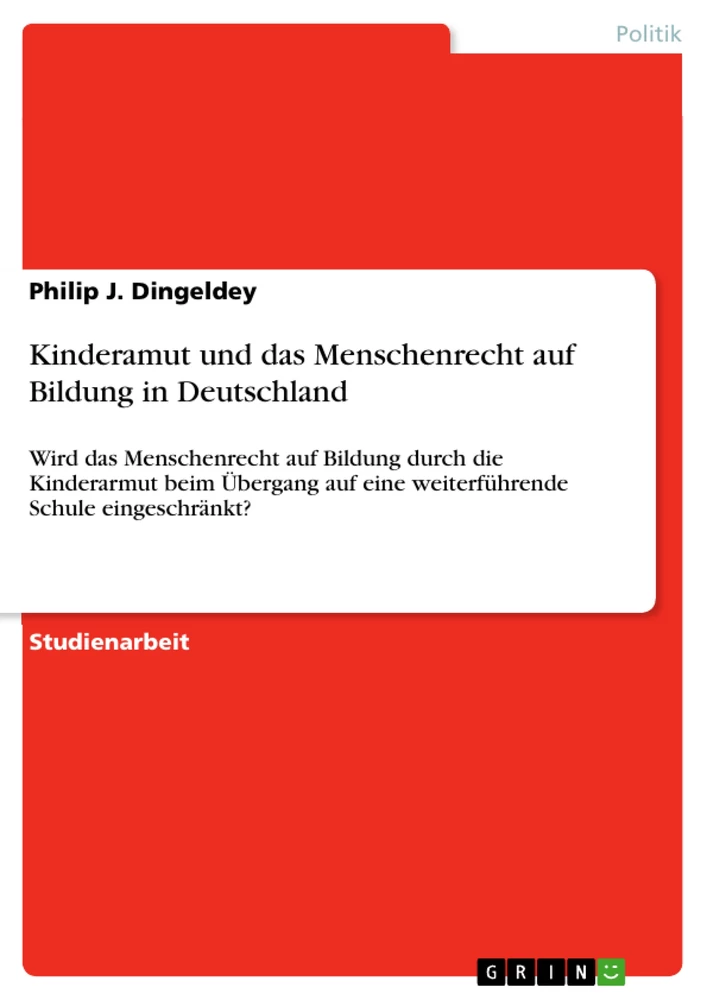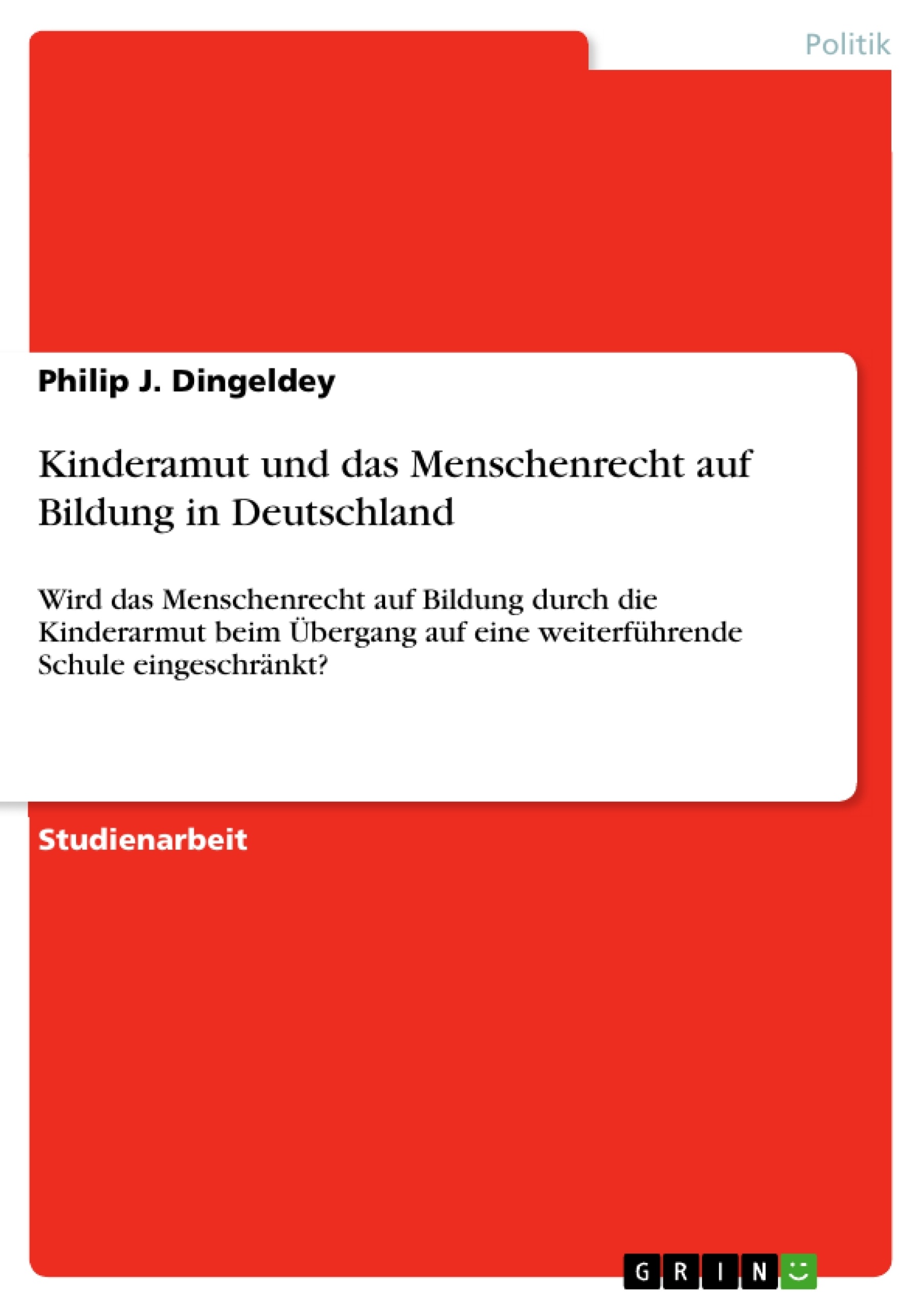Es erscheint schockierend, dass laut dem Sonderberichterstatter der UNO – Vernor Muñoz - verschiedene Studien, wie PISA belegen wollen, dass es eine hohe Verbindung zwischen sozialem Hintergrund und der Chancengleichheit auf Bildung gäbe.
So soll die Frage dieser Arbeit lauten, ob und wenn ja, wo und inwiefern das Menschenrecht auf Bildung durch Kinderarmut eingeschränkt wird. Dabei fokussiere ich mich besonders auf den Übergang von der Grund- auf eine weiterführende Schule, da dieses wegen den Übergangszahlen am besten als empirisches Beispiel fungieren kann und wohl einen der entscheidendsten Einschnitte im Schulleben eines deutschen Kindes darstellt. Soziale Bildungsun-gleichheit definiere ich hierfür nach Schlicht als „ein Konstrukt, welches die Abhängigkeit des individuellen Bildungserfolgs von der individuellen sozialen Herkunft beschreibt.“
Zur Ermittlung der Verbindung von Kinderarmut und der Verwirklichung des Menschenrechts auf Bildung, möchte ich die Arbeit folgendermaßen untergliedern: in einem ersten Teil sollen die Menschenrechtsverträge genannt werden, die das Menschenrecht auf Bildung beinhalten und die mit dem Thema in Verbindung stehenden Vorschriften oder Richtlinien, um eine allgemeine Definition und einen Kriterienkatalog zu haben. Zweitens müssen erst die Kinderarmut, ihr Ausmaß und die Ursachen beleuchtet werden, damit klar wird, womit man es zu tun hat. Drittens soll die konkrete Verbindung der Kinderarmut und der Bildung aufge-zeigt werden, indem erst erläutert wird, inwiefern das eine das andere einschränkt, danach nach politischen und institutionellen Erklärungsansätzen gesucht und eventuelle politische und politikwissenschaftliche Lösungs- und Verbesserungsvorschläge angebracht werden, zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung in der BRD. In einem Abschlussresümee sollen die Lage zusammengefasst und mögliche Ausblicke genannt werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1.) Das Menschenrecht auf Bildung in Deutschland - Definition und Fragestellung
- 2.) Kinderarmut und das Menschenrecht auf Bildung in Deutschland
- 2. 1.) Deutschlands menschenrechtliche Verpflichtungen und Umsetzungen zur Bildung
- 2. 2.) Kinderarmut in Deutschland: Definition: Ausmaße und Erklärungen
- 2. 2. 1.) Definition von relativer Armut und Kinderarmut
- 2. 2. 2.) Ausmaße der Kinderarmut
- 2. 2. 3.) Erklärungen und Ursachen der Kinderarmut
- 2. 3 Zusammenhänge zwischen der Kinderammt und der Verwirklichung des
Menschenrechts auf Bildung
- 2. 3. 1.) Befiund zur bildungspolitischen Lage
- 2. 3 _ 2.) Erklärungen und Ursachen der (menschenrechtswidrigen?) Bildungsungleichheit
- 2. 3 _ 3 Lösungsvorschläge zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung fijr arme Kinder
- 3 Fazit und Ausblick
- 4.) Tabellen
- 5.) Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem Menschenrecht auf Bildung in Deutschland und dessen Einschränkung durch Kinderarmut, insbesondere beim Übergang von der Grundschule auf eine weiterführende Schule. Die Arbeit analysiert die menschenrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands im Bereich der Bildung und untersucht die Ausmaße und Ursachen von Kinderarmut. Im Zentrum steht die Frage, ob und inwiefern die Kinderarmut zu einer menschenrechtswidrigen Bildungsungleichheit führt. Die Arbeit analysiert die bildungspolitische Lage und die Ursachen der Bildungsungleichheit, um anschließend Lösungsvorschläge zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung für arme Kinder zu entwickeln.
- Das Menschenrecht auf Bildung in Deutschland
- Kinderarmut in Deutschland
- Zusammenhänge zwischen Kinderarmut und Bildungsungleichheit
- Mögliche Ursachen der Bildungsungleichheit
- Lösungsvorschläge zur Verbesserung der Bildungschancen für arme Kinder
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel definiert das Menschenrecht auf Bildung in Deutschland und stellt die Fragestellung der Arbeit vor. Es werden die relevanten Menschenrechtsverträge und -richtlinien vorgestellt, die das Menschenrecht auf Bildung beinhalten. Im zweiten Kapitel wird die Kinderarmut in Deutschland beleuchtet, wobei die Definition, die Ausmaße und die Ursachen der Kinderarmut erläutert werden. Das dritte Kapitel analysiert die Zusammenhänge zwischen Kinderarmut und der Verwirklichung des Menschenrechts auf Bildung. Es werden die bildungspolitische Lage, die Ursachen der Bildungsungleichheit und mögliche Lösungsvorschläge vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Menschenrecht auf Bildung, Kinderarmut, Bildungsungleichheit, soziale Ungleichheit, Schulsystem, Grundschule, weiterführende Schule, Gymnasium, Hauptschule, Ganztagsschule, frühkindliche Erziehung, Bildungspolitik, Menschenrechtspolitik, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Kinderarmut und Bildungserfolg?
Ja, Studien wie PISA belegen eine starke Kopplung zwischen dem sozialen Hintergrund und den Bildungschancen. Kinder aus armen Verhältnissen haben oft geringere Aussichten auf höhere Bildungsabschlüsse.
Was ist relative Armut bei Kindern?
Relative Armut bedeutet, dass eine Familie über deutlich weniger Einkommen verfügt als der Durchschnitt der Bevölkerung, was die soziale und kulturelle Teilhabe des Kindes einschränkt.
Warum ist der Übergang nach der Grundschule so entscheidend?
In Deutschland entscheidet sich hier oft der weitere Bildungsweg. Kinder aus armen Familien erhalten bei gleicher Leistung seltener eine Gymnasialempfehlung als Kinder aus wohlhabenden Haushalten.
Ist Bildungsungleichheit ein Verstoß gegen Menschenrechte?
Die Arbeit untersucht, ob die strukturelle Benachteiligung armer Kinder gegen das völkerrechtlich verankerte Recht auf Bildung verstößt.
Welche Lösungen gibt es für mehr Bildungsgerechtigkeit?
Diskutiert werden der Ausbau von Ganztagsschulen, eine bessere frühkindliche Förderung und die Entkopplung von Herkunft und Schulerfolg durch gezielte finanzielle Unterstützung.
- Quote paper
- Philip J. Dingeldey (Author), 2011, Kinderamut und das Menschenrecht auf Bildung in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178318