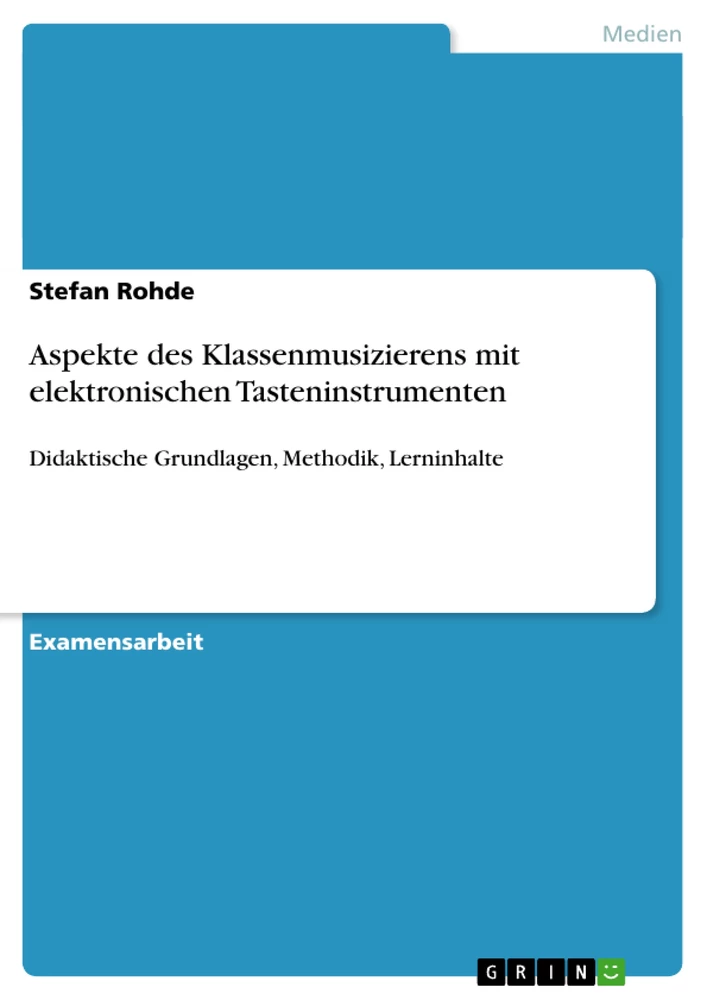„Wir lehren nicht das Tasteninstrument, sondern wir lehren musikalische Grundlagen durch das Tasteninstrument“
(Die Musikwerkstatt; Sek.1-Grundstufe)
...
Wie im eingangs erwähnten Zitat bereits angeklungen ist, darf Keyboardarbeit im Klassenunterricht nicht im Sinne einer Instrumentalausbildung, wie sie z.B. an den staatlich anerkannten und privaten Musikschulen gegeben wird, verstanden werden. Vielmehr sollte das Keyboard als ein Universalinstrument betrachtet werden, das zum einen bei der Erarbeitung musiktheoretischer sowie musikhistorischer Sachverhalte und zum anderen bei der musikpraktischen Arbeit, also dem eigentlichen Musizieren, wertvolle Dienste leisten kann.
Bevor die technisch-historische Entwicklung elektronischer Tasteninstrumente im dritten Kapitel erläutert und eine Begriffsklärung wichtiger keyboardspezifischer Funktionen vorgenommen wird, soll im zweiten Kapitel auf das instrumentale Klassenmusizieren als Form des handlungsorientierten Unterrichtes eingegangen werden.
Im vierten Kapitel werden methodische und inhaltliche Aspekte sowohl einzeln als auch im Kontext mit den Vor- und Nachteilen des Keyboardeinsatzes betrachtet. Da die eigenen Überlegungen bisher nicht in der Praxis erprobt werden konnten und zum Teil auf fremden Erfahrungen basieren, wird im fünften Kapitel eine Methode vorgestellt, die seit 20 Jahren das Klassenmusizieren mit Keyboards entscheidend mitgeprägt hat. Für den Musikunterricht in den einzelnen Bundesländern gibt es Lehrpläne bzw. Rahmenrichtlinien, die bei Einhaltung den Schülern eine umfassende musikalische Bildung ermöglichen. Bei den vorgestellten Inhalten wurde darauf geachtet, dass der Keyboardeinsatz nicht von diesen losgelöst betrachtet wird.
Obwohl ein guter Musikunterricht bei weitem nicht nur von der technischen Ausstattung abhängig ist, spielt die Ausrüstung beim instrumentalen Klassenmusizieren mit Keyboards eine besondere Rolle. In den letzten Jahren sind auf diesem Gebiet kaum Publikationen veröffentlicht worden, so dass das sechste Kapitel dem aktuellen Stand der Technik gewidmet ist.
Die drei letzten Kapitel, das Keyboard in der Musiklehrerausbildung, Erfahrungsberichte und Schlussbemerkungen, beschäftigen sich schlussendlich mit dem aktuellen Geschehen in der Ausbildung mit elektronischen Tasteninstrumenten. Wertvolle Informationen erhielt ich dabei von zwei Pädagogen, die sich intensiv mit den noch recht jungen Instrumenten in der Musikausbildung beschäftigen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
-
II. Instrumentales Klassenmusizieren
- 2.1 Erwartungen und Ziele des instrumentalen Klassenmusizierens
- 2.2 Klassenorchester versus Klassenmusizieren nach einem Lehrgangsprinzip Zwei Formen des Klassenmusizierens im Vergleich
-
III. Das Keyboard
- 3.1 Die technische Entwicklung des Keyboards
- 3.2 Begriffsklärung
-
IV. Das Keyboard im Musikunterricht
-
4.1 Das Keyboard als Klasseninstrument
-
4.1.1 Vorzüge des Keyboardeinsatzes
- 4.1.1.1 Vorteile, die sich für die Spielpraxis und deren Methodik ergeben
- 4.1.1.2 Technische Vorteile
- 4.1.1.3 Wirtschaftliche und logistische Vorteile
- 4.1.2 Probleme des Keyboardeinsatzes
-
4.1.1 Vorzüge des Keyboardeinsatzes
- 4.2 Das Keyboard innerhalb der Rahmenrichtlinien des Landes Sachsen Anhalt
- 4.3 Methodisch-Inhaltlich Aspekte
-
4.1 Das Keyboard als Klasseninstrument
-
V. Die Yamaha KeyboardClass
- 5.1 Die Methode
- 5.2 Lerninhalte
-
VI. Technische Voraussetzungen
- 6.1 Das Keyboard für den Lehrer
- 6.2 Das Keyboard für die Schüler/innen
- 6.3 Aufbau eines Keyboardkabinetts
- VII. Das Keyboard in der Musiklehrerausbildung
-
VIII. Erfahrungsberichte
- 8.1 Interview mit Gerd Rohde
- 8.2 Erfahrungsberichte im Vergleich Firke, Firla, Grunz, Meyer, Wanjura-Hübner
- IX. „Simmed" - Das Keyboard in der innovativen Musikausbildung
- X. Schlussbemerkungen
- XI. Literatur- und Abbildungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit dem Thema des Klassenmusizierens mit elektronischen Tasteninstrumenten, insbesondere dem Keyboard, im Musikunterricht an Gymnasien. Die Arbeit analysiert die didaktischen Grundlagen, die Methodik und die Lerninhalte, die im Zusammenhang mit dem Einsatz von Keyboards im Musikunterricht relevant sind.
- Die didaktischen Grundlagen des Klassenmusizierens mit Keyboards
- Die methodischen Ansätze und die praktische Umsetzung des Keyboardeinsatzes im Unterricht
- Die Lerninhalte, die im Zusammenhang mit dem Keyboard vermittelt werden können
- Die technischen Voraussetzungen und die Ausstattung eines Keyboardkabinetts
- Die Rolle des Keyboards in der Musiklehrerausbildung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert die Motivation des Autors, sich mit dem Einsatz von Keyboards im Musikunterricht zu befassen. Das zweite Kapitel geht auf das instrumentale Klassenmusizieren als Form des handlungsorientierten Unterrichtes ein und betrachtet die Erwartungen und Ziele, die mit dieser Unterrichtsform verbunden sind. Es werden zwei Formen des instrumentalen Klassenmusizierens, das gemeinsame Musizieren nach einem bestimmten Lehrgangsprinzip und das Klassenmusizieren in Klassenorchestern, im Detail gegenübergestellt. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem Keyboard als Instrument und erläutert die technische Entwicklung sowie die wichtigsten keyboardspezifischen Funktionen. Im vierten Kapitel werden methodische und inhaltliche Aspekte des Keyboardeinsatzes im Musikunterricht beleuchtet, wobei sowohl die Vor- als auch die Nachteile des Instrumentes betrachtet werden. Die Rahmenrichtlinien des Landes Sachsen Anhalt und die Kriterien für die Bewertung des Keyboardspiels werden im Detail analysiert. Das fünfte Kapitel stellt die Yamaha KeyboardClass, eine vom Instrumentenhersteller Yamaha entwickelte Methode, die sich mit dem Einsatz von Keyboards im Musikunterricht befasst, vor. Die Methode wird in Bezug auf ihre Ziele, Lerninhalte und technischen Voraussetzungen sowie die Bewertung des Unterrichtserfolges betrachtet. Das sechste Kapitel geht auf die technischen Voraussetzungen für den Einsatz von Keyboards im Musikunterricht ein und erläutert die Ausstattung eines Keyboardkabinetts. Es werden verschiedene Möglichkeiten der Stromversorgung, Verkabelung und die notwendigen technischen Komponenten, wie z.B. Keyboards, Ständer, Kopfhörer, Mischpult und Lautsprecher, vorgestellt. Das siebte Kapitel befasst sich mit dem Keyboard in der Musiklehrerausbildung. Der Autor schildert seine eigenen Erfahrungen und stellt die Schwierigkeiten dar, die es hinsichtlich der künstlerischen und musikpädagogischen Musiklehrerausbildung im Fach Keyboard gibt. Es wird auf die Notwendigkeit einer flächendeckenden Ausbildung für Keyboarder und angehende Keyboardlehrer hingewiesen und die Bedeutung des Keyboards als eigenständiges Instrument betont. Das achte Kapitel enthält Erfahrungsberichte von verschiedenen Musikpädagogen, die sich mit dem Einsatz von Keyboards im Musikunterricht auseinandergesetzt haben. Die Erfahrungen und die Ergebnisse der verschiedenen Unterrichtsformen werden im Detail betrachtet und die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die mit dem Einsatz von Keyboards im Unterricht verbunden sind, werden analysiert. Das neunte Kapitel stellt die „Simmed"-Methode, eine in Holland entwickelte und im Vergleich zu anderen Methoden innovative Methode des Klassenmusizierens mit Keyboards, vor. Die Methode wird in Bezug auf ihre Ziele, Inhalte und die Gestaltung des Unterrichts betrachtet. Es werden die Erfahrungen und die Ergebnisse der Anwendung der „Simmed"-Methode in Holland vorgestellt und die Möglichkeiten und Herausforderungen der Implementierung dieser Methode in Deutschland diskutiert. Die Schlussbemerkungen fassen die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammen und bewerten das Potential des Keyboards im Musikunterricht. Es wird die Bedeutung des Keyboards als Instrument für das instrumentale Klassenmusizieren betont und die Notwendigkeit, die kreativen Möglichkeiten des Keyboards im Unterricht zu nutzen, hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das instrumentale Klassenmusizieren, den Einsatz von Keyboards im Musikunterricht, die didaktischen Grundlagen, die Methodik und die Lerninhalte des Keyboardunterrichts. Die Arbeit beleuchtet die Vorteile und Nachteile des Keyboardeinsatzes, die technischen Voraussetzungen für den Unterricht, die Rolle des Keyboards in der Musiklehrerausbildung und die verschiedenen Methoden des Klassenmusizierens mit Keyboards. Besonderes Augenmerk liegt auf der Yamaha KeyboardClass, der „Simmed"-Methode und den Erfahrungen von Musikpädagogen, die Keyboards im Unterricht einsetzen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel von Keyboardarbeit im Musikunterricht?
Ziel ist nicht die Ausbildung zum Instrumentalisten, sondern die Vermittlung musikalischer Grundlagen durch das Keyboard als Universalinstrument.
Welche Vorteile bietet der Einsatz von Keyboards in der Klasse?
Keyboards sind wirtschaftlich, logistisch einfach zu handhaben und bieten technische Möglichkeiten, die sowohl Theorie als auch Spielpraxis unterstützen.
Was ist die "Yamaha KeyboardClass"?
Es ist eine seit über 20 Jahren bewährte Methode für das Klassenmusizieren, die spezifische Lerninhalte und technische Voraussetzungen definiert.
Welche technischen Voraussetzungen braucht ein Keyboardkabinett?
Benötigt werden Keyboards für Lehrer und Schüler, Kopfhörer, eine zentrale Stromversorgung, Mischpulte und eine angemessene Verkabelung.
Wie wird Keyboardspiel im Unterricht bewertet?
Die Bewertung erfolgt anhand der Rahmenrichtlinien (z.B. in Sachsen-Anhalt) und berücksichtigt sowohl technische Fertigkeiten als auch musikalischen Ausdruck.
- Citar trabajo
- Stefan Rohde (Autor), 2011, Aspekte des Klassenmusizierens mit elektronischen Tasteninstrumenten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178344