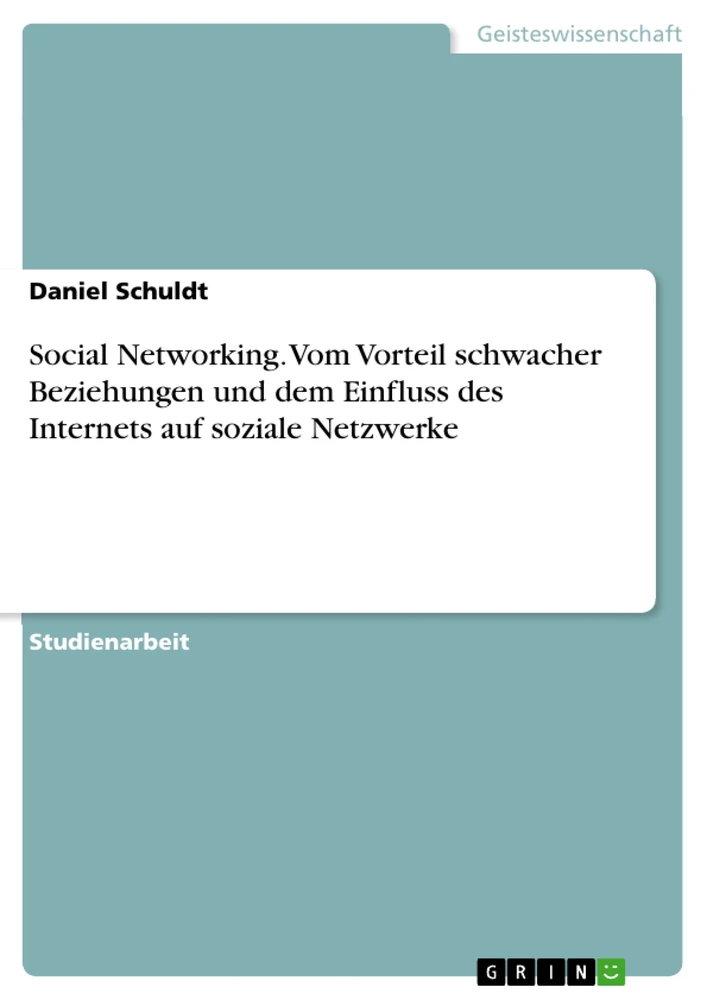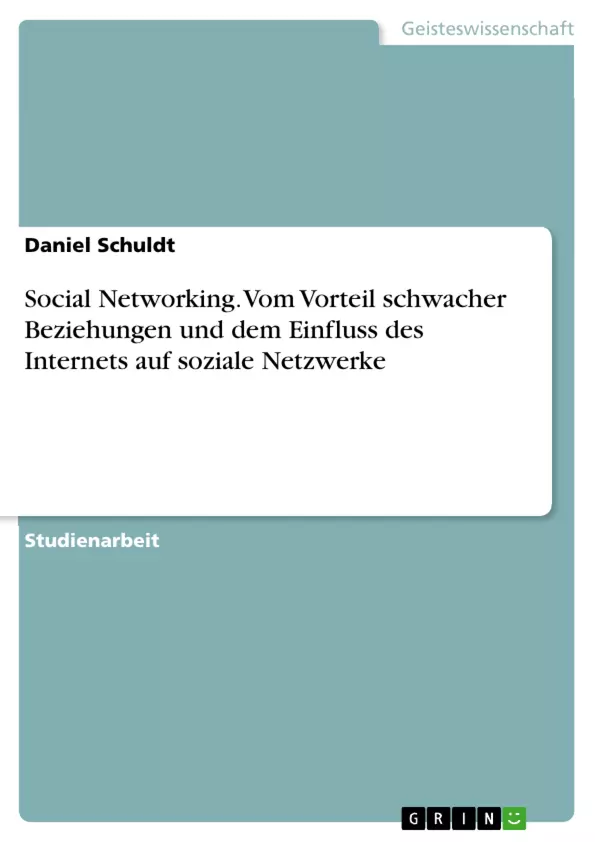Über die Nutzung und Auswirkungen von Social Networking Websites und das Phänomen Networking im Allgemeinen, ist (insbesondere im soziologischen Bereich) bisher kaum relevante Literatur veröffentlicht worden.
Aus diesem Grunde soll diese Arbeit auf der Basis von Florian Renz Veröffentlichung „Praktiken des Social Networking“ und unter Heranführung weiterer verwandter Werke zum Thema Netzwerke und Internetkommunikation, eine Übersicht und eine Grundlage für das Arbeiten mit dem noch recht ‚jungfräulichen’ Thema des Social Networking geben.
Nach der Klärung der grundlegenden Begrifflichkeiten und Theorien zum Thema Netzwerke, Networking und Beziehungsstärken, soll die Arbeit sich mit den bestimmenden Strukturen von sozialen Netzwerken im Online-Bereich auseinander setzen. Dazu werden grundlegende Unterschiede zwischen computervermittelter Kommunikation und Face-To-Face-Kommunikation aufgezeigt und der daraus resultierende Rahmen für soziale Netzwerke im Internet betrachtet.
Darauf folgend soll der Einfluss des Internet auf bereits bestehende Beziehungen, sowie auf die Generierung neuer Kontakte herausgearbeitet werden.
Abschließend werden noch einmal die Merkmale sozialer Netzwerke bei computervermittelter Kommunikation und deren Unterschiede zu regulären sozialen Netzwerken aufgezeigt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Aufbau der Arbeit
- Soziale Netzwerke und die Netzwerkgesellschaft
- Das Konzept des sozialen Netzwerkes
- Die wichtigsten Merkmale sozialer Netzwerke
- Manuel Castells Begriff der Netzwerkgesellschaft
- Praktiken und das zentrale Motiv des Networking
- Das Begriffskonstrukt des Networking und typische Praktiken
- Vermehrung von Sozialkapital als zentrales Motiv des Networking
- Soziale Netzwerke und das Internet
- Merkmale der computervermittelten Fernkommunikation
- Der, Computerrahmen' und seine Kommunikationsregeln
- Einfluss des Internet auf soziale Beziehungen und Netzwerke
- Veränderung von bestehenden sozialen Beziehungen durch das Internet
- Die Entwicklung von neuen Beziehungen über das Internet
- Merkmale sozialer Netzwerke bei computervermittelter Kommunikation
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Social Networking und analysiert die Bedeutung schwacher Beziehungen und den Einfluss des Internets auf soziale Netzwerke. Sie zielt darauf ab, einen Überblick über die Konzepte, Praktiken und Auswirkungen des Social Networking zu liefern. Die Arbeit basiert auf der Publikation „Praktiken des Social Networking“ von Florian Renz und bezieht sich auf relevante Werke zum Thema Netzwerke und Internetkommunikation.
- Das Konzept des Social Networking und seine Entwicklung
- Die Rolle schwacher Beziehungen im Social Networking
- Der Einfluss des Internets auf die Bildung und Gestaltung sozialer Netzwerke
- Die Merkmale von Online-Netzwerken und ihre Unterschiede zu traditionellen Netzwerken
- Die Bedeutung von Sozialkapital im Kontext des Social Networking
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel stellt das Thema Social Networking vor und erläutert die grundlegenden Konzepte und Theorien zu Netzwerken und Beziehungsstärken. Es beleuchtet die Bedeutung des Internets in diesem Kontext. Im zweiten Kapitel werden die Strukturen von sozialen Netzwerken im Online-Bereich analysiert. Es werden Unterschiede zwischen computervermittelter Kommunikation und Face-To-Face-Kommunikation aufgezeigt, sowie der resultierende Rahmen für soziale Netzwerke im Internet betrachtet. Das dritte Kapitel untersucht den Einfluss des Internets auf bestehende soziale Beziehungen und die Generierung neuer Kontakte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die folgenden Schlüsselwörter und Themen: soziale Netzwerke, Netzwerkgesellschaft, Social Networking, schwache Beziehungen, computervermittelte Kommunikation, Internet, Sozialkapital, Online-Netzwerke, Beziehungen, Kommunikation, Einfluss des Internets.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Social Networking“?
Social Networking bezeichnet das Knüpfen und Pflegen von sozialen Kontakten über digitale Plattformen, um soziale Ressourcen und Informationen auszutauschen.
Was ist der Vorteil von „schwachen Beziehungen“ (Weak Ties)?
Schwache Beziehungen bieten oft Zugang zu neuen Informationen und Netzwerken außerhalb des eigenen engen Kreises, was besonders bei der Jobsuche oder Ideengenerierung nützlich ist.
Wie beeinflusst das Internet bestehende soziale Beziehungen?
Das Internet ermöglicht es, bestehende Kontakte über Distanzen hinweg leichter aufrechtzuerhalten, kann aber auch die Qualität der Kommunikation durch den Wegfall von Face-to-Face-Elementen verändern.
Was bedeutet „Sozialkapital“ im Online-Bereich?
Sozialkapital umfasst die Ressourcen (Wissen, Unterstützung, Vertrauen), die eine Person durch ihre Zugehörigkeit zu einem Netzwerk mobilisieren kann.
Was unterscheidet computervermittelte von Face-to-Face-Kommunikation?
Computervermittelte Kommunikation ist oft asynchron, reduziert auf Text oder Bild und bietet weniger nonverbale Signale, was spezielle Kommunikationsregeln erfordert.
Was ist die „Netzwerkgesellschaft“ nach Manuel Castells?
Castells beschreibt eine Gesellschaftsstruktur, deren soziale Organisation sich um digitale Informationsnetzwerke gruppiert, was Machtverhältnisse und soziale Praktiken grundlegend verändert.
- Citar trabajo
- Daniel Schuldt (Autor), 2007, Social Networking. Vom Vorteil schwacher Beziehungen und dem Einfluss des Internets auf soziale Netzwerke, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178533