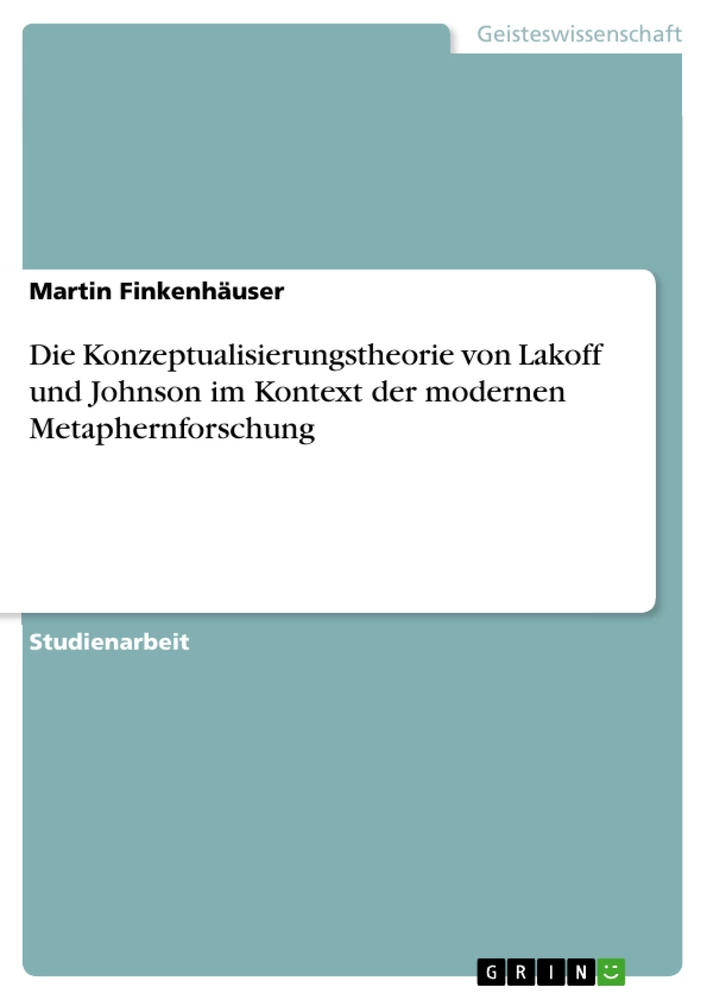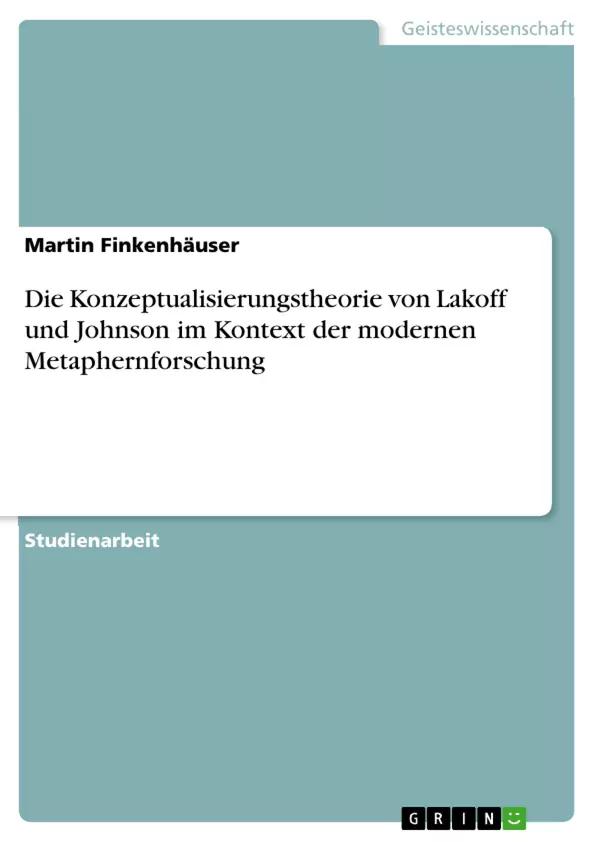In den letzten fünfzig Jahren sind eine Vielzahl wissenschaftlicher Forschungsarbeiten über die Metapher erschienen. Die Ergebnisse der Arbeiten von Max Black veranlasste viele Linguisten und Philosophen sich intensiv mit Metaphern zu beschäftigen, so dass wir heute ein breites Spektrum unterschiedlichster Metapherntheorien vorfinden. Es soll nun im Folgenden speziell um die von George Lakoff und Mark Johnson vorgeschlagene Theorie gehen, welche ausführlich in dem gemeinsam verfassten Buch ‚Metaphors we live by’ formuliert wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Die Metapher als Werkzeug des Denkens und Handelns
- Erfahrungsmythos zwischen Objektivismus und Subjektivismus
- Der objektivistische Mythos
- Der subjektivistische Mythos
- Ein Vergleich von Metapherntheorien
- Aristoteles
- John Rogers Searle
- Friedrich Nietzsche
- Max Black und Ivor Armstrong Richards
- Bernhard Debatin
- Benjamin N. Colby
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Konzeptualisierungstheorie von Lakoff und Johnson und ordnet diese in die aktuelle Forschungslage der Metaphernforschung ein. Sie zeigt die Abgrenzung der Theorie zu objektivistischen und subjektivistischen Sichtweisen auf und vergleicht sie mit anderen exemplarischen Metapherntheorien. Darüber hinaus wird anhand der Kulturtheorie von Benjamin N. Colby aufgezeigt, wie Lakoff und Johnsons Theorie in der modernen Forschung anderer Wissenschaftsdisziplinen Bestätigung findet.
- Die Konzeptualisierungstheorie von Lakoff und Johnson
- Die Abgrenzung zu objektivistischen und subjektivistischen Sichtweisen
- Vergleiche mit anderen Metapherntheorien
- Die Bestätigung der Theorie in der modernen Forschung anderer Disziplinen
- Die Rolle der Metapher im Denken, Handeln und der Kultur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung stellt die Konzeptualisierungstheorie von Lakoff und Johnson vor und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Das zweite Kapitel beschreibt die Metapher als ein Werkzeug des Denkens und Handelns, wobei die drei Arten von Metaphern (Orientierungsmetaphern, ontologische Metaphern und konzeptuelle Metaphern) vorgestellt werden. Das dritte Kapitel beleuchtet den Erfahrungsmythos und grenzt die Theorie von Lakoff und Johnson sowohl vom Objektivismus als auch vom Subjektivismus ab. Das vierte Kapitel bietet einen Vergleich der Konzeptualisierungstheorie mit anderen Metapherntheorien, darunter Aristoteles, John Rogers Searle, Friedrich Nietzsche, Max Black und Ivor Armstrong Richards, Bernhard Debatin und Benjamin N. Colby.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Konzeptualisierungstheorie, die Metapher, Objektivismus, Subjektivismus, Erfahrungsmythos, kognitive Linguistik, Kulturtheorie, Anthropologie, interdisziplinäre Forschung, adaptive Potential, kulturelles Wohlbefinden, Teezeremonie, japanische Kultur, Begriffsbildung, Kommunikation, Sprache, Denken, Handeln, Wahrheit, Realität.
Häufig gestellte Fragen
Worauf basiert die Theorie von Lakoff und Johnson?
Sie basiert auf dem Buch „Metaphors we live by“ und betrachtet Metaphern nicht nur als sprachliches Schmuckmittel, sondern als zentrales Werkzeug des Denkens und Handelns.
Welche drei Arten von Metaphern werden unterschieden?
Die Theorie unterscheidet Orientierungsmetaphern, ontologische Metaphern und konzeptuelle Metaphern.
Was ist der „Erfahrungsmythos“?
Der Erfahrungsmythos stellt eine dritte Position zwischen den Extremen des Objektivismus (absolute Wahrheit) und des Subjektivismus (rein persönliche Wahrnehmung) dar.
Mit welchen anderen Denkern wird die Theorie verglichen?
Der Text zieht Vergleiche zu Aristoteles, Nietzsche, Max Black, Ivor Armstrong Richards und John Searle.
Wie wird die Theorie interdisziplinär bestätigt?
Die Arbeit zeigt auf, wie die Kulturtheorie von Benjamin N. Colby die kognitiven Ansätze von Lakoff und Johnson in der modernen Forschung unterstützt.
- Citation du texte
- Martin Finkenhäuser (Auteur), 2008, Die Konzeptualisierungstheorie von Lakoff und Johnson im Kontext der modernen Metaphernforschung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178544