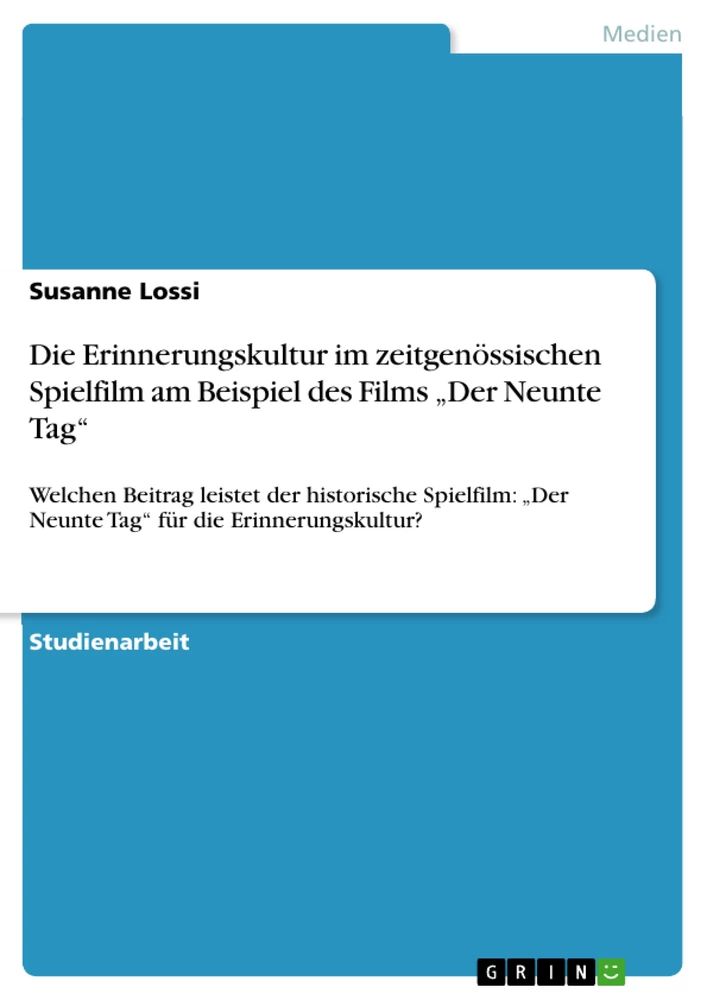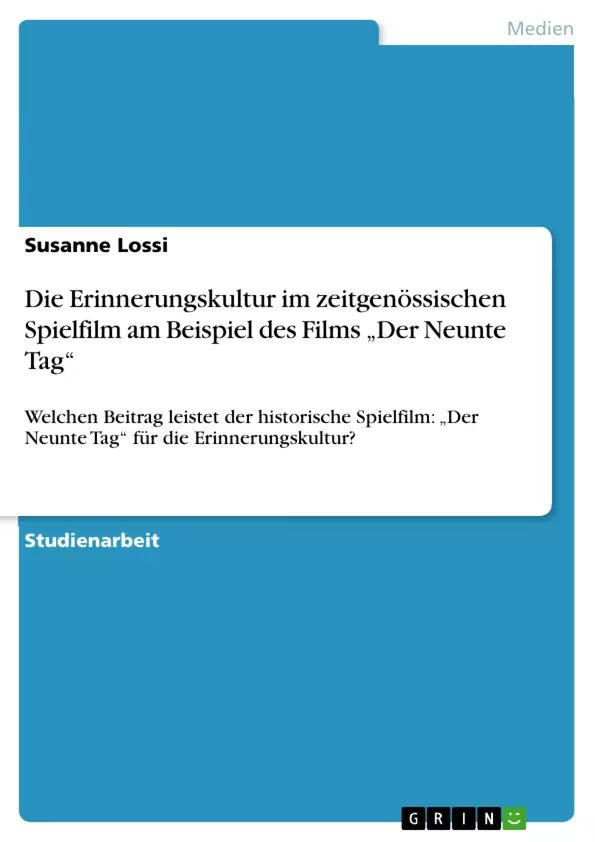„Film kann die Welt nicht verändern oder verbessern, er kann aber Stimmung schaffen.“
Dieses Zitat von Bernhard Wicki wurde anlässlich der ersten Jugendkinotage im Jahr 2003 zum Grundsatz der Bemühungen für ein besseres Verständnis von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Gerade die jungen und heranwachsenden Mitglieder unserer Gesellschaft besitzen nur wenige Berührungspunkte mit den menschenverachtenden Diktaturen der Vergangenheit. Allerdings muss sich gerade unsere heutige säkularisierte Gesellschaft mehr denn je mit der Fragestellung nach der Allmächtigkeit des Menschen und der daraus resultierenden Grenz- bzw. Maßlosigkeit des menschlichen Handelns auseinandersetzen. Werte wie Ethik, Moral und Verantwortung gegenüber seinen Mitbürgern und der Gesellschaft als Ganzem scheinen in die Vergessenheit zu geraten.
Nur eine lebendige Erinnerungskultur, welche die Leistungen der Vergangenheit in die Gegenwart und Zukunft trägt, ist in der Lage, diesen geistig-moralischen Zerfall entgegenzuwirken. Der Begriff der Erinnerungskultur ist in einer Vielzahl von Staaten untrennbar mit dem Schlagwort des Holocausts verbunden. Erinnerungskultur als das „kollektiv geteilte Wissens über die Vergangenheit“ kann folglich als die Geschichte im Gedächtnis der Gegenwart aufgefasst werden. Diese unvergängliche Relevanz begründet die aufgezeigte Fragestellung und rechtfertigt die ausführliche Beschäftigung mit diesem Themenbereich.
Die folgende Arbeit beschäftigt sich auf der Grundlage dieser Überlegungen mit der Fragestellung: Welchen Beitrag leistet der historische Spielfilm: „Der Neunte Tag“ von Volker Schlöndorff für die Erinnerungskultur?
Der Hauptteil dieser Arbeit fokussiert sich auf die Einordung des zu interpretierenden Films in den historischen Gesamtkontext. Im Besonderen wird hier sowohl auf die Historizität und Authentizität als auch auf die ethische Relevanz des Films hinsichtlich des Beitrages, welchen er für die Erinnerungskultur leistet, eingegangen. Um jedoch eine zufriedenstellende Antwort auf die dargestellte Problematik zu erhalten, wird zunächst eine Analyse des Films „Der Neunte Tag“ vorgenommen. Unter diesem Gliederungspunkt werden die bisherigen Karrieren der beiden Hauptdarsteller: Jürgen Matthes sowie August Diehl herausgearbeitet und im Hinblick auf ihre Filmrollen dargestellt. Im Folgenden werden die Filmbotschaft, die Leitmotive und die daraus resultierende Symbolik kritisch hinterfragt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Filmanalyse „Der Neunte Tag"
- Das Leben und Wirken der beiden Hauptdarsteller
- Der Protagonist — Abbé Henri Kremer (Ulrich Matthes)
- Der Antagonist — Untersturmbannführer Gebhardt (August Diehl)
- Humanes Handeln in einer inhumanen Welt? — Die Filmbotschaft und der ethische Konflikt
- Die Leitmotive
- „Und führe uns nicht in Versuchung..." — Die Frage der Schuld
- Der Glaube und das Problem der Theodizee
- Versuchung und Verrat
- Die Symbolik
- Wasser
- Brot
- Die theologische Dimension der Symbole: Wasser und Brot
- Die Historizität und Authentizität
- Die Historizität
- Das Verhältnis der katholischen Kirche im Dritten Reich am Beispiel von Luxemburg
- Das KZ Dachau und der „Pfarrerblock"
- Die Authentizität
- Die Quellen der Filmhandlung
- Ausgewählte Beispiele der Authentizität
- Die Erinnerungskultur und die ethische Relevanz des Films für die Gegenwart und Zukunft
- Ergebnis und Ausblick
- Bücher, Artikel, Aufsätze
- Interviews
- Filmografie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, welchen Beitrag der historische Spielfilm „Der Neunte Tag" von Volker Schlöndorff zur Erinnerungskultur leistet. Die Analyse konzentriert sich auf die Einordnung des Films in den historischen Kontext, insbesondere auf die Historizität und Authentizität der Filmhandlung sowie auf die ethische Relevanz des Films für die Erinnerungskultur. Darüber hinaus werden die Filmbotschaft, die Leitmotive und die Symbolik des Films kritisch hinterfragt.
- Das Verhältnis der katholischen Kirche zum Nationalsozialismus
- Die Frage der Schuld und Verantwortung im Kontext des Holocaust
- Die Bedeutung des Glaubens und des Gewissens in extremen Situationen
- Die Rolle des Spielfilms in der Erinnerungskultur
- Die ethische Relevanz von historischen Filmen für die Gegenwart und Zukunft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Erinnerungskultur in der heutigen Gesellschaft dar und erläutert die Fragestellung der Arbeit. Anschließend wird die Filmanalyse des Films „Der Neunte Tag" durchgeführt, wobei die beiden Hauptdarsteller, die Filmbotschaft, der ethische Konflikt, die Leitmotive und die Symbolik des Films beleuchtet werden. In diesem Zusammenhang werden insbesondere die Themen der Schuld, des Glaubens, der Versuchung und des Verrats sowie die Symbolkraft von Wasser und Brot behandelt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit der Historizität und Authentizität des Films. Dabei wird das Verhältnis der katholischen Kirche zum Nationalsozialismus am Beispiel von Luxemburg sowie das KZ Dachau und der „Pfarrerblock" beleuchtet. Zudem werden die Quellen des Films vorgestellt und ausgewählte Beispiele für eine authentische Filmhandlung aufgezeigt.
Im vierten Kapitel wird die Erinnerungskultur und die ethische Relevanz des Films für die Gegenwart und Zukunft untersucht. Es wird betont, dass der Film einen wichtigen Beitrag zur Vergangenheitsbewältigung und zum Geschichtsbewusstsein leistet, insbesondere im Hinblick auf die Bedeutung des individuellen Widerstands gegen menschenverachtendes Regime. Die Aktualität der im Film aufgeworfenen Themen und die authentische Darstellung der Filmhandlung tragen dazu bei, dass der Film auch für zukünftige Generationen von großer Bedeutung sein wird.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Erinnerungskultur, den historischen Spielfilm, „Der Neunte Tag", den Nationalsozialismus, die katholische Kirche, das KZ Dachau, die Schuld, der Glaube, die Versuchung, der Verrat, die Historizität, die Authentizität, die ethische Relevanz und die Vergangenheitsbewältigung. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung des Films für die Erinnerungskultur und die ethische Verantwortung, die wir gegenüber der Geschichte tragen.
- Citation du texte
- Susanne Lossi (Auteur), 2011, Die Erinnerungskultur im zeitgenössischen Spielfilm am Beispiel des Films „Der Neunte Tag“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/178848