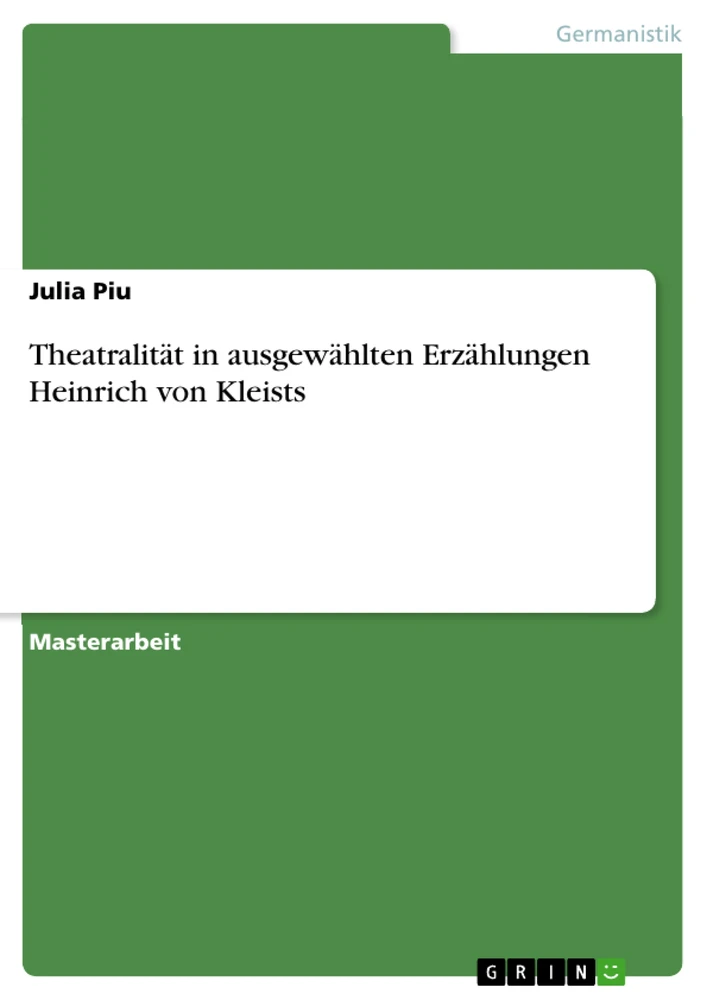Die Arbeit beschäftigt sich mit theatralen Momenten und den entsprechenden Erzähltechniken in folgenden Werken Heinrich von Kleists: Über das Marionettentheater, Der Zweikampf, Die Marquise von O..., Der Findling und Die Verlobung in St. Domingo. Insbesondere werden narrative Körperinszenierungen und Beobachtungsszenarien untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theatralität in Kleists Biographie
- Theoretische Grundlagen
- Erzähltechnik
- Körpertheater
- Beobachtungsszenarien
- Textanalysen
- Über das Marionettentheater
- Der Zweikampf
- Die Marquise von O...
- Der Findling
- Die Verlobung in St. Domingo
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Funktion theatraler Elemente in ausgewählten Erzählungen Heinrich von Kleists. Sie befasst sich mit dem Topos vom „theatralen Erzählen um 1800“ und analysiert, wie Kleist dramatische Elemente einsetzt, um die narrative Kommunikation zwischen Text und Leser zu gestalten.
- Die Verwendung theatraler Elemente in Kleists Erzählungen im Kontext der Literatur um 1800
- Die Analyse von narrativen Inszenierungen, Körperdarstellungen und Beobachtungsszenarien in ausgewählten Werken
- Die Untersuchung der Funktion theatraler Elemente für die Gefühlsvermittlung und die Rezeption des Lesers
- Die Rolle der Erzählerinstanz und ihre Beziehung zum Leser in Kleists Erzählungen
- Die Verbindung von theatralem Erzählen und bildlicher Imagination in Kleists Texten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsgegenstand und die methodische Vorgehensweise erläutert. Im zweiten Kapitel wird die Bedeutung von Theatralität in Kleists Biografie beleuchtet. Das dritte Kapitel widmet sich den theoretischen Grundlagen und beleuchtet verschiedene Aspekte der Erzähltechnik, des Körpertheaters und der Beobachtungsszenarien. In den Textanalysen werden die Novellen "Über das Marionettentheater", "Der Zweikampf", "Die Marquise von O...", "Der Findling" und "Die Verlobung in St. Domingo" im Hinblick auf ihre theatralen Elemente untersucht.
Schlüsselwörter
Theatralität, Erzähltechnik, Kleist, Literatur um 1800, narrative Inszenierung, Körperdarstellung, Beobachtungsszenarien, Gefühlsvermittlung, Rezeption, Erzählerinstanz, bildliche Imagination
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Theatralität" in der Literatur von Heinrich von Kleist?
Theatralität bezieht sich auf dramatische Erzähltechniken, Körperinszenierungen und Beobachtungsszenarien, die Kleist nutzt, um Gefühle und Handlungen plastisch darzustellen.
Welche Werke Kleists werden hinsichtlich ihrer Theatralität analysiert?
Untersucht werden unter anderem "Über das Marionettentheater", "Die Marquise von O...", "Der Zweikampf" und "Die Verlobung in St. Domingo".
Welche Rolle spielt der Körper in Kleists Erzählungen?
Der Körper dient als Medium der Kommunikation; durch Gestik und Mimik werden oft Wahrheiten vermittelt, die durch Worte allein nicht fassbar sind.
Was sind Beobachtungsszenarien bei Kleist?
Es handelt sich um narrative Situationen, in denen das Gesehene und die Perspektive des Beobachters die Handlung vorantreiben oder zu Missverständnissen führen.
Wie beeinflusst die Theatralität die Rezeption des Lesers?
Durch die bildliche Imagination und die dramatische Zuspitzung wird der Leser stärker in das emotionale Geschehen der Novellen einbezogen.
- Quote paper
- Julia Piu (Author), 2009, Theatralität in ausgewählten Erzählungen Heinrich von Kleists, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179195