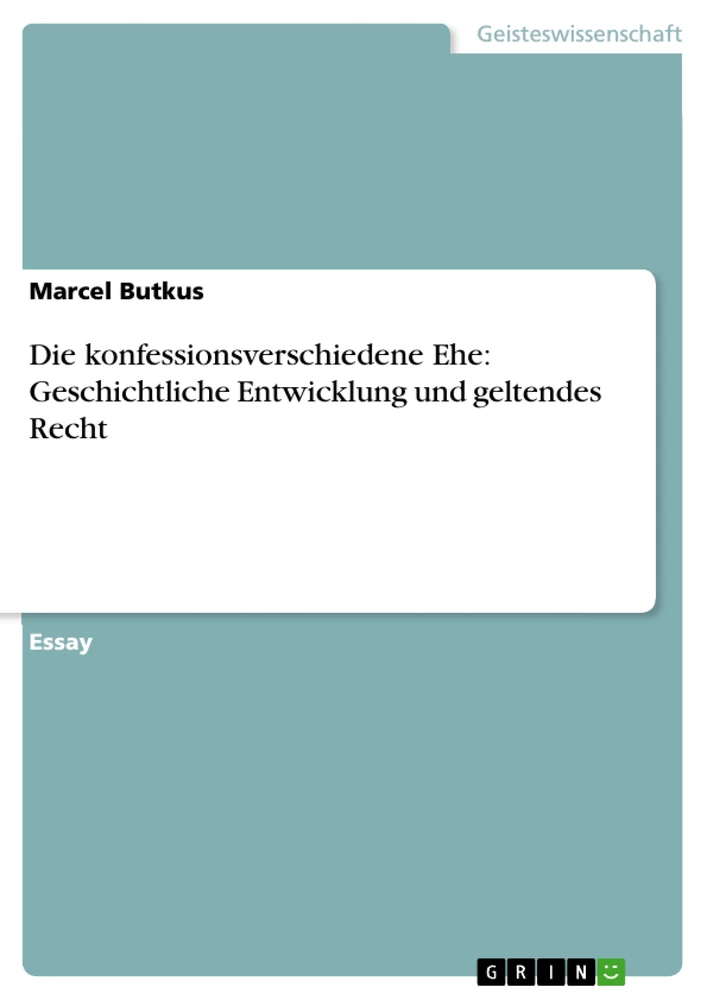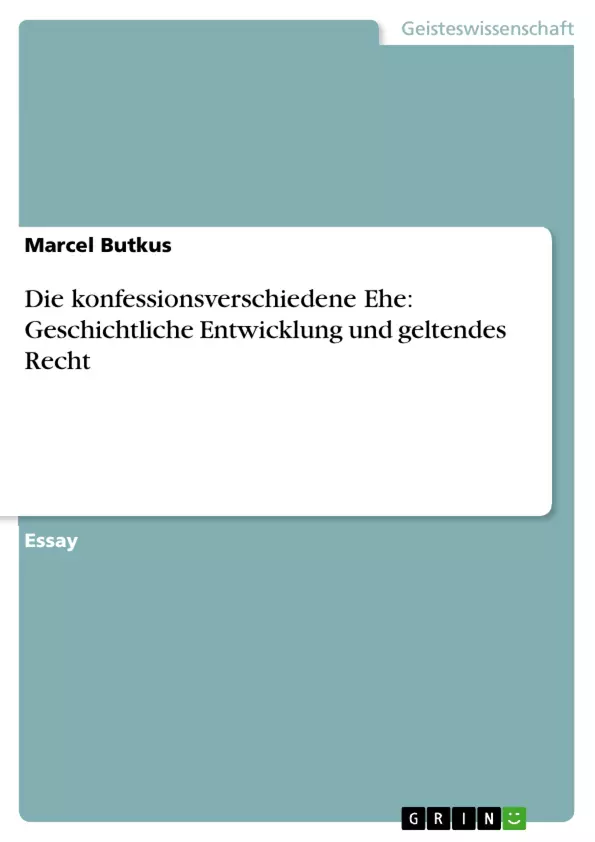Die konfessionsverschiedene Ehe galt nach Recht des CIC/1917 als Ehehindernis und das zuwiderhandeln konnte mit der Exkommunikation geahndet werden. Zuvor war der Abschluss einer solchen Ehe nicht von großer Bedeutung, da es kaum konfessionsverschiedene Paare gab und solche die sich trauen lassen wollten. Dies lag im Speziellen daran, dass es viele Gebiete gab, in denen größtenteils nur Menschen lebten, die einer Konfession angehörten. Durch die Industrialisierung und der Verstädterung änderte sich dieses Bild rapide. Die Zahl der konfessionsverschiedenen Ehen nahm zu und die Kirche musste sich nun mit diesem „Problem“ befassen.
Im Folgenden wird zunächst die konfessionsverschiedene Ehe definiert, dann die geschichtliche Entwicklung und die Vorraussetzung für den Abschluss aufgezeigt. Zum Schluss behandelt das Essay die eigentliche Eheschließung und deren Eintragung.
1. Einleitung
Die konfessionsverschiedene Ehe galt nach Recht des CIC/1917 als Ehehindernis und das zuwiderhandeln konnte mit der Exkommunikation geahndet werden. Zuvor war der Abschluss einer solchen Ehe nicht von großer Bedeutung, da es kaum konfessionsverschiedene Paare gab und solche die sich trauen lassen wollten. Dies lag im Speziellen daran, dass es viele Gebiete gab, in denen größtenteils nur Menschen lebten, die einer Konfession angehörten. Durch die Industrialisierung und der Verstädterung änderte sich dieses Bild rapide. Die Zahl der konfessionsverschiedenen Ehen nahm zu und die Kirche musste sich nun mit diesem „Problem“ befassen.[1]
Im Folgenden wird zunächst die konfessionsverschiedene Ehe definiert, dann die geschichtliche Entwicklung und die Vorraussetzung für den Abschluss aufgezeigt. Zum Schluss behandelt das Essay die eigentliche Eheschließung und deren Eintragung.
2. Definition der konfessionsverschiedenen Ehe
Unter einer konfessionsverschiedenen Ehe versteht man laut can. 1124 CIC eine zwischen zwei Getauften geschlossene Ehe.[2] Dabei muss der eine Partner katholisch getauft oder in die katholische Gemeinde aufgenommen worden sein. Der andere Partner muss einer nichtkatholischen Kirche bzw. kirchlichen Gemeinschaft zugehörig sein, d.h. getauft sein, auch wenn ein nichtkatholischer Christ aus seiner Kirche oder Gemeinschaft ausgetreten ist und kein anderes Bekenntnis angenommen hat. Die konfessionsverschiedene Ehe setzt die an beide Partner gültig gespendete Taufe in folgenden Kirchen oder kirchlichen Gemeinschaften voraus: orthodoxe Kirche; altkatholische Kirche; evangelisch-lutherische und reformatorische Kirche; evangelische Gliederkirchen der Union; anglikanische Kirche sowie Mennonieten, Herrnhüter Gemeinde, Siebenten-Tages-Adventisten, Baptisten und neuapostolische Kirche.[3]
3. Die geschichtliche Entwicklung
Bevor die konfessionsverschiedene Ehe durch eine Dispens erlaubt werden konnte, war sie nach dem Recht des CIC/1917 ein Ehehindernis[4]. Der Papst konnte zwar in Einzelfällen eine Dispens erteilen, doch eine solche Befreiung von der kanonischen Formpflicht wurde damals noch nicht erteilt werden.
Des Weiteren mussten sich beide Partner in jeden Fall dazu verpflichten, katholisch zu heiraten, die Kinder katholisch zu taufen und in diesem Glauben zu erziehen. Eine Zuwiderhandlung führte zur Exkommunikation.
Da es zu immer mehr Ausnahmen bzw. Einzelentscheidungen durch den Papst und zu neuen Vorschläge während des Verfassens des Ökumenismusdekretes kam, wurden in dem Entwurf des Votums über das Sakrament der Ehe, das den Konzilsvätern am 19./20. November 1964 vorlag, reformierte Normen für die konfessionsverschiedene Ehe vorgeschlagen. Diese wurden an den Papst gesandt, um eine Neuregelung vorzunehmen.[5]
Darauf folgte die Instruktion „Matrimonii sacramentum“, die von der Kongregation für Glaubenslehre am 18. März 1966 erlassen wurde.[6] Hierdurch kommt es zu Neuordnungen, doch am Hindernis der Konfessionsverschiedenheit wird weiterhin festgehalten. Aber in ihr wird festgelegt, dass nun der Ortsordinarius die Dispens erteilen kann. Jedoch müssen sich die Partner weiterhin verpflichten ihr Eheleben, Taufe und Erziehung der Kinder nach den Lehren der katholischen Kirche auszurichten. Der nichtkatholische Partner muss die Verpflichtung des katholischen Partners akzeptieren und darf ihn in der Ausübung nicht behindern. Nur bei auftretenden Schwierigkeiten wird der Papst in die Entscheidung einbezogen. Auch werden can. 1102 § 2 und 1109 § 3 abgeschafft und die Erlaubnis zur Brautmessen, sowie zum Brautsegens kann erteilt werden. Diese Instruktion tritt am 19. Mai 1966 in Kraft.
Durch die Deutsche Bischofskonferenz werden am 31. März 1966 eine „Verlautbarung zur Mischehe“ und „Die Anwendung der neuen Mischehebestimmungen in der deutschen Diözese“ veröffentlicht, damit die Neuerungen für Deutschland allgemein festgelegt und gültig werden.
Des Weiteren wird am 22. Februar 1967 ein „Dekret über die gemischten Ehe zwischen Katholiken und Nicht-Katholiken der östlichen Riten“ veröffentlicht. Das Dekret bindet die Eheschließung zwischen einem Katholiken und einem Orthodoxen an die kanonische Formpflicht. Eine Nichtbeachtung dieser Weisung bedeutete aber nicht, dass die Ehe ungültig war, sondern dass sie von der katholischen Kirche „nur“ unerlaubt war. Das Dekret geht dabei davon aus, dass die Eheschließung mit der Beteiligung eines geweihten Amtsträgers stattfindet.
Die Bischofssynode von 1967 beschäftigte sich mit einem Fragenkatalog zur konfessionsverschiedenen Ehe, dieser befasst sich mit der Terminologie der Mischehe, der Dispens, der Aufhebung des Hindernisses, der kanonischen Formpflicht und der Dispens davon und der seelsorgerischen Betreuung der Ehe.
Am 31. März 1970 erließ Papst Paul VI. das Motu Proprio „Matrimonia mixta“, das am 01. Oktober 1970 rechtskräftig wurde. Dadurch wird eine neue rechtliche Grundlage für die konfessionsverschiedene Ehe geschaffen und bekannt gegeben.[7] Die Bestimmungen der MP waren zeitgemäß und aus ökumenischer Sicht ein großer Fortschritt. Die Deutsche Bischofskonferenz veröffentlichte zu der MP ebenfalls mit Rechtskraft zum 01. Oktober 1970 am 23. September 1970 die „Ausführungsbestimmungen zum Motu Proprio MATRIMONIA MIXTA vom 31. März 1970 über die rechtliche Ordnung konfessionsverschiedener Ehen“. Mit ihr wurden explizit die Neuerungen für die deutschen Diözesen festgelegt.
Die für die Reform des Codex Iuris Canonici verantwortliche Kommission legt für die konfessionsverschiedene Ehe fest, dass diese kein Ehehindernis mehr darstellte, sondern es ein Verbot war, solche Ehen zu schließen. Im Einzelfall kann unter bestimmten Voraussetzungen das Verbot außer Kraft gesetzt bzw. aufgehoben werden, im Schema CIC 1980 fehlte das verbietende Ehehindernis. Dies brachte sie zu dem Schluss die verbietenden Ehehindernisse im Allgemeinen und auch das Hindernis der Konfessionsverschiedenheit abzuschaffen.
Die Beschlüsse, die 1970 veröffentlicht wurden, bilden heute die Grundlage des Codex Iuris Canonici und werden im Folgenden behandelt.
4. Erlaubnis und Vorraussetzungen
Da eine konfessionsverschiedene Ehe ohne die Erlaubnis einer kirchlichen Autorität verboten ist, muss diese vor dem Abschluss dieser Ehe eingeholt werden. Allgemein zuständig für die Erlaubnis ist der Ortsordinarius des Wohnsitzes des katholischen Partners[8]. Im Einzelfall kann jeder Seelsorger mit allgemeiner Traubefugnis den Partnern den Abschluss erlauben, sofern er die Erlaubnis vom Papst erbeten hat.[9]
Eine weitere Voraussetzung für die Eheschließung bei konfessionsverschiedenen Partnern bezieht sich auf die Glaubensverpflichtungen des katholischen Partners, die er nach der Trauung umzusetzen hat. Damit ist gemeint, dass er seinen Glauben in der Ehe bewahren muss und sich nicht der Gefahr des Glaubensabfalls aussetzen darf. Die Ehepartner sollen sich im täglichen Eheleben zwar im offenen Dialog im Bezug auf ihre Religion begegnen, dürfen sich aber nicht beeinflussen lassen und dadurch ihren Glauben vernachlässigen. Dies wird im Ehevorbereitungsprotokoll unter der Frage Nr. 18a behandelt.[10] Außerdem geht es im Vorfeld besonders um die Taufe und Erziehung der Kinder, die aus einer solchen Ehe hervorgehen. Denn der katholische Ehepartner soll sich laut Frage Nr. 18b im Ehevorbereitungsprotokoll nach Kräften bemühen, seine Kinder katholisch taufen zu lassen und sie im Sinne der katholischen Kirche zu erziehen. Wenn der nichtkatholische Partner während der Beantwortung der Fragen nicht anwesend sein sollte, muss dieser darüber unbedingt aufgeklärt werden, sodass er genauestens über die Glaubensverpflichtungen informiert ist. Dies heißt aber nicht, dass die Glaubensverpflichtungen des nichtkatholischen Partners, die mit denen des katholischen Partners übereinstimmen, außer Acht gelassen werden dürfen.[11] Beide müssen die Verpflichtungen des jeweils Anderen respektieren und in ihr tägliches Leben einbauen. Daher muss vor der Eheschließung geklärt werden, wie die Kinder des Paares erzogen werden sollen. Es muss im Einzelfall nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt werden. Der katholische Partner kann sein Versprechen auch abgeben, auch wenn er nicht direkt bzw. an der Kindeserziehung beteiligt ist. Das Verständnis der Kirche beinhaltet auch, dass der Partner die christliche Gestaltung des Ehe- und Familienleben aktiv mitgestaltet, durch seine beispielhafte Lebensführung den Kindern den katholischen Glauben näher bringt. Außerdem führt er mit seinem Partner intensive Glaubensgespräche und vertieft seinen Glauben durch religiöse Fortbildungen und bindet das Gebet für die Einheit im Glauben in den Familienalltag ein, da alle Menschen eins sind.[12] Sobald also die nicht katholische Taufe und Erziehung zugelassen wird darf sich der katholische Partner nicht von der religiösen Erziehung distanzieren.
Des Weiteren muss die Ehe generell in kanonischer Form geschlossen werden, es gibt aber auch die Möglichkeit eine Dispens von der kanonischen Formpflicht zu erlangen (siehe Dispens von kanonischer Formpflicht).
Wenn ansonsten keine Ehehindernisse vorliegen, kann der Ortsordinarius bzw. der Seelsorger mit allgemeiner Traubefugnis die Eheschließung vollziehen.
5. Die Eheschließung
Sobald alle Vorbereitungen getroffen wurden und der Ortsordinarius gegebenenfalls der Eheschließung zugestimmt hat, ist eine Feier dieser Schließung möglich. Grundsätzlich ist es dem Paar aber nur erlaubt die Ehe in kanonischer Form zu schließen.
Sofern nicht anders gewünscht findet die Eheschließung in der katholischen Kirche in Form eines Wortgottesdienstens statt. Auf Wunsch kann diese auch als Eucharistie gefeiert werden, wobei beim Empfang der Eucharistie im Bezug auf die Christen der Reformation keine Ausnahme gemacht wird.[13]
[...]
[1] vgl. Motu Proprio „Matrimonia mixta“ vom 31.März.1970 über die rechtliche Ordnung. In: Kirchliches Amtsblatt für das Bistum Essen, Ausgabe 19, Essen 1970, S. 145
[2] Codex Iuris Canonici – Codex des kanonischen Rechtes. Lateinisch-deutsche Ausgabe mit Sachverzeichnis, 5. Auflage, Kevelar 2004, can. 1124
[3] Joseph Prader/Heinrich J.F. Reinhardt, Das kirchliche Eherecht in der seelsorgerischen Praxis, 4. Auflage, Essen, 2001, S.173
[4] vgl. Heinrich J.F. Reinhardt Die kirchliche Trauung. Ehevorbereitung, Trauung und Registrierung der Eheschließung im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz. Texte und Kommentar, 2. Auflage, Essen 2006, S. 73
[5] Heribert Heinemann, Die konfessionsverschiedene Ehe, in: Handbuch des katholischen Kirchenrechts, hrsg. Von Joseph Listl u. Heribert Schmitz, 2. Auflage, Regensburg 1999, S. 797
[6] vgl. Motu Proprio „Matrimonia mixta“, S. 147
[7] Heribert Heinemann, Die konfessionsverschiedene Ehe, S. 798
[8] vgl. can. 1125
[9] Heinrich J.F. Reinhardt, Die kirchliche Trauung. Ehevorbereitung, Trauung und Registrierung der Eheschließung im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz. Texte und Kommentar, S. 103
[10] vgl. Ehevorbereitungsprotokoll
[11] ebd. Anm. 15
[12] Heinrich J.F. Reinhardt, Die kirchliche Trauung. Ehevorbereitung, Trauung und Registrierung der Eheschließung im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz. Texte und Kommentar, S. 92
[13] vgl. Heinrich J.F. Reinhardt, Die kirchliche Trauung. Ehevorbereitung, Trauung und Registrierung der Eheschließung im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz. Texte und Kommentar, S. 51
- Citation du texte
- Marcel Butkus (Auteur), 2007, Die konfessionsverschiedene Ehe: Geschichtliche Entwicklung und geltendes Recht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179279