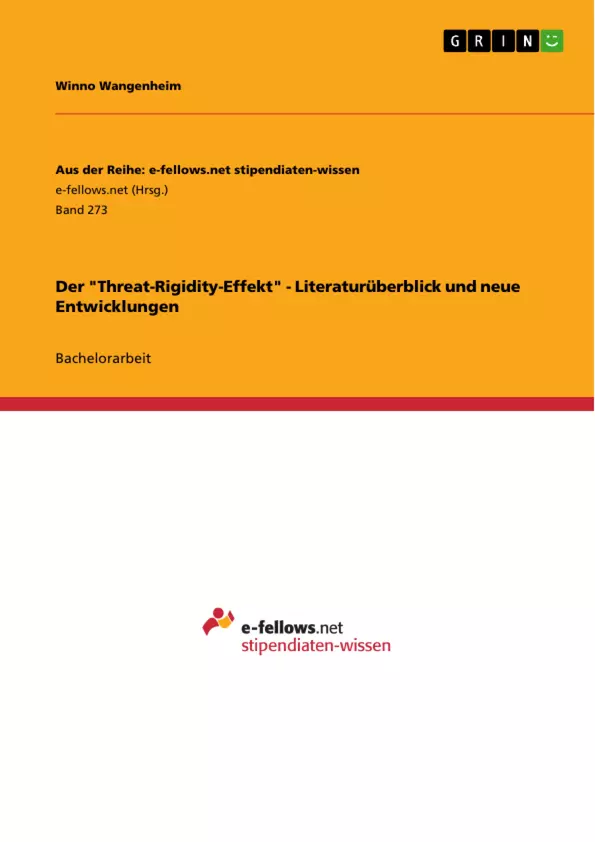Wie handelt ein Organismus angesichts einer Gefahr? Die Biologie gibt hierzu eine Antwort: Laut Walter Cannon, einem renommierten Psychologie-Professor der Harvard University, handeln beispielsweise Tiere nach genau drei Verhaltensmustern: „Fight, Flee or Freeze“. Ein Tier nimmt den Kampf gegen die Gefahr, etwa ein anderes Tier an, es versucht sich durch Flucht zu retten oder es erstarrt. Ähnliches gilt auch für Menschen, wie folgendes Bild aus dem Alltag zeigt: Eine Wespe setzt sich auf den Arm eines Menschen. Durch Stillhalten sind hier die Aussichten, nicht gestochen zu werden, am Höchsten. Intuitiv, wenn auch fälschlicherweise, würden die meisten Menschen jedoch weglaufen oder nach der Wespe schlagen, oft wohlwissend, dass besser still verharrt werden sollte.
In beiden Situationen erscheint das Erstarren aus den Augen des Betroffenen als die Verhaltensmöglichkeit mit den geringsten Erfolgsaussichten. Der Vergleich zur Organisationsumwelt ist hier nahe liegend.
Sollten sich Organisationen Veränderungen und Notwendigkeiten verweigern, würde ein Veränderungsprozess, der im Idealfall zur Rettung der Organisation führt, immens erschwert werden. Hier wird das Paradoxon deutlich: Bei radikalen Umweltveränderungen haben Flexibilität und Diversität der Reaktionen der Betroffenen „Überlebenswert“ . Eine Starre ist also genau das, was dem Sinn dieser Aussage folgend das Falsche ist. Gilbert (2001) spricht gar davon, dass die Reaktion auf externe Bedrohungen die vielleicht kritischste Herausforderung für die Nachhaltigkeit eines Unternehmens ist. Wie groß die Rolle organisationalen Beharrungsvermögens, in diesem Rahmen ist, bleibt zunächst offen.
Diese Ambivalenz, die im Lauf dieser Arbeit- wie in der Ausgangsstudie- „duale Natur“ des Threat-Rigidity-Effekts genannt wird, soll hier wiederholt aufgegriffen werden.
Im ersten Teil dieser Arbeit wird das Thema zunächst in den Kontext betriebswirtschaftlicher Forschung eingeordnet. Anschließend wird der Threat-Rigidity-Effekt auf der individuellen Ebene, der Gruppenebene und der organisationalen Ebene erklärt und die dem entsprechenden Modelle der Ausgangsstudie erläutert. Im zweiten Teil wird ein Überblick über die neuen Entwicklungen der Forschung auf diesem Gebiet gegeben. Dabei wird untersucht, inwieweit sich die Theorie des Threat-Rigidity-Effekts entwickelt hat.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- A. Der Threat-Rigidity-Effekt – Definition, Hintergrund und theoretische Grundlagen auf den drei Ebenen von Organisationen
- I. Hintergrund, Definition und thematische Einordnung
- II. Individuelle Ebene
- 1.) Stress und Angst
- 2.) Threat-Rigidity in Tarifverhandlungen
- 3.) Threat-Rigidity in der Katastrophenforschung
- III. Gruppenebene - Zusammenhalt, Führung und Uniformität
- IV. Organisationale Ebene - verschiedene Kontexte
- 1.) Informationsfluss
- 2.) Kontrollprozesse und die Dominanz des Effizienzdenkens
- B. Neuere Entwicklungen in der Forschung seit 1981
- I. Individuelle Ebene
- II. Gruppenebene
- 1.) Entscheidungsfindung unter Stress
- III. Organisationale Ebene
- 1.) Threat-Rigidity bei finanziellen Widrigkeiten
- 2.) Präventive Vermeidung von Threat-Rigidity
- 3.) Bedrohung von Unternehmen durch disruptive Technologien
- 4.) Desinvestitionen von vormals akquirierten Unternehmensteilen
- 5.) Threat-Rigidity im Rahmen von Krisen öffentlicher Institutionen
- 6.) Threat-Rigidity und Unternehmensgröße
- C. Kritische Diskussion, Forschungsstand und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Threat-Rigidity-Effekt, ein Phänomen, das beschreibt, wie Individuen, Gruppen und Organisationen in Krisensituationen zu starren Verhaltensweisen neigen. Ziel ist es, einen Literaturüberblick zu geben und neuere Entwicklungen in der Forschung seit der ursprünglichen Studie von Staw et al. (1981) zu präsentieren.
- Definition und theoretische Grundlagen des Threat-Rigidity-Effekts auf individueller, Gruppen- und Organisationsebene
- Analyse neuerer Forschungsergebnisse zum Threat-Rigidity-Effekt
- Untersuchung des Effekts in verschiedenen Kontexten (z.B. Tarifverhandlungen, Katastrophenforschung, Unternehmenskrisen)
- Diskussion der Ambivalenz des Effekts: positive und negative Auswirkungen
- Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen
Zusammenfassung der Kapitel
A. Der Threat-Rigidity-Effekt – Definition, Hintergrund und theoretische Grundlagen auf den drei Ebenen von Organisationen: Dieses Kapitel definiert den Threat-Rigidity-Effekt und ordnet ihn in den Kontext betriebswirtschaftlicher Forschung ein. Es werden die theoretischen Grundlagen auf individueller, Gruppen- und Organisationsebene erläutert, inklusive der Modelle von Staw et al. (1981). Die Kapitelteile befassen sich mit Stressreaktionen auf individueller Ebene, dem Einfluss auf Zusammenhalt und Führung in Gruppen und den Auswirkungen auf Informationsfluss und Kontrollprozesse in Organisationen. Die „duale Natur“ des Effekts – sowohl positive als auch negative Auswirkungen – wird bereits hier angesprochen und legt den Grundstein für die weitere Analyse. Beispiele aus Tarifverhandlungen und der Katastrophenforschung illustrieren die Relevanz des Effekts in verschiedenen Kontexten.
B. Neuere Entwicklungen in der Forschung seit 1981: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Weiterentwicklung der Forschung zum Threat-Rigidity-Effekt seit 1981. Es werden neue Erkenntnisse auf individueller, Gruppen- und Organisationsebene präsentiert, mit besonderem Fokus auf finanziellen Widrigkeiten, präventiven Maßnahmen, disruptiven Technologien, Desinvestitionen, Krisen öffentlicher Institutionen und dem Einfluss der Unternehmensgröße. Die Kapitelteile analysieren, wie der Threat-Rigidity-Effekt in diesen verschiedenen Kontexten in Erscheinung tritt und welche neuen Modelle und Ansätze entwickelt wurden, um das Phänomen besser zu verstehen und zu managen. Der Einfluss disruptiver Technologien wird beispielsweise anhand des Modells von Gilbert (2001) veranschaulicht.
Schlüsselwörter
Threat-Rigidity-Effekt, Krisenmanagement, Organisationsverhalten, Entscheidungsfindung unter Stress, Flexibilität, Starre, Unternehmenskrisen, Gruppenkohäsion, Informationsfluss, disruptive Technologien, Resilienz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Threat-Rigidity-Effekt"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über den Threat-Rigidity-Effekt. Sie untersucht, wie Individuen, Gruppen und Organisationen in Krisensituationen zu starren Verhaltensweisen neigen. Der Fokus liegt auf der Literaturrecherche und der Präsentation neuerer Forschungsergebnisse seit 1981.
Welche Ebenen werden im Zusammenhang mit dem Threat-Rigidity-Effekt betrachtet?
Die Arbeit analysiert den Threat-Rigidity-Effekt auf drei Ebenen: der individuellen Ebene (Stressreaktionen, Verhaltensweisen in Tarifverhandlungen und Katastrophen), der Gruppenebene (Zusammenhalt, Führung, Entscheidungsfindung unter Stress) und der Organisationsebene (Informationsfluss, Kontrollprozesse, finanzielle Widrigkeiten, disruptive Technologien, Krisen öffentlicher Institutionen und Unternehmensgröße).
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition und theoretischen Grundlagen des Threat-Rigidity-Effekts, analysiert neuere Forschungsergebnisse, untersucht den Effekt in verschiedenen Kontexten (z.B. Tarifverhandlungen, Katastrophenforschung, Unternehmenskrisen), diskutiert die Ambivalenz des Effekts (positive und negative Auswirkungen) und gibt einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen. Spezifische Beispiele umfassen den Einfluss disruptiver Technologien und präventive Maßnahmen zur Vermeidung des Effekts.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile (A, B, C). Teil A definiert den Threat-Rigidity-Effekt und erläutert die theoretischen Grundlagen auf den drei Ebenen. Teil B präsentiert neue Forschungsergebnisse seit 1981, untersucht den Effekt in verschiedenen Kontexten und analysiert neue Modelle und Ansätze. Teil C bietet eine kritische Diskussion des Forschungsstandes und einen Ausblick.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Threat-Rigidity-Effekt, Krisenmanagement, Organisationsverhalten, Entscheidungsfindung unter Stress, Flexibilität, Starre, Unternehmenskrisen, Gruppenkohäsion, Informationsfluss, disruptive Technologien und Resilienz.
Welche konkreten Beispiele werden in der Arbeit genannt?
Die Arbeit verwendet Beispiele aus Tarifverhandlungen, der Katastrophenforschung, finanziellen Widrigkeiten in Unternehmen, dem Umgang mit disruptiven Technologien, Desinvestitionen von Unternehmensteilen und Krisen öffentlicher Institutionen, um den Threat-Rigidity-Effekt zu illustrieren.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, einen umfassenden Literaturüberblick zum Threat-Rigidity-Effekt zu liefern und die neueren Entwicklungen in der Forschung seit der Studie von Staw et al. (1981) aufzuzeigen.
Welche Modelle und Ansätze werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert die Modelle von Staw et al. (1981) und weitere neuere Modelle und Ansätze zur Erklärung und zum Management des Threat-Rigidity-Effekts, inklusive des Modells von Gilbert (2001) im Kontext disruptiver Technologien.
- Citation du texte
- Winno Wangenheim (Auteur), 2011, Der "Threat-Rigidity-Effekt" - Literaturüberblick und neue Entwicklungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/179590