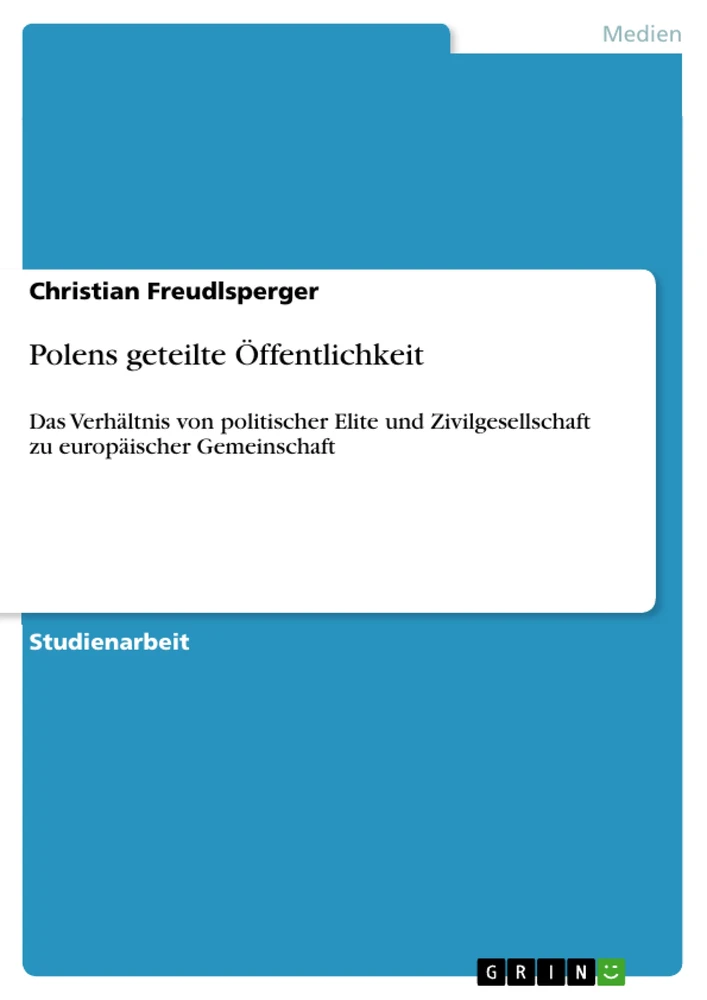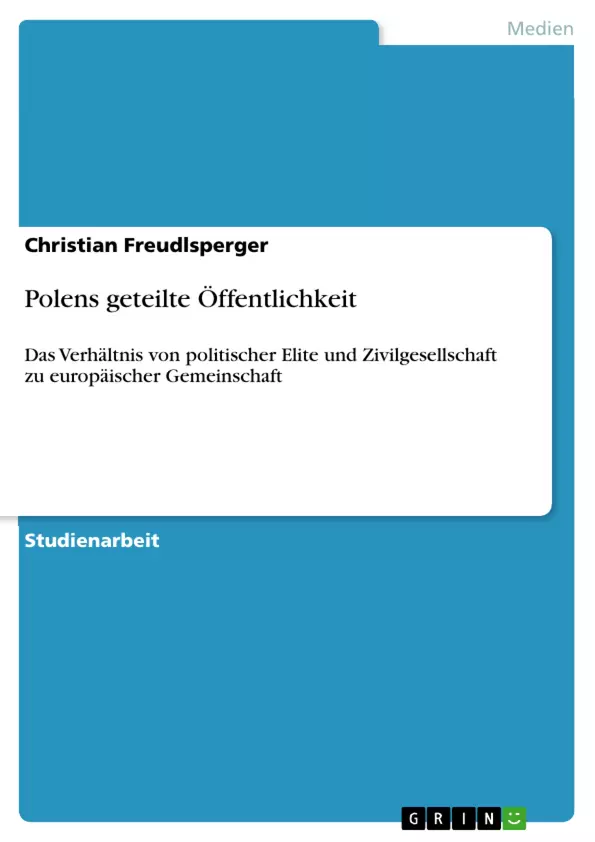Als im Jahr 2005 die national-soziale „Recht und Gerechtigkeit“ (PiS) an die Macht in Polens Sejm und Pałac Prezydencki gelangt, befürchtet man in Mittel- und Westeuropa einen „Eurosceptic backlash“. Die Regierungsparteien seien schließlich zum Teil schon 2003 gegen den EU-Beitritt des Landes gewesen, im EU-Parlament im Rahmen der „Union für das Europa der Nationen“ organisiert, und hätten sich darüber hinaus im Wahlkampf 2005 nicht gerade mit Forderungen nach einer „Vertiefung“ der europäischen Integration hervorgetan. Hatte man es in Polen mit einem neuen „Awkward Partner“ der EU zu tun?
In stetem Gegensatz zu dieser durchaus verbreiteten Ansicht scheint jedoch seit jeher die breite Zustimmung der polnischen Bevölkerung zu Europa generell, dem EU-Beitritt sowie dem europäischen Verfassungsvertrag im Speziellen, zu stehen. Ein vitales Interesse für gemeinsam Europäisches, ebenso wie dessen identitäre Verankerung, scheint in der polnischen Bevölkerung demnach weitaus tiefer zu liegen als innerhalb der sie vertretenden politischen Eliten. Wie passt dies zusammen? Besitzt Polen eine „geteilte Öffentlichkeit“, was die Kommunikation und die Perzeption von europäischer Gemeinschaft in Zivilgesellschaft und Politik angeht? Dieser Fragestellung möchte sich folgende Arbeit anhand einer Analyse dessen widmen, wie europäische Gemeinschaft in Polen kommuniziert und bewertet wird und welche Rolle dabei die Konstruktion nationaler Identität spielt. Die Kampagne zum EU-Beitritt Polens im Jahr 2003 sowie die polnische Debatte zum EU-Verfassungsvertrag in den Jahren 2004 – 2006 sollen dabei als Untersuchungsobjekte dienen.
Inhaltsverzeichnis
- Polen der „Awkward Partner\" der EU.
- Das Konstrukt europäischer Gemeinschaft.
- Die Bedeutung europäischer Identität.
- Prozessperspektive von Identität
- Die Grundlagen polnischer Identität.
- Das „Land des Freiheitskampfes“.
- Das Verhältnis von polnischer zu europäischer Identität.
- Fallbeispiel: Der Beitritt Polens zur EU im Jahr 2004
- Gezielte Identitätspolitik durch Beitritts-Kampagnen.
- Die polnische Zivilgesellschaft und ihre positive Haltung zum EU-Beitritt
- Fallbeispiel: die polnische Debatte zum Verfassungsvertrag der EU
- Die Nicht-Beachtung der Thematik durch die polnische Parteipolitik.
- Die Haltung der polnischen Bevölkerung zum Verfassungsvertrag
- Polens „geteilte Öffentlichkeit“ und die einsetzende Phase der „Normalisierung“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Kommunikation und Bewertung europäischer Gemeinschaft in Polen, insbesondere die Rolle der Konstruktion nationaler Identität. Dabei werden der Beitritt Polens zur EU im Jahr 2003 und die polnische Debatte zum EU-Verfassungsvertrag in den Jahren 2004 - 2006 als Fallbeispiele betrachtet.
- Das Konstrukt europäischer Gemeinschaft und die Bedeutung europäischer Identität.
- Die Grundlagen polnischer Identität, insbesondere das "Land des Freiheitskampfes" und die Beziehung zu europäischer Identität.
- Die Rolle von Zivilgesellschaft und politischer Elite in der Kommunikation und Perzeption von europäischer Gemeinschaft.
- Die Analyse von Identitätsdiskursen in medialen und politischen Kampagnen.
- Die Untersuchung von "geteilter Öffentlichkeit" in Bezug auf die europäische Integration Polens.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die kontroverse Rolle Polens in der Europäischen Union und die Frage nach dessen „Passform" im europäischen Kontext. Die Rolle Polens im Irak-Krieg sowie die politischen Einstellungen der Regierungsparteien im Hinblick auf die europäische Integration werden beleuchtet.
Im zweiten Kapitel wird das Konstrukt europäischer Gemeinschaft analysiert. Die Bedeutung europäischer Identität und ihre Rolle in der Integration und Legitimation der Europäischen Union werden diskutiert. Der Prozessperspektive von Identität wird dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt, wobei die Rolle von Medien, politischer Elite und Zivilgesellschaft hervorgehoben wird.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den Grundlagen polnischer Identität. Die Bedeutung der Verfassungstradition, die Rolle des katholischen Glaubens und das Bild des "Landes des Freiheitskampfes" werden beleuchtet. Das Verhältnis von polnischer und europäischer Identität wird ebenfalls analysiert.
Das vierte Kapitel untersucht den Beitritt Polens zur EU im Jahr 2004 als Fallbeispiel. Die gezielte Identitätspolitik durch Beitritts-Kampagnen und die positive Haltung der polnischen Zivilgesellschaft zum EU-Beitritt werden untersucht.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit der polnischen Debatte zum EU-Verfassungsvertrag in den Jahren 2004 - 2006. Die Nicht-Beachtung der Thematik durch die polnische Parteipolitik und die Haltung der polnischen Bevölkerung zum Verfassungsvertrag werden analysiert.
Schlüsselwörter
Europäische Gemeinschaft, europäische Identität, nationale Identität, Polen, EU-Beitritt, Verfassungsvertrag, Zivilgesellschaft, politische Elite, Medien, „Awkward Partner\", „geteilte Öffentlichkeit\", Identitätspolitik, Diskursanalyse, Salience, Frames, Involvement.
- Citar trabajo
- Christian Freudlsperger (Autor), 2011, Polens geteilte Öffentlichkeit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180047