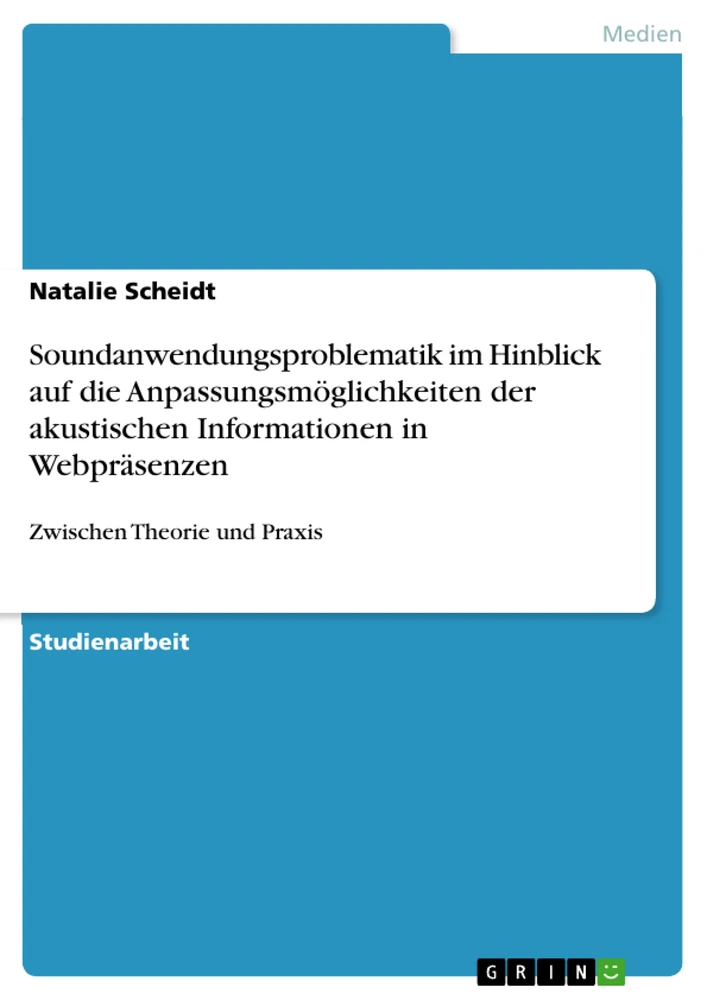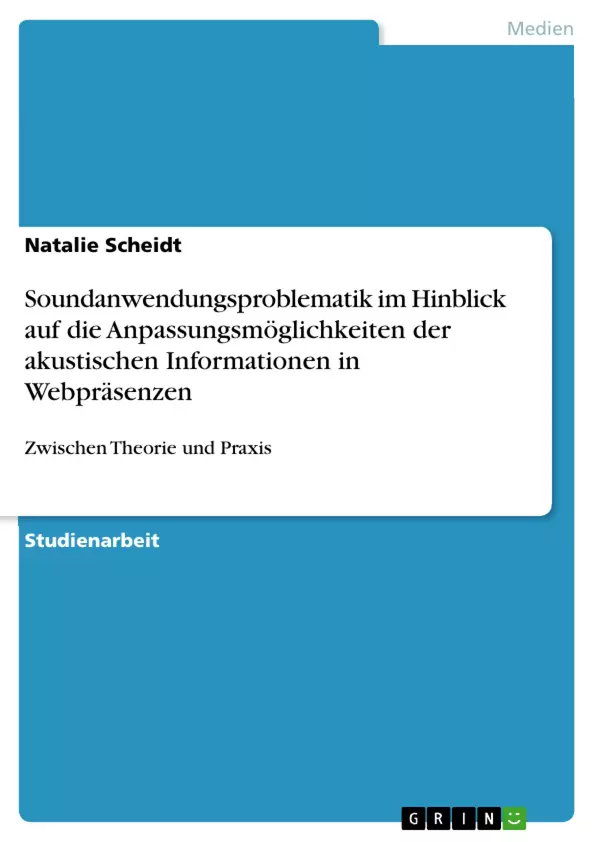Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
1.1 Ausgangsfragestellung
1.2 Untersuchungsgegenstand und Erkenntnisinteresse
2. Moderne neurowissenschaftliche Erkenntnisse:
Sound- und Musikeinfluss
2.1 Vom Gehör zum Gehirn
2.2 Einfluss und Wirkung von Sounds und Musik auf kognitive Prozesse
2.3 Zusammenfassung der positiven und negativen Merkmale
des Sound- und Musikeinflusses
3. Nutzeraktivitäten und Soundeinsatz im Internet
3.1 Aktivitäten im Netz
3.2 Interessen und Motive
3.3 Problematik des Soundeinsatzes in den Webpräsenzen
4. Validierung der Interpretationsergebnisse im Hinblick auf die
Anwendungsanpassungen
5. Zusammenfassung
Quellenverzeichnis
1.2 Untersuchungsgegenstand und Erkenntnisinteresse
Im Hinblick auf die oben angeführte ablehnende Haltung der Internet-User erscheinen die Fragen nach deren Ursachen sowie die Erforschung und Optimierung des Einsatzes von soundbasierten Informationsdaten im Web und nach den sinngemäßen, effektiven und vor allem nutzerorientierten Anwendungsmöglichkeiten der auditiven Informationen wissenschaftlich sehr interessant. Nach Auffassung des Wissenschaftsrates in Bezug auf Empfehlungen zur digitalen Informationsversorgung ist es
[…] offensichtlich, daß für eine effektive Nutzung der erweiterten Kommunikations- und Publikationsmöglichkeiten auch neuartige Formen der Informationsbereitstellung und
-bewertung sowie Veränderungen der gegenwärtig vorhandenen Informationsinfrastrukturen erforderlich sind.
In diesem Zusammenhang beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit dem Problem des nutzerorientierten Einsatzes von auditiven Informationen im Internet, seien sie für die begleitenden Zwecke des Visuellen oder auch als primäre Informationsquelle eingesetzt. Das Ziel dieser Arbeit ist es, falls möglich, die Optimierungsvorschläge für die effiziente, leistungsfördernde und für den Nutzer zufriedenstellende Informationsaufnahme mit Hilfe von Sounds induktiv herauszuarbeiten.
Vorab sei darauf hingewiesen, dass die technischen Aspekte der Sound-Produktion und Bereitstellung im Web im Rahmen dieser Arbeit nicht näher betrachtet werden sollen. Es geht vielmehr darum, die theoretischen Grundlagen für Webentwickler basierend auf den Erkenntnissen der neurobiologischen Forschung (Veröffentlichung von Lutz Jänke "Macht Musik glücklich?") darzulegen, und zu analysieren, wo Anpassungen vorgenommen werden können, um ein einheitliches Modell des Soundeinsatzes im Web zu gewährleisten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ausgangsfragestellung
- Untersuchungsgegenstand und Erkenntnisinteresse
- Moderne neurowissenschaftliche Erkenntnisse: Sound- und Musikeinfluss
- Vom Gehör zum Gehirn
- Einfluss und Wirkung von Sounds und Musik auf kognitive Prozesse
- Zusammenfassung der positiven und negativen Merkmale des Sound- und Musikeinflusses
- Nutzeraktivitäten und Soundeinsatz im Internet
- Aktivitäten im Netz
- Interessen und Motive
- Problematik des Soundeinsatzes in den Webpräsenzen
- Validierung der Interpretationsergebnisse im Hinblick auf die Anwendungsanpassungen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Problematik des Soundeinsatzes in Webpräsenzen und untersucht die Möglichkeiten zur Anpassung von akustischen Informationen für eine nutzerorientierte Informationsverarbeitung im Internet.
- Der Einfluss von Sounds und Musik auf das menschliche Gehirn und die kognitiven Prozesse.
- Die Rolle von Sounds im Kontext von Internet-Nutzung, Nutzeraktivitäten und Nutzungsmotiven.
- Die Herausforderungen des Soundeinsatzes in Webpräsenzen und die Optimierungsmöglichkeiten für eine effiziente und nutzerfreundliche Informationsaufnahme.
- Die Validierung von Interpretationsergebnissen im Hinblick auf die Anwendungsrelevanz und Anpassungsmöglichkeiten.
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung
- Das digitale Zeitalter und die Revolutionierung von Informations- und Wissensprozessen.
- Die Bedeutung von Sounds als strukturierte Datenmengen in der digitalen Welt.
- Die Herausforderungen der Informationsverarbeitung in der Informationsflut des Internets.
- Die Notwendigkeit von Kontext und angemessener Informationsnutzung für die Wissensbildung.
- Die Problematik des Soundeinsatzes in Webpräsenzen und die ablehnende Haltung vieler Internet-User.
- Die wissenschaftliche Relevanz der Erforschung und Optimierung des Einsatzes von Soundbasierten Informationen im Web.
- Kapitel 2: Moderne neurowissenschaftliche Erkenntnisse: Sound- und Musikeinfluss auf das Gehirn
- Die Funktionsweise des menschlichen Gehörs und die Weiterleitung auditiver Informationen zum Gehirn.
- Die enge Verbindung zwischen kognitiven Prozessen und der Verarbeitung auditiver Informationen im Gehirn.
- Die positiven und negativen Auswirkungen von Musik auf die kognitiven Informations- und Kommunikationsverarbeitungsprozesse.
- Kapitel 3: Nutzeraktivitäten und Soundeinsatz im Internet
- Die Untersuchung von Nutzeraktivitäten und Nutzungsmotiven im Internet.
- Die Analyse des aktuellen Stands der praktischen Internetnutzung von auditiven Informationen.
- Die Problematik des Soundeinsatzes in Webpräsenzen aus der Sicht der Nutzer.
Schlüsselwörter
Soundanwendung, Webpräsenzen, akustische Informationen, Nutzerorientierung, Informationsverarbeitung, Neurowissenschaften, Sound- und Musikeinfluss, kognitive Prozesse, Internet-Nutzung, Nutzeraktivitäten, Anwendungsrelevanz, Anpassungsmöglichkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Sound auf Websites oft als störend empfunden?
Viele Nutzer empfinden ungefragten Sound als Eingriff in ihre Privatsphäre oder als Ablenkung von der eigentlichen Informationssuche, besonders wenn der Sound nicht deaktivierbar ist.
Welchen Einfluss hat Musik auf kognitive Prozesse?
Neurowissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass Musik Emotionen wecken und die Aufmerksamkeit steuern kann, aber bei falscher Anwendung die Konzentration und Informationsaufnahme stört.
Was ist „nutzerorientierter“ Soundeinsatz?
Das bedeutet, dass auditive Informationen nur dann eingesetzt werden, wenn sie dem Nutzer einen Mehrwert bieten, und dass der Nutzer die volle Kontrolle über die Audiowiedergabe hat.
Wie gelangen auditive Reize vom Gehör zum Gehirn?
Schallwellen werden im Ohr in elektrische Impulse umgewandelt und über den Hörnerv an das Gehirn weitergeleitet, wo sie in verschiedenen Arealen (z. B. für Rhythmus oder Emotionen) verarbeitet werden.
Können Sounds die Wissensbildung im Internet fördern?
Ja, wenn sie als ergänzende Informationsquelle sinnvoll in den Kontext eingebettet sind, können sie das Verständnis komplexer Inhalte unterstützen.
- Arbeit zitieren
- Natalie Scheidt (Autor:in), 2010, Soundanwendungsproblematik im Hinblick auf die Anpassungsmöglichkeiten der akustischen Informationen in Webpräsenzen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180333