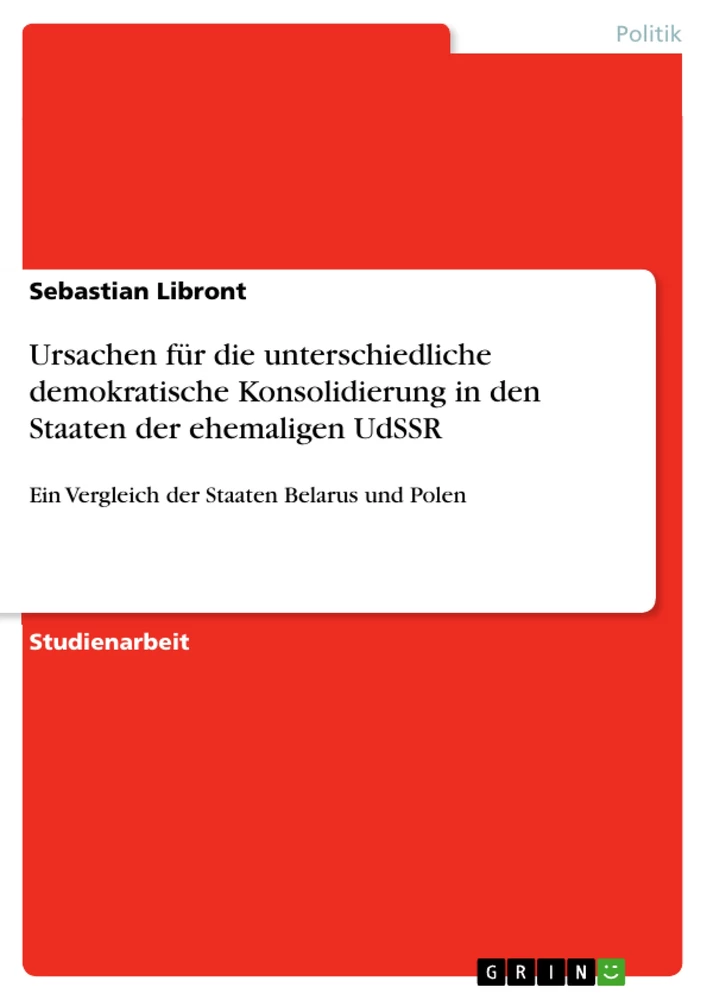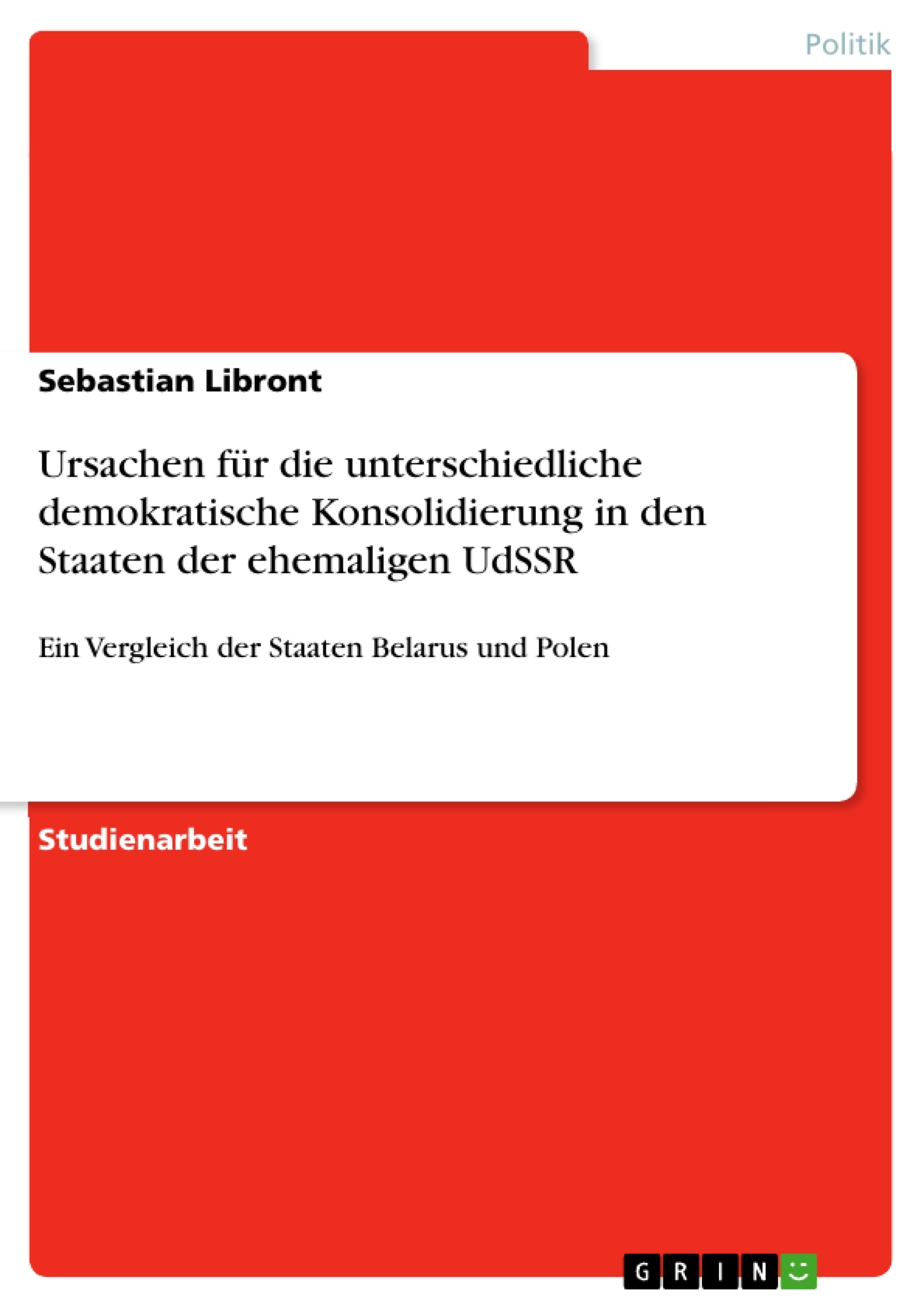Fachbereich Politik - Internationale Politik - Region: Russland, Länder der ehemal. Sowjetunion, Note: 1,0, -, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Hausarbeit eignet sich ideal als Muster für alle, die einen gelungenen Vergleich nach dem most-similar-case-design für Ihre Hausarbeit suchen.Im Verlauf dieser Arbeit werden zunächst die Methodik und die Kriterien der Fallauswahl erläutert, bevor dann im zweiten Kapitel die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit beleuchtet werden. Dort werden auch die Hypothesen dieser Arbeit abgeleitet und die Operationalisierung der Variabeln durchgeführt. Im dritten Kapitel folgt dann der eigentliche Vergleich den beiden Staaten Länder Belarus und Polen und die Vergleichszusammenfassung. Im vierten Kapitel erfolgt schließlich die Schlussbetrachtung der gewonnen Erkenntnisse.
Inhaltsverzeichnis
- Einfihrung
- Methodik und die Kriterien der Fallauswahl
- Bestimmung der Variablen und der Indikatoren
- Theoretischer Teil
- Theorienpluralismus
- Hypothesenbildung
- Empirischer Teil
- Belarus
- Polen
- Zusammenfassung und Uberpriifung der Hypothese
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der unterschiedlichen demokratischen Konsolidierung in den Staaten der ehemaligen UdSSR, insbesondere im Vergleich von Belarus und Polen. Ziel ist es, einen kausalen Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen und politischen Faktoren und dem unterschiedlichen Stand im Transformationsprozess der Nachfolgestaaten der Sowjetunion zu untersuchen.
- Nationale Identitat als Faktor fur den Transformationserfolg
- Der Umfang des Elitenwechsels als Einflussfaktor
- Der internationale Kontext als Determinante des Transformationsprozesses
- Die Bedeutung von historischen Erfahrungen und Erinnerungen
- Die Rolle der Zivilgesellschaft in der Demokratisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die Methodik und die Kriterien der Fallauswahl. Im theoretischen Teil werden verschiedene Theorien zur Demokratieforschung und Transformationsforschung vorgestellt, um die Hypothesen der Arbeit abzuleiten. Der empirische Teil analysiert die beiden Fallstudien Belarus und Polen, um die Hypothesen zu überprüfen. Die Schlussbetrachtung fasst die gewonnenen Erkenntnisse zusammen und leitet eine generalisierende Hypothese ab.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die demokratische Konsolidierung, den Transformationsprozess, die ehemalige UdSSR, Belarus, Polen, nationale Identitat, Elitenwechsel, internationaler Kontext, Zivilgesellschaft, Demokratieforschung, Transformationsforschung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Ursachen für die unterschiedliche demokratische Konsolidierung in den Nachfolgestaaten der UdSSR, beispielhaft am Vergleich zwischen Belarus und Polen.
Welches Forschungsdesign wird in der Arbeit verwendet?
Es wird ein Vergleich nach dem "most-similar-case-design" angewendet, um kausale Zusammenhänge im Transformationsprozess zu identifizieren.
Welche Faktoren beeinflussen den Erfolg der Demokratisierung laut Text?
Zu den zentralen Faktoren gehören die nationale Identität, der Umfang des Elitenwechsels, der internationale Kontext sowie historische Erfahrungen und die Rolle der Zivilgesellschaft.
Welche Länder werden im empirischen Teil verglichen?
Der empirische Teil der Arbeit konzentriert sich auf eine detaillierte Analyse und den Vergleich von Belarus und Polen.
An wen richtet sich diese Hausarbeit besonders?
Sie eignet sich ideal als Muster für Studierende der Politikwissenschaft, die einen gelungenen Vergleich nach dem most-similar-case-design suchen.
- Quote paper
- Sebastian Libront (Author), 2011, Ursachen für die unterschiedliche demokratische Konsolidierung in den Staaten der ehemaligen UdSSR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180778