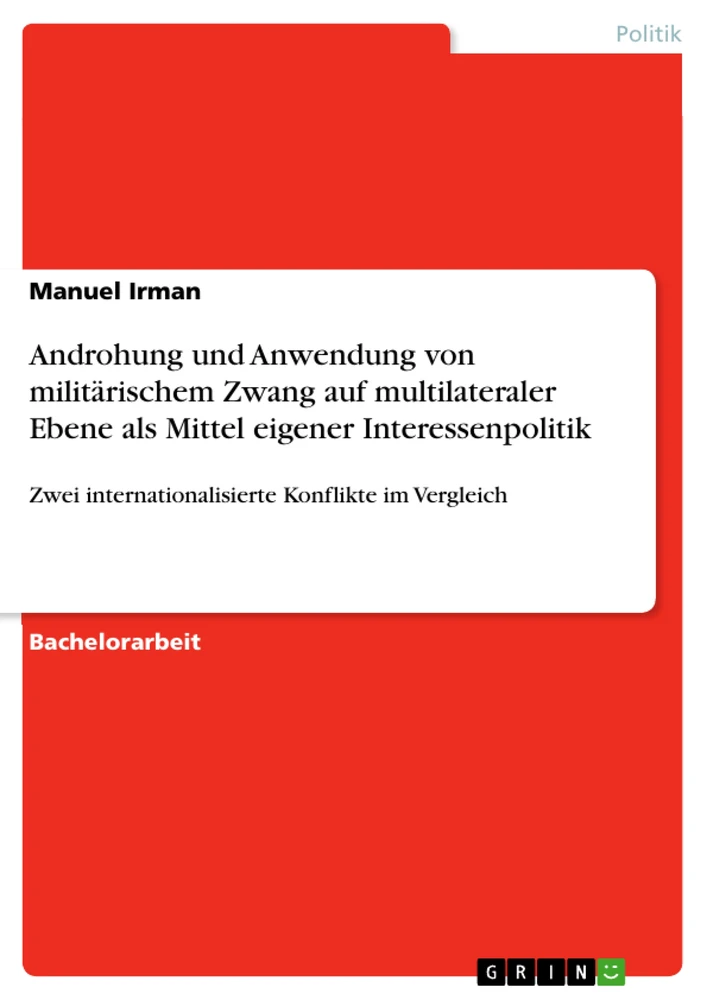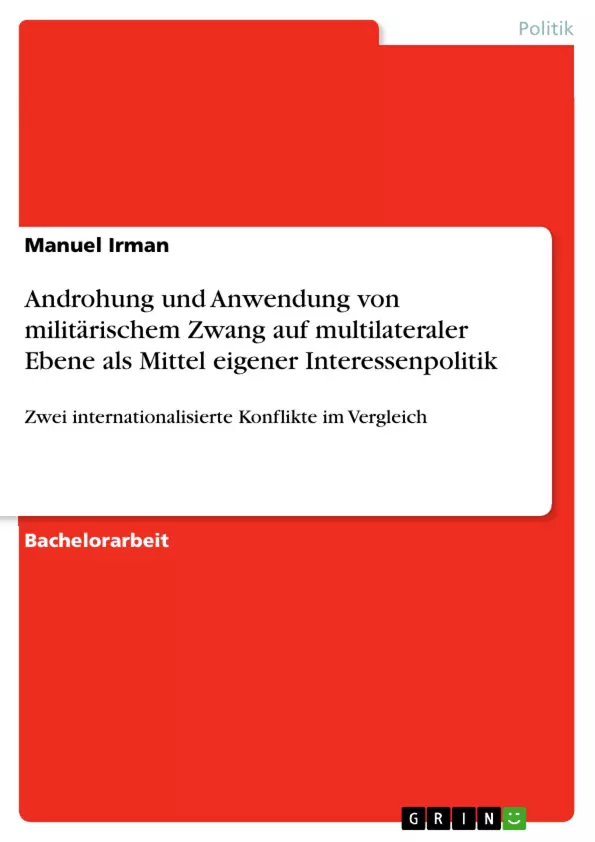Die Androhung von militärischem Zwang zur Durchsetzung eigener Interessen fand nach dem Ende des Kalten Krieges als eine moderne Art von Kanonenbootpolitik vermehrt Anwendung. Der Zusammenschluss gleichgesinnter Staaten und die für ein erfolgreiches Vorgehen nötige Eskalationsdominanz sind dabei zentrale Merkmale. Militärische Zwangsandrohung ist aber nur dann ein erfolgreiches politisches Instrument, wenn der Konflikt gelöst werden kann, ohne dass die angedrohten Massnahmen je angewandt werden mussten. Zwei prominente Konflikte, in welchen die USA nach dem Ende des Kalten Krieges eigene aussenpolitische Interessen auf an-deren Kontinenten mittels Zwangsandrohung durchzusetzen versuchte, waren der Zweite Golfkrieg und der Kosovo-Konflikt. Die Resultate dieser hier untersuchten Konflikte legen jedoch den Schluss nahe, dass die Androhung von militärischem Zwang eine weitere Eskalation nicht verhindern kann und es schliesslich doch zum bewaffneten Konflikt zwischen den widerstreitenden Parteien kommt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorie
- Zwei Analysemodelle
- Eine Theorie der Zwangsandrohung
- Zwang durch Internationale Organisationen
- Forschungsstand
- Hypothesen und Variablen
- Zwei Analysemodelle
- Fallanalyse
- Der Zweite Golfkrieg
- Irakische Interessen in Kuwait
- Interessen der USA im Nahen Osten
- Eskalationskapazität der Konfliktparteien
- Gewünschter Policy-Outcome der USA und der Koalition
- Zentrale Merkmale der Konfliktlösung
- Die Rolle der UNO
- Der Kosovo-Konflikt
- Jugoslawisch-serbische Interessen im Kosovo
- Interessen der USA auf dem Westbalkan
- Eskalationskapazität der Konfliktparteien
- Gewünschter Policy-Outcome der internationalen Staatengemeinschaft
- Zentrale Merkmale der Konfliktlösung
- Die Rollen der UNO, der OSCE und der NATO
- Der Zweite Golfkrieg
- Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit befasst sich mit der Androhung und Anwendung von militärischem Zwang auf multilateraler Ebene als Mittel eigener Interessenpolitik. Die Arbeit untersucht, wie erfolgreich die Androhung von militärischem Zwang ist, um eigene politische Interessen durchzusetzen und welche Organisationsformen Staaten zu diesem Zweck bilden.
- Die Theorie des Zwangs und die Rolle von Eskalationsdominanz
- Der Einsatz von Zwang durch Internationale Organisationen
- Die Analyse des Zweiten Golfkriegs und des Kosovo-Konflikts als Fallbeispiele
- Die Interessen der beteiligten Akteure und deren Eskalationskapazität
- Die Rolle der UNO, NATO und OSCE in den Konflikten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Zwangsandrohung auf multilateraler Ebene ein und stellt die Forschungsfrage nach der Effektivität von militärischem Zwang zur Durchsetzung eigener Interessen. Sie erläutert die Bedeutung von Eskalationsdominanz und die Rolle von internationalen Organisationen. Das Kapitel "Theorie" präsentiert zwei Analysemodelle, die für die Untersuchung verwendet werden: die Theory of coercion und die Eskalationstheorie von Kahn. Es werden zudem wichtige Forschungsfragen und Hypothesen vorgestellt.
Die Fallanalyse behandelt den Zweiten Golfkrieg und den Kosovo-Konflikt. Es werden die Interessen der Konfliktparteien, die Eskalationskapazität und die gewünschte Konfliktlösung analysiert. Die Rolle der UNO, NATO und OSCE in den Konflikten wird ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Global Governance, Zwang, Multilateralismus, Eskalationsdominanz, aussenpolitische Interessen, USA, UNO, NATO, Zweiter Golfkrieg und Kosovo-Konflikt. Die Kernthemen der Arbeit sind die Analyse von militärischem Zwang als Mittel zur Durchsetzung eigener Interessen und die Untersuchung der Effizienz von Zwangsandrohungen auf multilateraler Ebene.
Häufig gestellte Fragen
Was wird unter militärischer Zwangsandrohung in der Arbeit verstanden?
Militärische Zwangsandrohung wird als ein politisches Instrument betrachtet, bei dem Staaten versuchen, eigene Interessen durchzusetzen, indem sie mit Gewalt drohen, ohne diese idealerweise anwenden zu müssen.
Wann gilt die Androhung von Gewalt als erfolgreich?
Ein Erfolg liegt vor, wenn der Konflikt im Sinne der eigenen Interessen gelöst werden kann, ohne dass die angedrohten militärischen Maßnahmen tatsächlich durchgeführt werden müssen.
Welche historischen Konflikte werden als Fallbeispiele analysiert?
Die Arbeit analysiert den Zweiten Golfkrieg und den Kosovo-Konflikt, um die Effektivität von Zwangsandrohungen durch die USA und internationale Koalitionen zu untersuchen.
Was ist „Eskalationsdominanz“?
Eskalationsdominanz beschreibt die Fähigkeit einer Partei, jede Stufe der Gewaltanwendung so zu kontrollieren oder zu übertreffen, dass der Gegner zur Nachgiebigkeit gezwungen wird.
Welche Rolle spielen Organisationen wie die UNO oder die NATO?
Die Arbeit beleuchtet, wie Staaten Zwang auf multilateraler Ebene durch internationale Organisationen ausüben und welche legitimatorische oder operative Rolle diese in Konflikten spielen.
Zu welchem Schluss kommt die Arbeit bezüglich der Wirksamkeit von Drohungen?
Die untersuchten Fälle legen nahe, dass die bloße Androhung oft eine weitere Eskalation nicht verhindern kann und es letztlich doch häufig zum bewaffneten Konflikt kommt.
- Quote paper
- M.A. Manuel Irman (Author), 2009, Androhung und Anwendung von militärischem Zwang auf multilateraler Ebene als Mittel eigener Interessenpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180917