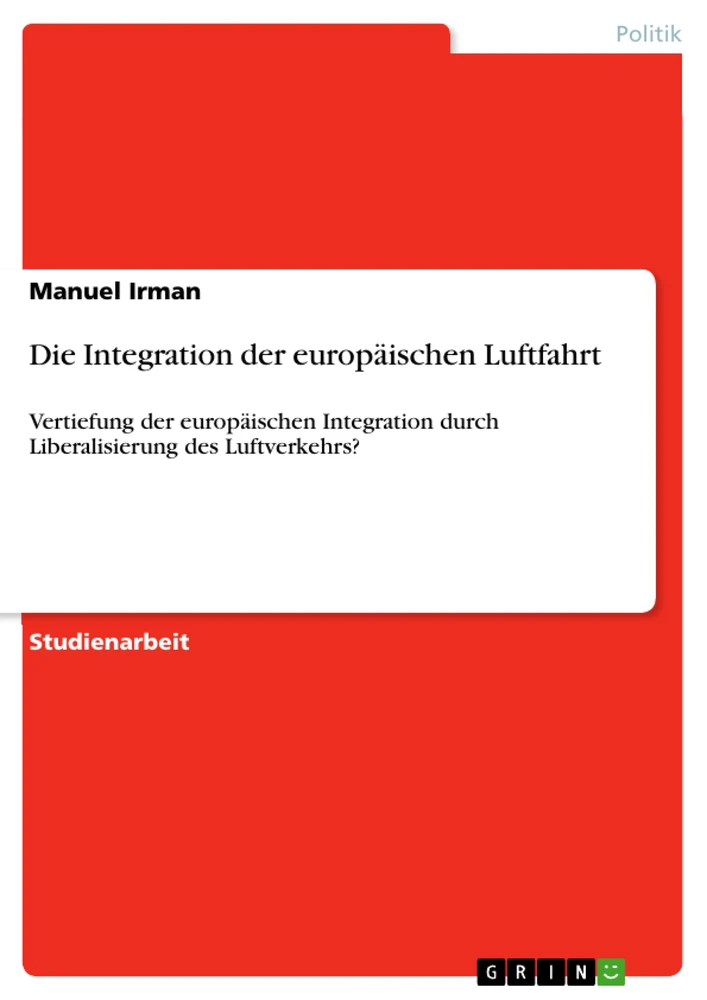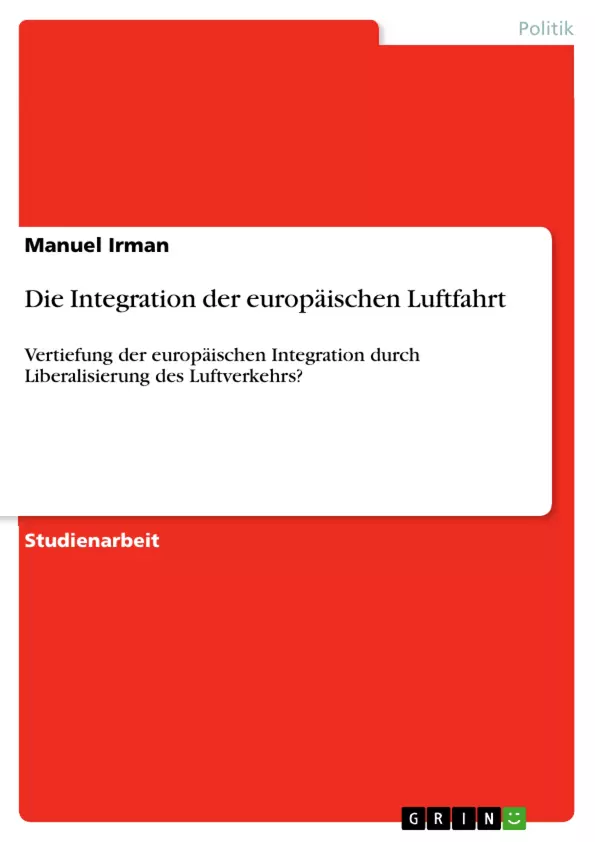Im Gegensatz zu anderen Wirtschaftszweigen ging die Marktliberalisierung der Luftfahrt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eher schleppend voran. Von Interesse ist deshalb inwiefern der Luftverkehrsmarkt zur europäischen Integration beitrug und wie sich dies mittels der Integrationstheorien des Neofunktionalismus und des Intergouvernementalismus erklären lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Integrationstheorien
- Neofunktionalismus
- Intergouvernementalismus
- Der Europäische Luftverkehrsmarkt
- Entwicklungen vom Chicagoer Abkommen bis zur ersten EG-Erweiterung
- Liberalisierung des US-Luftverkehrsmarktes und deren Folgen für die EG
- Politics in der EG auf dem Weg zur achten Freiheit der Luft
- Schlussfolgerungen
- Bibliographie
- Anhang
- Die acht Freiheiten der Luft
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Integration der europäischen Luftfahrt und analysiert, inwiefern die Liberalisierung des Luftverkehrs zu einer Vertiefung der europäischen Integration beigetragen hat. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Ende des 20. Jahrhunderts.
- Die Rolle des Chicagoer Abkommens und der Entwicklung der internationalen Luftfahrt
- Die Auswirkungen der Liberalisierung des US-Luftverkehrsmarktes auf die Europäische Gemeinschaft
- Die Bedeutung der „achten Freiheit der Luft“ (Kabotage) für die europäische Integration
- Die Anwendung von Integrationstheorien (Neofunktionalismus und Intergouvernementalismus) zur Analyse der Integrationsprozesse
- Die politische und wirtschaftliche Bedeutung der Luftfahrt für den europäischen Integrationsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit führt in das Thema der europäischen Luftfahrtintegration ein und stellt die Fragestellung dar: Inwiefern trug die Liberalisierung der Luftfahrt zu einer Vertiefung der europäischen Integration bei? Die Einleitung beleuchtet den Weg von der ersten Freiheit der Luft bis zur Kabotage und skizziert den historischen Kontext.
- Integrationstheorien: Dieses Kapitel erläutert die wichtigsten Integrationstheorien, insbesondere den Neofunktionalismus und den Intergouvernementalismus. Es definiert relevante Begriffe und analysiert die theoretischen Grundlagen der Arbeit.
- Der Europäische Luftverkehrsmarkt: Dieser Abschnitt untersucht die Entwicklungen des europäischen Luftverkehrsmarktes, beginnend mit dem Chicagoer Abkommen und den frühen EG-Erweiterungen. Er analysiert die Liberalisierung des US-Luftverkehrsmarktes und deren Auswirkungen auf die EG sowie die politischen Prozesse, die zur achten Freiheit der Luft führten.
Schlüsselwörter
Schlüsselwörter, die den Fokus der Arbeit aufzeigen, sind: Europäische Integration, Luftverkehr, Liberalisierung, Deregulierung, Neofunktionalismus, Intergouvernementalismus, Chicagoer Abkommen, Kabotage, achte Freiheit der Luft, Politik, Wirtschaft, EU, EG.
Häufig gestellte Fragen
Wie trug die Luftfahrt zur europäischen Integration bei?
Die Arbeit analysiert, wie die schrittweise Liberalisierung und Deregulierung des Luftverkehrsmarktes die wirtschaftliche und politische Verflechtung in Europa vertieft hat.
Was besagt der Neofunktionalismus im Kontext der Luftfahrt?
Dieser theoretische Ansatz erklärt Integration als einen Prozess, bei dem die Zusammenarbeit in einem Bereich (Luftfahrt) zu „Spill-over“-Effekten in anderen Bereichen führt.
Was ist die „achte Freiheit der Luft“ (Kabotage)?
Kabotage bezeichnet das Recht einer Fluggesellschaft eines EU-Landes, Inlandsflüge in einem anderen EU-Land durchzuführen – ein Meilenstein der Marktliberalisierung.
Welchen Einfluss hatte das Chicagoer Abkommen?
Das Abkommen legte die Grundlagen für die internationale Luftfahrtordnung nach dem Zweiten Weltkrieg, auf denen die europäische Integration später aufbaute.
Wie beeinflusste der US-Luftverkehrsmarkt die EG?
Die Deregulierung des US-Marktes Ende der 1970er Jahre übte massiven wirtschaftlichen Druck auf die Europäische Gemeinschaft aus, ihren eigenen Markt ebenfalls zu öffnen.
- Quote paper
- M.A. Manuel Irman (Author), 2008, Die Integration der europäischen Luftfahrt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/180955