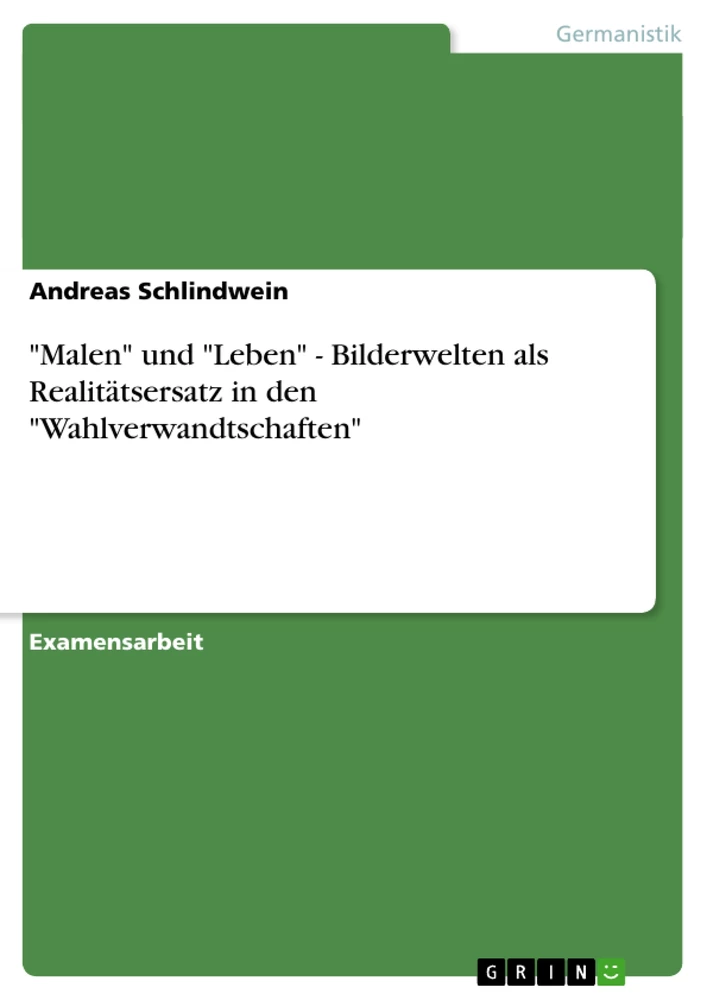Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, welche Funktion die zahlreichen Bilder in den "Wahlverwandtschaften" haben und welche Bedeutungsvalenzen diese Leitthematik hat.
Betrachtet werden im Einzelnen die "Tableaux vivants", die "Schriftbilder", die Ästhetisierung der Landschaft, Ottilies Selbstinszenierung sowie die Romansymbolik. Dabei fällt den Namen der Figuren sowie der Funktion des Wassers, vor allem der in der Forschungsliteratur vernachlässigten Mühle, besondere Aufmerksamkeit zu. Es wird aufgezeigt, dass alle Verbildlichungsprozesse auf unerfüllte Wünsche und Bedürfnisse der Figuren zurückzuführen sind, die ersatzweise auf der Bildebene erfüllt werden sollen.
- Quote paper
- Andreas Schlindwein (Author), 2010, "Malen" und "Leben" - Bilderwelten als Realitätsersatz in den "Wahlverwandtschaften", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181054