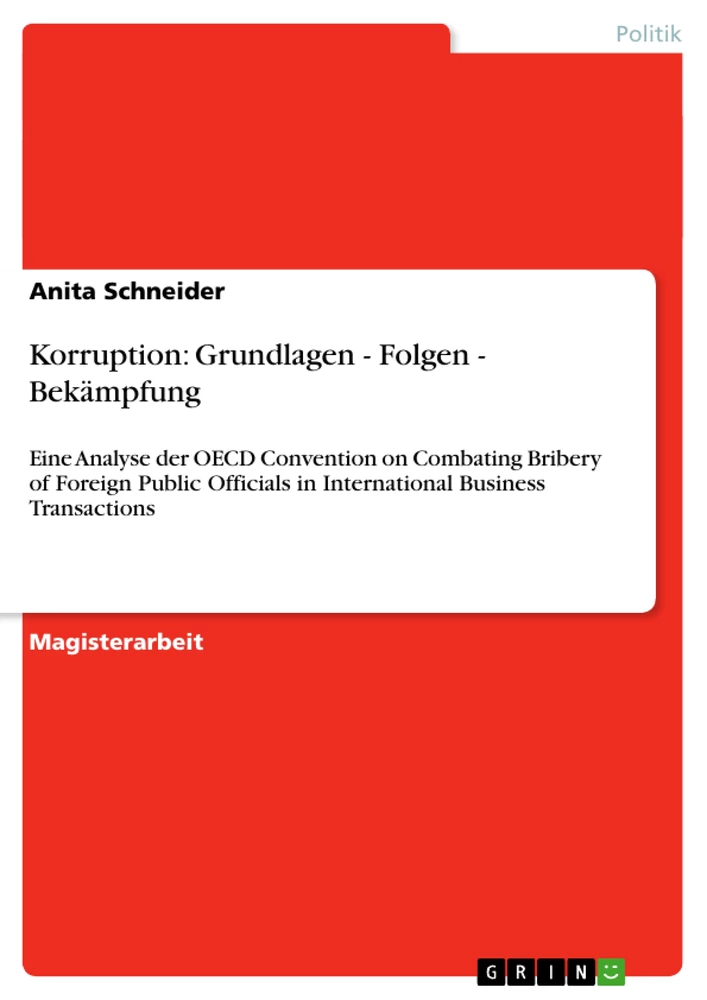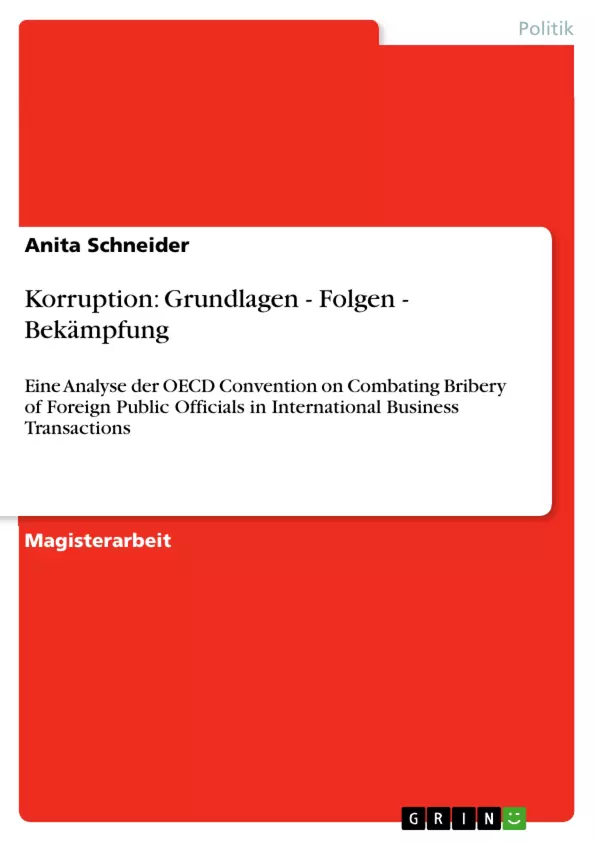Ist der Ehrliche der Dumme? Diese Frage stellt sich spätestens immer dann, wenn wieder ein neuer Fall von Korruption aufgedeckt wird. Verstärkte Aufmerksamkeit erzielt das Thema Korruption vor allem durch aufsehenserregende nationale und in-ternationale Korruptionsfälle wie die Flick-Affäre oder die Affäre im Siemens-Konzern gerückt. Neben aktuellen Nachrichten aus der Unternehmenswelt spielt das Thema Korruption in allerlei gesellschaftlichen Genre eine Rolle.
Mit der verstärkten Wahrnehmung von Korruption durch die Öffentlichkeit wurde der Druck auf die Staaten und zwischenstaatlichen Organisationen erhöht, sich vermehrt diesem Thema anzunehmen. Ein Beispiel für die globale Form der Kooperation zur Bekämpfung von Korruption und ihren Folgen ist die ‚United Nations Convention
against Corruption’ (UNCAC). Sie wurde zu Anfang des 21. Jahrhunderts von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York verabschiedet.
Die verschiedenen internationalen Abkommen und Kooperationen zur Bekämpfung von Korruption implizieren drei Annahmen. Zuerst bedeutet die Kooperation zur Be-kämpfung von Korruption, dass Korruption negative Aspekte aufweist, die bekämpft werden müssen. Gleichzeitig wird unterstellt, dass es möglich ist, Korruption zu bekämpfen und dass sich drittens für die Bekämpfung auch internationale Instrumente eignen. Die drei Annahmen werden im Laufe dieser Arbeit um eine weitere These ergänzt: Internationale Formen der Korruptionsbekämpfung sind dann erfolgreich, wenn ihnen das gemeinsame Interesse der Staaten zugrunde liegt. Die Grundlage der internationalen Kooperationen stellt nicht nur, im Gegensatz zur nationalen Korruptionsbekämpfung, die gemeinsamen moralischen und ethischen Grundlagen der Staaten dar. Internationale Formen der Zusammenarbeit bestehen neben der
UNCAC auch bei der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-lung (OECD) in Form der OECD Konvention zur Bekämpfung der Bestechung von ausländischen Beamten in internationalen Geschäftsbeziehungen (im Folgenden OECD Convention). Die Effektivität dieser OECD Convention bei der Bekämpfung von Korruption soll im Rahmen dieser Arbeit untersucht werden.
Korruption und korruptes Verhalten sind auf den kurzfristigen Erfolg und die Durchsetzung der individuellen Interessen ausgelegt. Um langfristig stabile Verhältnisse zu gewährleisten, ist das ‚westliche’ Sprichwort ‚ehrlich währt am Längsten’ auch auf den Umgang mit Korruption übertragbar.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Definition, Messung von Korruption und der Stand der Forschung
- 2.1 Definition und Unterscheidung von Formen der Korruption
- 2.1.1 Definition
- 2.1.2 Systematik von Korruption und ihre Erscheinungsformen
- 2.2 Die 'Messung' von Korruption und ein Überblick zum Stand der Forschung
- 3 Ursachen, Folgen und die Bekämpfung von Korruption
- 3.1 Politiktheoretisches und ökonomisches Verständnis von Korruption
- 3.2 Korruption und ihre Folgen
- 3.2.1 Korruption und die politische Ethik
- 3.2.2 Korruption und die Institutionen eines Staates
- 3.2.3 Korruption und Wachstum
- 3.2.4 Korruption und Ressourcenallokation
- 3.3 Prävention von und der Kampf gegen Korruption
- 4 Korruptionsbekämpfung auf globaler Ebene
- 4.1 Regimeanalyse: Entstehung, Legitimität und Effektivität von Regimen
- 4.1.1 Entstehung und Bedeutung von Regimen
- 4.1.2 Legitimität
- 4.1.3 Effektivität von Regimen
- 4.2 Die 'OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions'
- 4.2.1 Entstehung und Funktionsweise
- 4.2.2 Die Legitimität der OECD Convention
- 4.2.3 Die Effektivität der OECD Convention
- 4.3 Analyse der OECD Convention im Kontext
- 5 Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die OECD-Konvention zur Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr. Ziel ist es, die Konvention hinsichtlich ihrer Entstehung, Legitimität und Effektivität zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet verschiedene Facetten des Phänomens Korruption.
- Definition und Typologisierung von Korruption
- Ursachen und Folgen von Korruption (politisch, ökonomisch)
- Analyse von Korruptionsbekämpfungsmaßnahmen
- Regimeanalyse der OECD-Konvention
- Bewertung der Effektivität der OECD-Konvention
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Korruption ein und beschreibt den Forschungsstand sowie die Zielsetzung der Arbeit. Sie skizziert den Aufbau und die Methodik der Untersuchung der OECD-Konvention.
2 Definition, Messung von Korruption und der Stand der Forschung: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition von Korruption, differenziert zwischen verschiedenen Formen und beleuchtet bestehende Messmethoden. Es bietet einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand zum Thema Korruption und deren Erforschung.
3 Ursachen, Folgen und die Bekämpfung von Korruption: Dieser Abschnitt analysiert die Ursachen von Korruption aus politiktheoretischer und ökonomischer Perspektive. Es werden die weitreichenden Folgen von Korruption auf politische Ethik, staatliche Institutionen, Wirtschaftswachstum und Ressourcenallokation untersucht. Abschließend werden verschiedene Präventions- und Bekämpfungsstrategien diskutiert.
4 Korruptionsbekämpfung auf globaler Ebene: Dieses Kapitel widmet sich der Analyse der OECD-Konvention. Es untersucht die Entstehung, die Legitimität und die Effektivität des internationalen Abkommens im Kampf gegen Korruption. Der Kontext der Konvention wird eingeordnet und kritisch beleuchtet.
Schlüsselwörter
Korruption, OECD-Konvention, Bestechung, internationale Geschäftsbeziehungen, Regimeanalyse, Legitimität, Effektivität, Wirtschaftswachstum, Ressourcenallokation, politische Ethik, Institutionen.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: OECD-Konvention zur Korruptionsbekämpfung
Was ist der Gegenstand der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit analysiert die OECD-Konvention zur Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr. Der Fokus liegt auf der Entstehung, Legitimität und Effektivität dieses internationalen Abkommens im Kampf gegen Korruption.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Facetten des Phänomens Korruption, darunter Definition und Typologisierung, Ursachen und Folgen (politisch und ökonomisch), Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung und eine detaillierte Regimeanalyse der OECD-Konvention. Sie untersucht die Auswirkungen von Korruption auf politische Ethik, staatliche Institutionen, Wirtschaftswachstum und Ressourcenallokation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Definition und Messung von Korruption, Ursachen, Folgen und Bekämpfung von Korruption, Korruptionsbekämpfung auf globaler Ebene (mit Schwerpunkt auf der OECD-Konvention) und Zusammenfassung/Ausblick. Jedes Kapitel baut auf dem vorherigen auf und trägt zur umfassenden Analyse bei.
Was sind die zentralen Forschungsfragen der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die OECD-Konvention hinsichtlich ihrer Entstehung, Legitimität und Effektivität zu untersuchen. Dabei werden Fragen nach den Ursachen und Folgen von Korruption, der Wirksamkeit internationaler Abkommen und der Rolle staatlicher Institutionen beleuchtet.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet eine Kombination aus Literaturrecherche, Regimeanalyse und einer kritischen Bewertung der OECD-Konvention. Die Methodik wird in der Einleitung detailliert erläutert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Korruption, OECD-Konvention, Bestechung, internationale Geschäftsbeziehungen, Regimeanalyse, Legitimität, Effektivität, Wirtschaftswachstum, Ressourcenallokation, politische Ethik, Institutionen.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es in jedem Kapitel?
Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in das Thema, Forschungsstand und Zielsetzung der Arbeit. Kapitel 2 (Definition und Messung): Definition von Korruption, verschiedene Formen, Messmethoden und Forschungsüberblick. Kapitel 3 (Ursachen, Folgen und Bekämpfung): Ursachen aus politiktheoretischer und ökonomischer Sicht, Folgen für Politik, Institutionen, Wachstum und Ressourcenallokation, sowie Präventions- und Bekämpfungsstrategien. Kapitel 4 (Globale Korruptionsbekämpfung): Analyse der OECD-Konvention bezüglich Entstehung, Legitimität und Effektivität. Kapitel 5 (Zusammenfassung und Ausblick): Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, Politikberater, Studenten und alle, die sich mit den Themen Korruption, internationale Beziehungen und wirtschaftspolitische Regulierung beschäftigen.
- Citar trabajo
- Anita Schneider (Autor), 2007, Korruption: Grundlagen - Folgen - Bekämpfung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181280