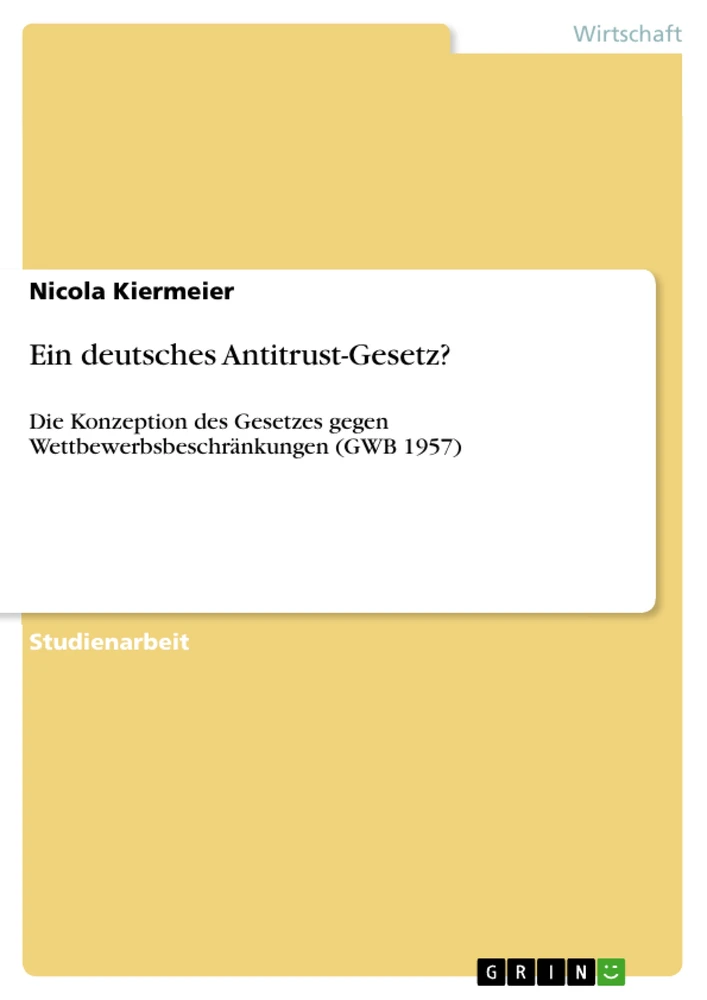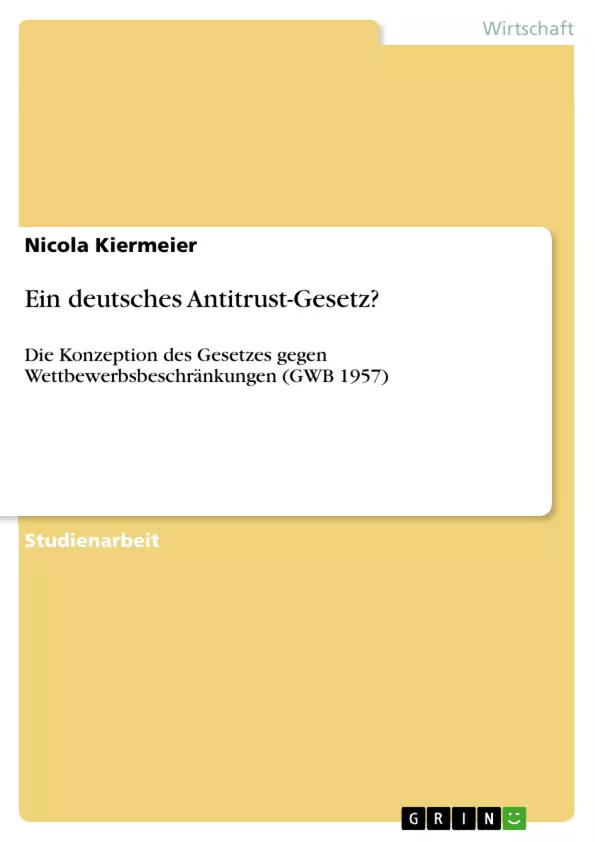„Der Kern der modernen Ethik muss die Freiheit sein: die Freiheit des Einzelnen, am globalen Spiel teilnehmen und sich aktiv verwirklichen zu können, und zwar nicht nur zum eigenen, sondern zum Nutzen aller.“ (Hans-Olaf Henkel)
In diesem Kontext stellt sich die Frage, wie frei unsere Marktwirtschaft wirklich ist und welche Rolle der Staat, als übergeordnete Institution, einnehmen muss. Wie frei sind die einzelnen Akteure im Wettbewerb und wie kann Freiheit langfristig gewährleistet werden? Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Kartellpolitik Deutschlands und wie stark ist der amerikanische Einfluss auf die deutsche Kartellpolitik in der Nachkriegszeit?
Diesen Fragen werde ich in der vorliegenden Arbeit am Beispiel des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 27. Juli 1957 (BGBl. 1957 I S.1081) nachgehen. Grundsätzlich wird die Dilemmastruktur, in der sich die Unternehmer befinden, die Informationsasymmetrie und das Kernproblem des Wettbewerbs aufgezeigt. Nachfolgend wird auf die historische Entstehungsgeschichte und die Konzeption des GWB eingegangen. Der Aufbau und die Gliederung des GWB werden deutlich herausgearbeitet und einige Kernparagraphen im Detail vorgestellt. Schließlich folgt die Abgrenzung des GWB gegenüber dem Antitrustgesetz der Vereinigten Staaten von Amerika. Abschließend werden die Ausnahmeregelungen, welche das grundsätzliche Verbot von wettbewerbsbeschränkenden Zusammenschlüssen abmildert, und die damit verbundene Handlungsfähigkeit des GWB hinterfragt.
Als Grundlage meiner Arbeit benutze ich das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen von 1957. Des Weiteren wird Literatur von Walter Eucken, als Begründer des Ordoliberalismus, von Buchheim, Isay, Kirschstein, Langen, Murach-Brand, Rauhut und Suchanek sowie einen Artikel von Hüttenberger in Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte von 1976 verwendet.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
- 1. Dilemmastrukturen und Wettbewerb als Kernproblem
- 2. Entstehungsgeschichte des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
- 3. Konzeption des GWB
- 3.1 Aufbau und Gliederung des GWB
- 3.2 Ausgewählte Kernparagraphen des GWB
- 3.3 Abgrenzungen des GWB zum Antitrustgesetz der USA
- 4. Ausnahmeregelungen (§§ 98- 103) und Analyse der Handlungsfähigkeit des GWB
- III Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) von 1957 und beleuchtet die Rolle des Staates in der Regulierung der deutschen Marktwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie befasst sich mit der Frage, wie frei die einzelnen Akteure im Wettbewerb sind und wie die Freiheit langfristig gewährleistet werden kann.
- Dilemmastrukturen und Informationsasymmetrien im Wettbewerb
- Entstehungsgeschichte und Konzeption des GWB
- Abgrenzung des GWB zum amerikanischen Antitrustgesetz
- Ausnahmeregelungen des GWB und die Handlungsfähigkeit der Kartellpolitik
- Der Einfluss des Ordoliberalismus auf die Gestaltung des GWB
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Relevanz der Frage nach der Freiheit der Marktwirtschaft in den Vordergrund. Sie verweist auf die Dilemmasituationen, die durch Informationsasymmetrien und divergente Interessen im Wettbewerb entstehen.
Kapitel II analysiert das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) anhand verschiedener Aspekte. Es behandelt die Dilemmastrukturen und das Kernproblem des Wettbewerbs, die Entstehungsgeschichte des GWB sowie die Konzeption des Gesetzes. Darüber hinaus werden Aufbau und Gliederung des GWB dargestellt und wichtige Kernparagraphen im Detail erläutert. Ein weiterer Fokus liegt auf der Abgrenzung des GWB zum amerikanischen Antitrustgesetz und der Analyse der Handlungsfähigkeit des GWB im Hinblick auf Ausnahmeregelungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen des Wettbewerbs, der Regulierung, der Kartellpolitik, dem Ordoliberalismus und der Gestaltung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) in der Nachkriegszeit. Die Arbeit analysiert die Rolle des Staates in der Marktwirtschaft und beleuchtet die Herausforderungen, die durch Informationsasymmetrien und divergente Interessen entstehen.
- Citation du texte
- B.A. Nicola Kiermeier (Auteur), 2010, Ein deutsches Antitrust-Gesetz?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181435