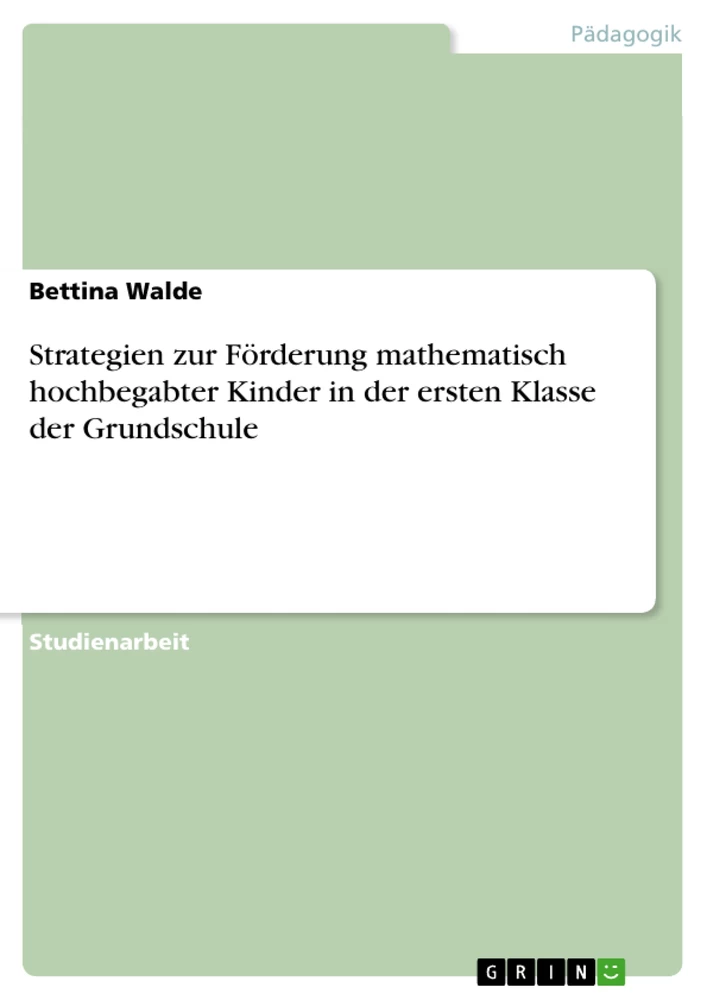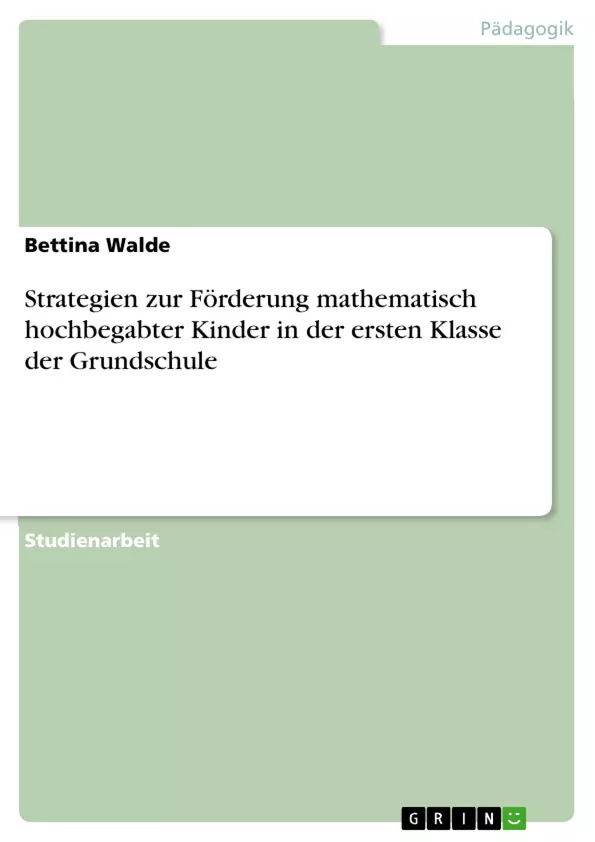Das Modul 2A des Studiengangs Bildungswissenschaft an der Fernuniversität
in Hagen beinhaltet das Thema "Methoden der empirischen Bildungsforschung".
Hierzu wird als Prüfungsleistung im Rahmen einer
Hausarbeit ein kleines Forschungsprojekt durchgeführt, welches der Einübung
empirischer Methoden dient und so der Forderung der Fachverbände
gerecht wird, eine an der Forschungspraxis orientierte Methodenausbildung
zu erhalten (http://babw.fernuni-hagen.de/studieninhalte/modul
-2a). (.....)
Die Geschichte der qualitativen Forschung hat sowohl in der Psychologie
als auch in den Sozialwissenschaften eine lange Tradition. Um 1900 -
1920 begann Wilhelm Wundt beschreibende Methoden zu verwenden und
etwa zeitgleich kam es auch in der deutschen Soziologie zu einer Erweiterung
der empirisch-statistischen Vorgehensweise durch induktive2 Forschungskonzepte
(vgl. Flick, 1999, S. 16). Aber erst ab Mitte der 80er Jahre
konnte die qualitative Sozialforschung trotz massiver Vorbehalte als
etabliert angesehen werden (vgl. Lamnek, 2005, S. 28). (....)
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Qualitative Sozialforschung
- Entwicklung der Forschungsfrage
- Hypothesenbildung
- Methodenwahl und Begründung
- Datenerhebung
- Feldzugang
- Interviewdurchführung und Transkription
- Datenauswertung, Textanalyse und Interpretation
- Ergebnis und Fazit
- Ausblick
- Literatur
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Förderung mathematisch hochbegabter Kinder in der ersten Klasse der Grundschule. Ziel ist es, die Herausforderungen und Möglichkeiten der Förderung dieser Kinder im Kontext der empirischen Bildungsforschung zu untersuchen. Die Arbeit verfolgt einen qualitativen Forschungsansatz und analysiert die Erfahrungen und Perspektiven von Lehrkräften und Eltern.
- Identifizierung von Bedürfnissen und Herausforderungen bei der Förderung mathematisch hochbegabter Kinder in der ersten Klasse
- Analyse von Fördermöglichkeiten und -strategien im schulischen Kontext
- Bewertung der Rolle von Lehrkräften und Eltern bei der Förderung mathematisch hochbegabter Kinder
- Entwicklung von Empfehlungen für die Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hochbegabtenförderung ein und erläutert die Relevanz der Forschungsarbeit. Sie beleuchtet die Chancenungleichheit in Bezug auf hochbegabte Kinder und die Notwendigkeit einer gezielten Förderung.
Das Kapitel "Qualitative Sozialforschung" beschreibt die Geschichte und die Prinzipien der qualitativen Forschung. Es werden die zentralen Merkmale und Vorteile dieses Forschungsansatzes im Vergleich zu quantitativen Methoden herausgestellt.
Das Kapitel "Methodenwahl und Begründung" erläutert die gewählte Forschungsmethode und die Gründe für ihre Auswahl. Es werden die spezifischen Vorteile der qualitativen Forschung für die Untersuchung der Thematik der Hochbegabtenförderung dargestellt.
Das Kapitel "Datenerhebung" beschreibt den Prozess der Datenerhebung, einschließlich des Feldzugangs und der Interviewdurchführung. Es werden die verwendeten Methoden und Instrumente zur Datenerhebung erläutert.
Das Kapitel "Datenauswertung, Textanalyse und Interpretation" erläutert die Methoden der Datenauswertung und Textanalyse. Es werden die Ergebnisse der Forschungsarbeit präsentiert und interpretiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Förderung mathematisch hochbegabter Kinder, die erste Klasse der Grundschule, qualitative Sozialforschung, Datenerhebung, Datenauswertung, Textanalyse, Interpretation, Ergebnisse, Fazit, Ausblick. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Möglichkeiten der Förderung mathematisch hochbegabter Kinder im Kontext der empirischen Bildungsforschung.
- Quote paper
- Bettina Walde (Author), 2011, Strategien zur Förderung mathematisch hochbegabter Kinder in der ersten Klasse der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/181740