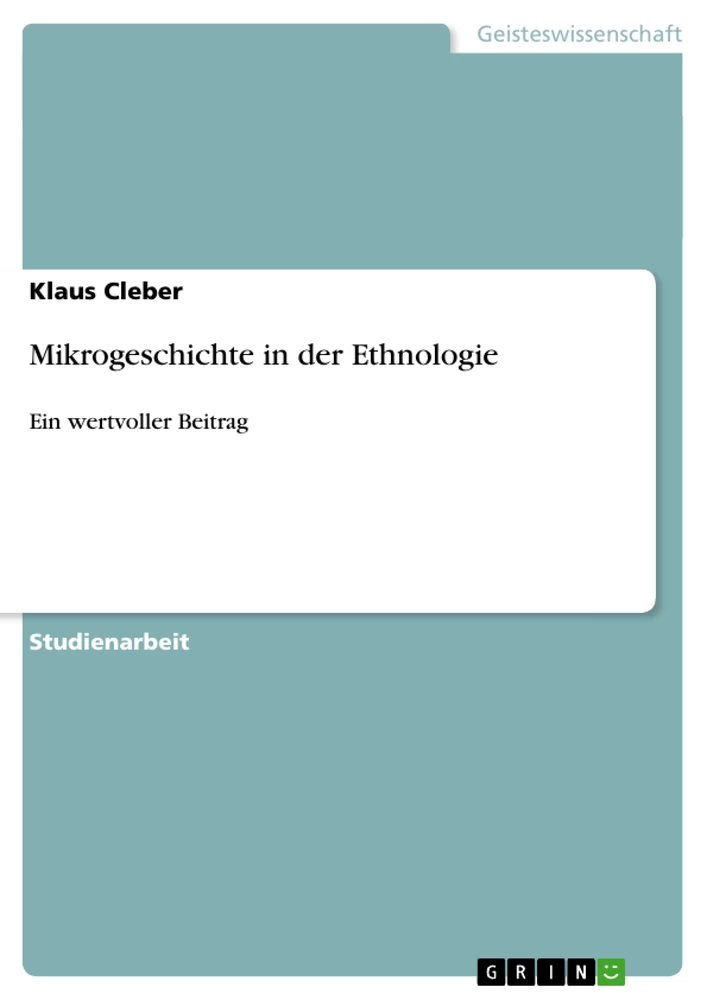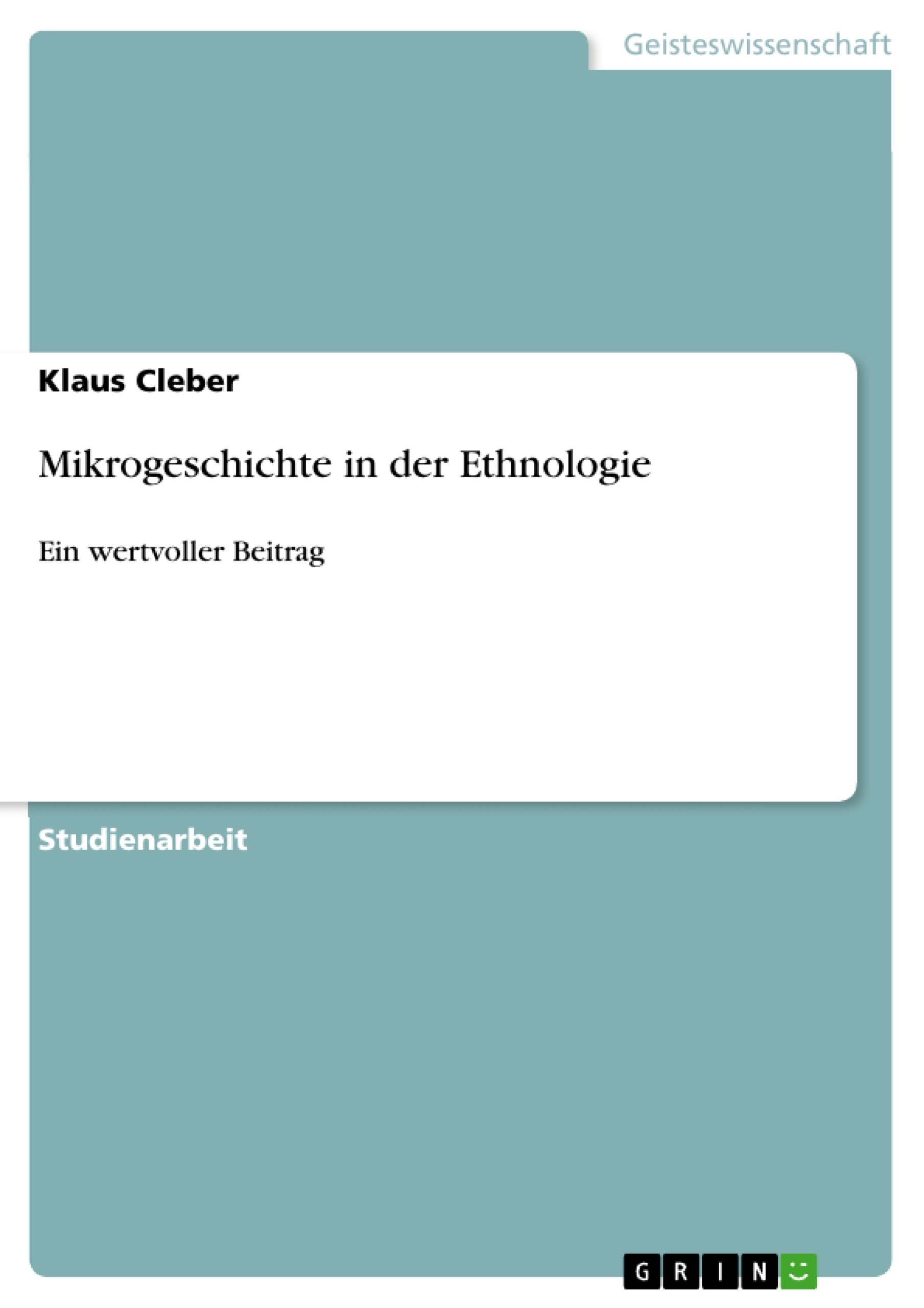Die postmoderne Erkenntnis dass Geschichtswissenschaft im Grunde eine subjektive Konstruktion ist führte zu Veränderungen und Strömungen innerhalb der Disziplin. Unter ihnen sticht die Mikrogeschichte für Ethnologen besonders hervor, da die Ethnologie einigen Einfluss auf die Entwicklung dieser Strömung hatte und eine Reihe Gemeinsamkeiten und ähnliche Forschungsstandards vorhanden sind. Im Folgenden möchte ich mich daher mit der Mikrogeschichte ausführlich auseinandersetzen. Zuerst gebe ich eine allgemeine Einführung, um dann näher auf konzeptionelle Besonderheiten einzugehen. Der zweite Teil bietet einen Überblick über Kritiken und Überlegungen zur Mikrogeschichte, speziell zur Beziehung der Mikro- und Makroebene. Insgesamt können im vorliegenden Text lediglich die Hauptgedanken und -argumente zusammengefasst werden, da die Diskussionen zum Thema einen erstaunlichen Umfang erreicht haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Was ist Mikrogeschichte?
- Allgemein
- Das außergewöhnliche Normale
- Gemeinsamkeiten mit ethnologischer Feldforschung
- Kritische Überlegungen und der Mikro-Makro-Link
- Kritik
- Die Beziehung von Mikro und Makro
- Schluss
- Quellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Zielsetzung dieses Textes ist eine umfassende Auseinandersetzung mit der Mikrogeschichte, einem wichtigen Ansatz innerhalb der Geschichtswissenschaft. Es werden konzeptionelle Besonderheiten dieser Methode erläutert und kritische Überlegungen, insbesondere zur Beziehung zwischen Mikro- und Makroebene, angesprochen. Aufgrund des umfangreichen Diskussionsstands können hier nur die Hauptgedanken und -argumente zusammengefasst werden.
- Definition und Entwicklung der Mikrogeschichte
- Methodische Besonderheiten der Mikrogeschichtsschreibung
- Die Rolle des „außergewöhnlichen Normalen“ in der Fallselektion
- Kritik an der Mikrogeschichte und ihre Beziehung zur Makrogeschichte
- Der Stellenwert narrativer Erzählformen in der Mikrogeschichte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Mikrogeschichte ein und hebt deren Bedeutung im Kontext postmoderner Geschichtswissenschaft hervor. Das Kapitel "Was ist Mikrogeschichte?" bietet eine allgemeine Einführung und beleuchtet konzeptionelle Besonderheiten. Es wird die Verkleinerung des Beobachtungsmaßstabes erklärt und die unterschiedlichen Strömungen innerhalb der Mikrogeschichte erläutert, insbesondere die Auswahl und Bedeutung „außergewöhnlicher normaler“ Fälle. Die Wichtigkeit intensiven Quellenstudiums und die Rolle narrativer Darstellungsformen werden ebenfalls hervorgehoben. Der Abschnitt über "Kritische Überlegungen und der Mikro-Makro-Link" befasst sich mit Kritikpunkten und der Beziehung zwischen mikro- und makrohistorischer Betrachtungsweise.
Schlüsselwörter
Mikrogeschichte, Makrogeschichte, methodische Besonderheiten, narratives Erzählen, Quellenkritik, „außergewöhnliches Normales“, Fallstudien, ethnologische Feldforschung, Kontextualisierung, Subjektivität in der Geschichtswissenschaft.
- Citation du texte
- Klaus Cleber (Auteur), 2011, Mikrogeschichte in der Ethnologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182013