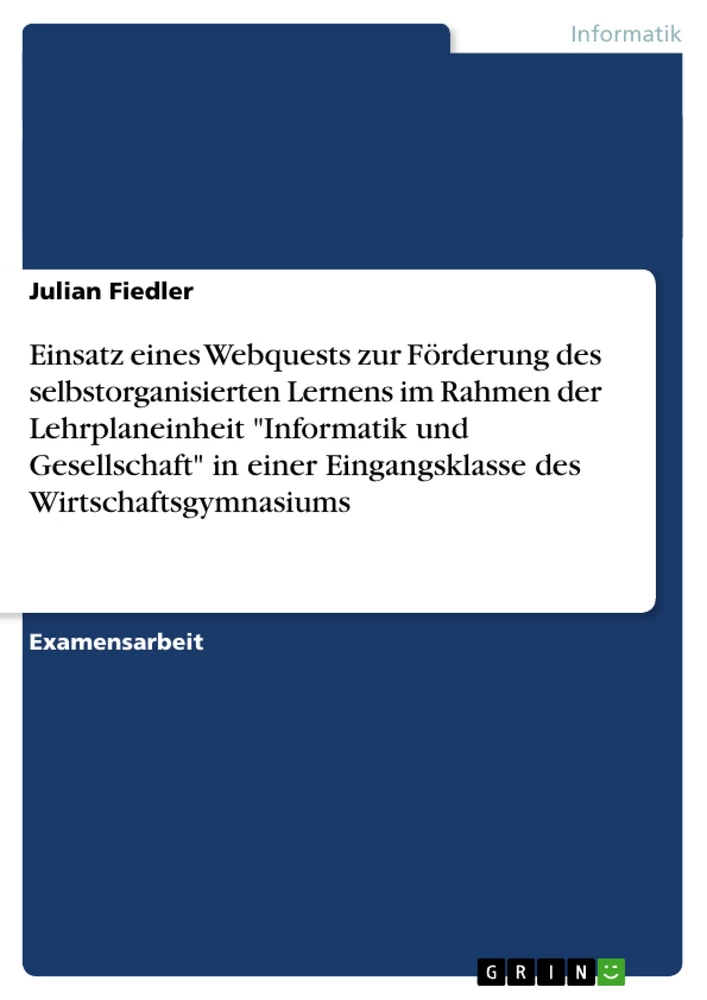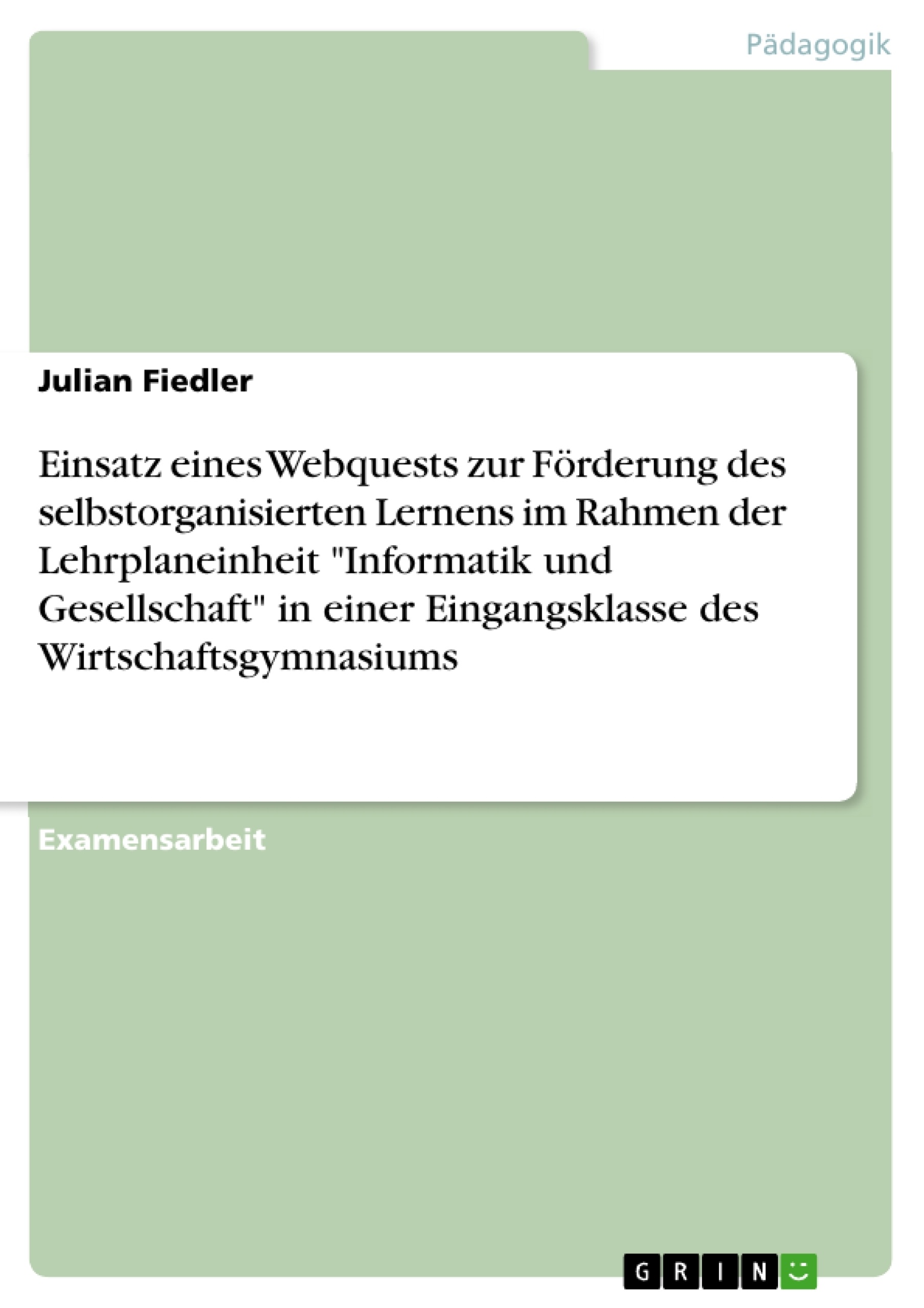In den Vorbemerkungen des Lehrplans für das Fach Informatik der Eingangsklasse des beruflichen Wirtschaftsgymnasiums wird deutlich, dass die Schule von heute nicht nur ein Angebot von Faktenwissen bereitstellen soll, sondern darüber hinaus den Gymnasiasten als mündigen Bürger zu fördern. Dabei soll im Einzelnen zur Stu-dierfähigkeit junger Menschen beigetragen und innerhalb des Faches Informatik, Einschätzung von Nutzen/Chancen durch den Einsatz von Informationssystemen sowie die Beschaffung/Aufbereitung von Informationen, ermöglicht werden (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2008), S. 2). So er-langt der Schüler eine Grundlage um seine Entscheidungen begründet zu treffen.
Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es jedoch eine Verbesserung der Unterrichts-qualität bzw. die Weiterentwicklung der Aufgaben – und Lernkultur. Eine zentrale didaktische Bedeutung hat vor diesem Hintergrund das selbstorganisierte Lernen (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2003), S. 3). Diese didaktisch-methodische Konzeption zur Stärkung der Selbstständigkeit und Selbstverantwortung der Lernenden (vgl. Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg (2003), S. 3) ist die pädagogische Antwort auf den Wandel der Arbeitswelt, Informationsgesellschaft und Medienlandschaft. Dabei soll der Schüler unter Anleitung der Lehrperson von dem rezeptiven Beobachter hin zu einem akti-ven, selbstbestimmenden Akteur des Unterrichts, Berufs und Alltags geführt werden.
Die Frage nach dem „Wie ist dies im Einzelnen umzusetzen?“ kann vielfältig be-antwortet werden. Eine Antwort ist die Durchführung der Webquestmethode inner- und außerhalb des Unterrichts. Das Webquest bietet für die oben genannten Ziele einen guten Ausgangspunkt, da es durch seine didaktische Struktur dem Schüler ein eigenständiges Vorgehen erlaubt, jedoch eine ziel- bzw. planlose Informations-beschaffung verhindert (vgl. Landesakademie für Fortbildung und Personalentwicklung an Schulen, S. Warum Webquests?). Dem zufolge kann das Webquest als Werkzeug für selbstorganisiertes Lernen angesehen werden.
Für die einzelnen Lehrpersonen, die eine Förderung des selbstorganisierten Lernens mithilfe der Webquestmethode erreichen wollen, bleiben jedoch offene Fragen, die in den aktuellen Diskussionen nur unzureichend beantwortet werden. Drei exemplarische Fragestellungen in diesem Kontext sollen mithilfe einer Studie innerhalb dieser Arbeit geprüft werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problem-/Fragestellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 2. Theoretischer Kontext
- 2.1 Selbstorganisiertes Lernen
- 2.1.1 Begriffserklärung
- 2.1.2 Gründe für die Förderung des SOL
- 2.1.3 Unterrichtsentwicklung und Planungshilfen
- 2.1.4 Ziele im Detail
- 2.1.5 Ansätze zur Förderung
- 2.2 Die Webquestmethode
- 2.2.1 Begriffserklärung
- 2.2.2 Didaktisches Modell
- 2.2.3 Ziele, Vorteile und Nachteile
- 2.2.4 Struktur
- 3. Darstellung der praktischen Umsetzung der Unterrichtseinheit
- 3.1 Didaktische Analyse
- 3.1.1 Bedingungsfelder
- 3.1.1.1 Schülervoraussetzung (Probandenbeschreibung)
- 3.1.1.2 Angaben zur Ausstattung des DV-Raumes
- 3.1.2 Entscheidungsfelder
- 3.1.2.1 Stoffauswahl und Abgrenzung
- 3.1.2.2 Lernziele
- 3.1.2.3 Methodische Entscheidungen
- 3.2 Verlaufsplan
- 4. Untersuchungsdesign
- 4.1 Erhebungsinstrumente
- 4.2 Auswertungsverfahren
- 5. Ergebnisse
- 5.1 Reflexion der Unterrichtseinheit
- 5.2 Analyse der resultierenden Effekte und des Lernprozesses
- 5.3 Analyse des Lehr-Lernarragement
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einsatz von Webquests zur Förderung selbstorganisierten Lernens im Informatikunterricht einer Eingangsklasse des Wirtschaftsgymnasiums. Ziel ist es, die Auswirkungen eines strukturierten Webquest-Einsatzes auf Lernprozesse und Lernergebnisse zu analysieren und Empfehlungen für die Gestaltung effizienter Lernumgebungen mit Webquests zu entwickeln.
- Auswirkungen eines strukturierten Webquest-Einsatzes auf Motivation, Angst und Konzentration der Schüler.
- Einfluss von Webquests auf den Lernprozess (Zeitplanung, Informationsverarbeitung, Selbstkontrolle).
- Gestaltungselemente für effiziente Lernumgebungen mit Webquests.
- Analyse des selbstorganisierten Lernens im Kontext des Informatikunterrichts.
- Evaluation der Webquestmethode als didaktisches Instrument.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik und die Forschungsfragen vor. Der theoretische Teil beleuchtet das selbstorganisierte Lernen und die Webquestmethode. Die praktische Umsetzung beschreibt die didaktische Analyse und den Verlaufsplan der Unterrichtseinheit. Der Abschnitt zum Untersuchungsdesign erläutert die verwendeten Erhebungs- und Auswertungsmethoden. Die Ergebnisse (ohne die Schlussfolgerungen) konzentrieren sich auf die Reflexion der Unterrichtseinheit und die Analyse der Effekte auf den Lernprozess.
Schlüsselwörter
Selbstorganisiertes Lernen (SOL), Webquest, Informatikunterricht, Wirtschaftsgymnasium, Lernprozess, Motivation, Angst, Konzentration, Zeitplanung, Informationsverarbeitung, Selbstkontrolle, didaktische Analyse, empirische Untersuchung, Lehr-Lernarrangement.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des Webquest-Einsatzes im Informatikunterricht?
Das Ziel ist die Förderung des selbstorganisierten Lernens (SOL). Schüler sollen unter Anleitung von rezeptiven Beobachtern zu aktiven, selbstbestimmten Akteuren werden, während sie gleichzeitig fachspezifische Kompetenzen in der Informationseinholung und -bewertung erwerben.
Warum wird die Webquest-Methode als Werkzeug für selbstorganisiertes Lernen (SOL) angesehen?
Durch seine didaktische Struktur erlaubt das Webquest ein eigenständiges Vorgehen der Schüler, verhindert jedoch gleichzeitig eine ziel- oder planlose Informationsbeschaffung im Internet.
Welche Rolle spielt die Lehrperson bei dieser Unterrichtsmethode?
Die Lehrperson fungiert als Anleiter, der den Übergang vom rezeptiven Lernen hin zum aktiven Handeln steuert, um die Selbstständigkeit und Selbstverantwortung der Lernenden zu stärken.
Welche psychologischen Aspekte werden in der Studie untersucht?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen des Webquest-Einsatzes auf die Motivation, die Angst und die Konzentration der Schüler während des Lernprozesses.
Was sind die Schwerpunkte der didaktischen Analyse in dieser Arbeit?
Die Analyse umfasst Bedingungsfelder wie Schülervoraussetzungen und technische Ausstattung sowie Entscheidungsfelder wie Stoffauswahl, Lernziele und methodische Entscheidungen.
Wie beeinflusst das Webquest die Informationsverarbeitung der Schüler?
Es strukturiert den Prozess der Beschaffung und Aufbereitung von Informationen, was zu einer gezielteren Selbstkontrolle und besseren Zeitplanung im Lernprozess führt.
- Quote paper
- Julian Fiedler (Author), 2011, Einsatz eines Webquests zur Förderung des selbstorganisierten Lernens im Rahmen der Lehrplaneinheit "Informatik und Gesellschaft" in einer Eingangsklasse des Wirtschaftsgymnasiums, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182677