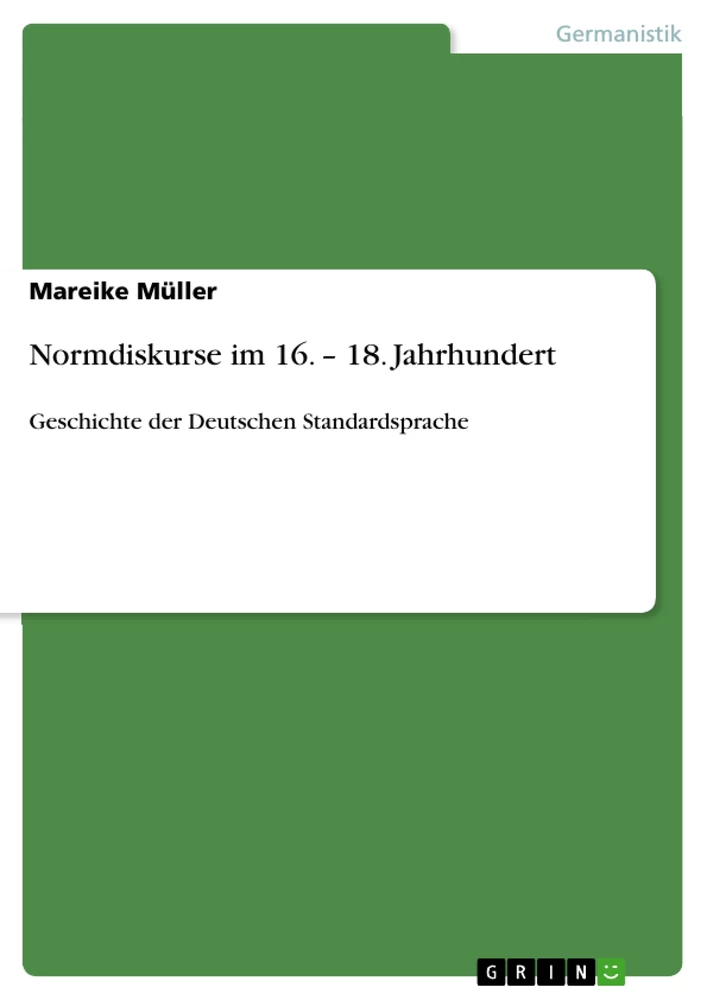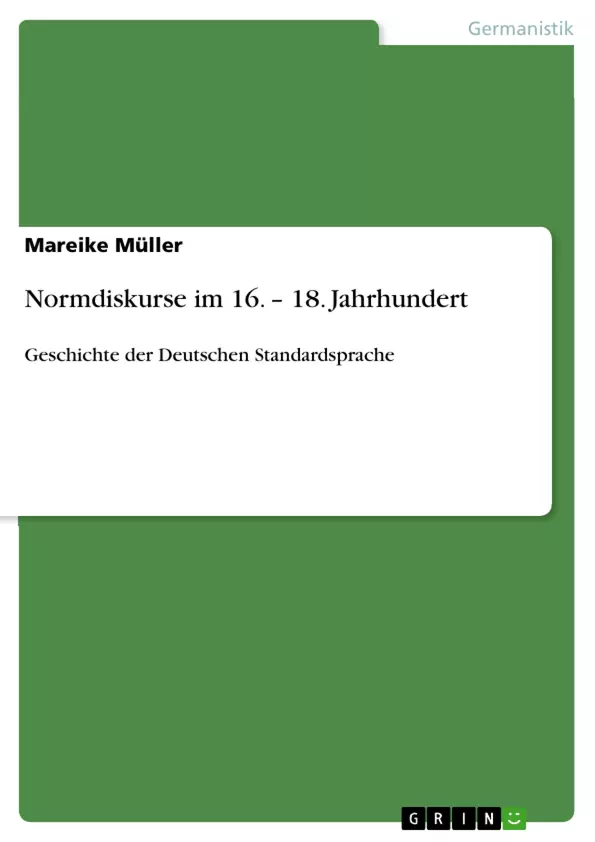1. Begriffserklärung
Sprachnormen sind laut vielen Begriffsbestimmungen und Erklärungen in einem Durchschnittswerte beziehungsweise „häufigste Ereignisse in einem statistischen Sinne.“ . Normalfälle sind daher dem Sachverhalt nach von Normen zu unterscheiden; auch wenn sie in der Sprachpraxis unter Umständen zu Normen werden können. Die Definition, die hier vorgeschlagen werden soll beruht auf Gloys Artikel „Sprachnormierung und Sprachkritik in ihrer gesellschaftlichen Verflechtung“ und besagt, dass Sprachnormen als Objekte und Ereignisse bestimmter Entscheidungs- und Durchsetzungsprozesse verstanden werden sollten.
Intensional sind Sprachnormen damit über das Merkmal einer (heteronomen) Verpflichtung definiert, welche als Vorschrift oder als Regel oder als Gebot der Vernunft gegeben sein kann. Extensional ist der Term Sprachnorm jedoch sehr unterschiedlich erklärt und wird auf sprachliche Erscheinungen jedes Schwierigkeitsgrades angewandt; es reicht von einem Gesamtsystem wie der langue bis hin zu phonetisch-phonologischen Phänomenen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Begriffserklärung
- 2. Entstehung eines volkssprachlichen Normbewusstseins durch die Grammatiker
- 3. Legitimationskriterien für Sprachnormen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Sprachnormen im 16. bis 18. Jahrhundert. Sie beleuchtet die Entstehung eines volkssprachlichen Normbewusstseins, die Rolle von Grammatikern in diesem Prozess und die Legitimationskriterien für Sprachnormen.
- Definition und Verständnis von Sprachnormen
- Entwicklung eines normativen Bewusstseins für die Volkssprache
- Einfluss der Grammatiker auf die Normierung der deutschen Sprache
- Kriterien zur Legitimation von Sprachnormen
- Soziale und politische Aspekte der Sprachnormierung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Begriffserklärung Dieses Kapitel definiert den Begriff „Sprachnorm“ und differenziert ihn von anderen verwandten Konzepten. Es analysiert verschiedene Definitionen und betont die Bedeutung von Entscheidungs- und Durchsetzungsprozessen bei der Bildung von Sprachnormen. Die verschiedenen Ansätze in der Definition des Begriffs werden beleuchtet.
Kapitel 2: Entstehung eines volkssprachlichen Normbewusstseins durch die Grammatiker Dieses Kapitel untersucht die Entstehung eines normativen Bewusstseins für die deutsche Volkssprache im Kontext der Reformation und der Lutherschen Bibelübersetzung. Es analysiert die Rolle der frühen deutschen Grammatiken und die Entwicklung der Forderung nach einer einheitlichen deutschen Sprache, beginnend mit Autoren wie Ratke und Schottelius. Der Einfluss pädagogischer Erfordernisse auf die Normierung der Sprache wird diskutiert.
Kapitel 3: Legitimationskriterien für Sprachnormen Dieses Kapitel befasst sich mit den Kriterien, die zur Legitimation von Sprachnormen verwendet werden. Es werden neun verschiedene Kriterien vorgestellt und erläutert, darunter der Erhalt der Einheit der Nation, allgemeine Verständlichkeit, etablierter Sprachgebrauch und der Sprachgebrauch kultureller Autoritäten. Die Bedeutung dieser Kriterien in historischen Kontexten wird beleuchtet.
Schlüsselwörter
Sprachnormen, Normbewusstsein, Grammatiker, Reformation, Sprachgeschichte, Einheitssprache, Legitimationskriterien, Volkssprache, Sprachpflege, Sprachkritik.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter „Sprachnormen“?
Sprachnormen werden als Objekte von Entscheidungs- und Durchsetzungsprozessen verstanden, die eine Verpflichtung (Regel oder Gebot) zur korrekten Sprachverwendung darstellen.
Wie entwickelte sich ein Normbewusstsein für die deutsche Sprache?
Ein wesentlicher Impuls war die Reformation und Luthers Bibelübersetzung, gefolgt von frühen Grammatikern wie Ratke und Schottelius, die eine einheitliche Sprache forderten.
Welche Kriterien legitimieren eine Sprachnorm?
Zu den Legitimationskriterien gehören unter anderem die Einheit der Nation, die allgemeine Verständlichkeit, der etablierte Sprachgebrauch und der Vorbildcharakter kultureller Autoritäten.
Welche Rolle spielten Grammatiker im 16. bis 18. Jahrhundert?
Grammatiker fungierten als Normsetzer, die versuchten, die Vielfalt der Dialekte in ein geregeltes System zu überführen, oft getrieben durch pädagogische Notwendigkeiten.
Was ist der Unterschied zwischen Normalfall und Norm?
Ein Normalfall beschreibt das statistisch Häufigste, während eine Norm eine bewusste Vorschrift oder Regel darstellt, die über die bloße Häufigkeit hinausgeht.
Warum war die Sprachnormierung politisch relevant?
Eine einheitliche Sprache wurde als Mittel zur Stärkung der nationalen Identität und zur Überwindung regionaler Zersplitterung angesehen.
- Citation du texte
- Mareike Müller (Auteur), 2011, Normdiskurse im 16. – 18. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182708