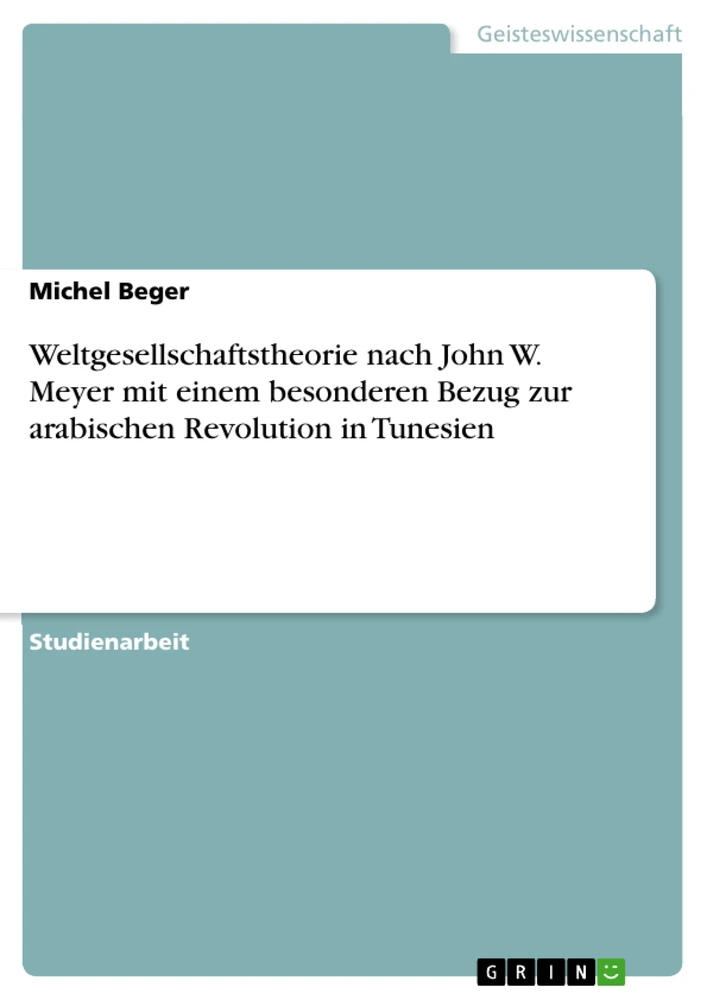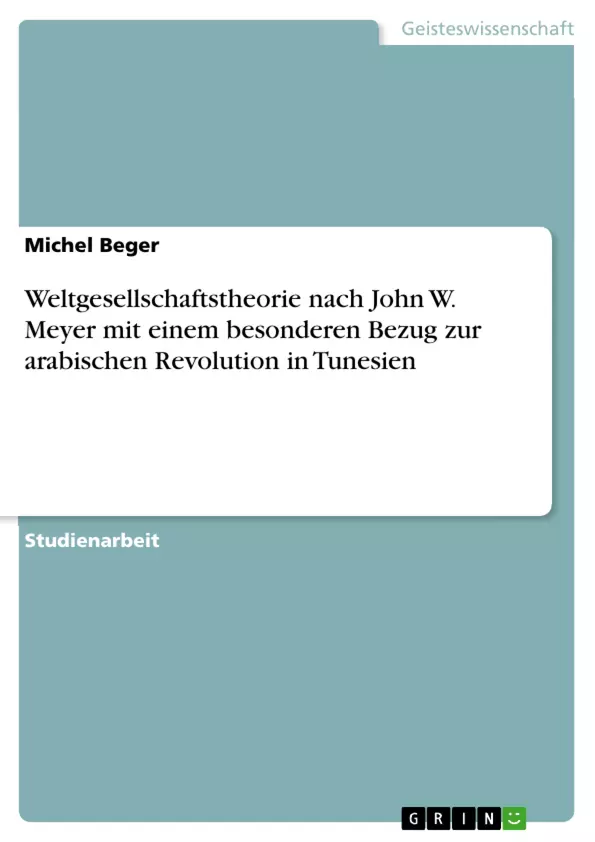Die Selbstentzündung eines tunesischen Gemüsehändlers ebnete den Weg für die arabische Revolution. Das Besondere an dieser Bewegung ist, dass sie sich stark an Prinzipien orientiert, die charakteristisch für die westliche Welt sind. Der Ruf nach Demokratie, Würde und Menschenrechte ist lautstark zu vernehmen. Es stellen sich dabei die Fragen: 1. Wie kann es eine Bewegung geben, die auf solchen Prinzipien und Modellen beruht? Und 2. Welchen Einfluss und welche Auswirkungen besitzt diese auf Staaten der Peripherie und des Zentrums? Um diese Fragen beantworten zu können, beziehe ich mich in den folgenden Kapiteln auf die Theorie von John W. Meyer (2005). Ich werde versuchen darzustellen, wie sich diese Theorie in Hinblick auf die Bedeutung des Nationalstaates und dessen Bevölkerung auf die aktuellen Geschehnisse in der arabischen Welt übertragen lässt und welche Rolle dabei die westliche Kultur spielt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Und die arabische Welt bewegt sich doch!.
- 2. Weltgesellschaft, Nationalstaat und Tunesien.
- 2.1. Zentrale These und Begriffe der Weltgesellschaftstheorie..
- 2.2. Das Wesen des Nationalstaates.……………………..
- 2.3. Tunesien unter Ben Ali: Ausgangsposition und Gründe für die Revolution.
- 2.4. Tunesien auf dem Weg zur Isomorphie......
- 2.5. Tunesien im Kontext globaler Organisationen
- 2.6. Zwischenfazit.
- 3. Abgrenzung und Kritik der Theorie
- 3.1. Abgrenzung der Theorie zu anderen theoretischen Ansätzen
- 3.2. Kritik an der Theorie.
- 4. Zusammenfassung..
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Weltgesellschaftstheorie von John W. Meyer auf die arabische Revolution in Tunesien anzuwenden und zu untersuchen, inwieweit sich die theoretischen Überlegungen an diesem konkreten Beispiel belegen lassen.
- Die zentrale Rolle des Nationalstaates in der Weltgesellschaft
- Der Einfluss globaler Modelle auf nationale Entwicklungen
- Die Ausbreitung westlicher Prinzipien und Ideale in der arabischen Welt
- Die Bedeutung von globalen Organisationen für die Gestaltung von Nationalstaaten
- Kritik und Abgrenzung der Weltgesellschaftstheorie von anderen theoretischen Ansätzen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den historischen Kontext der arabischen Revolution und die Rolle von Mohammed Bouazizi als Auslöser der Proteste. In Kapitel 2 wird die Weltgesellschaftstheorie von John W. Meyer eingeführt, insbesondere der Aspekt des Nationalstaates und seine Beziehung zur Weltgesellschaft. Dabei werden die zentralen These und Begriffe der Theorie erläutert. Kapitel 2.3 bis 2.5 wenden die Theorie auf Tunesien an, indem sie die Ausgangsposition des Landes unter Ben Ali und die Gründe für die Revolution sowie den Prozess der Isomorphie im Kontext globaler Organisationen untersuchen. Kapitel 3 widmet sich der Abgrenzung und Kritik der Theorie, indem es die Theorie mit anderen theoretischen Ansätzen vergleicht und kritische Aspekte aufzeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen wie Weltgesellschaftstheorie, Nationalstaat, globale Modelle, Isomorphie, arabische Revolution, Tunesien, Ben Ali, westliche Prinzipien, Demokratie, Menschenrechte, Globalisierung, Kritik und Abgrenzung.
- Arbeit zitieren
- B.A Bildungs- und Erziehungswissenschaftler Michel Beger (Autor:in), 2011, Weltgesellschaftstheorie nach John W. Meyer mit einem besonderen Bezug zur arabischen Revolution in Tunesien, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/182893