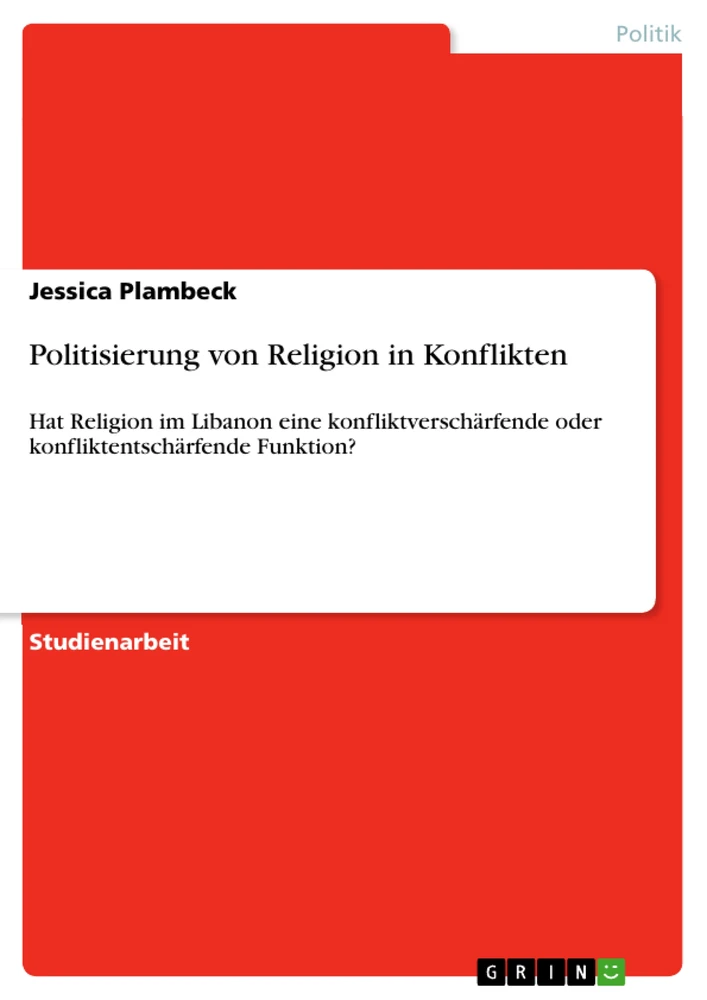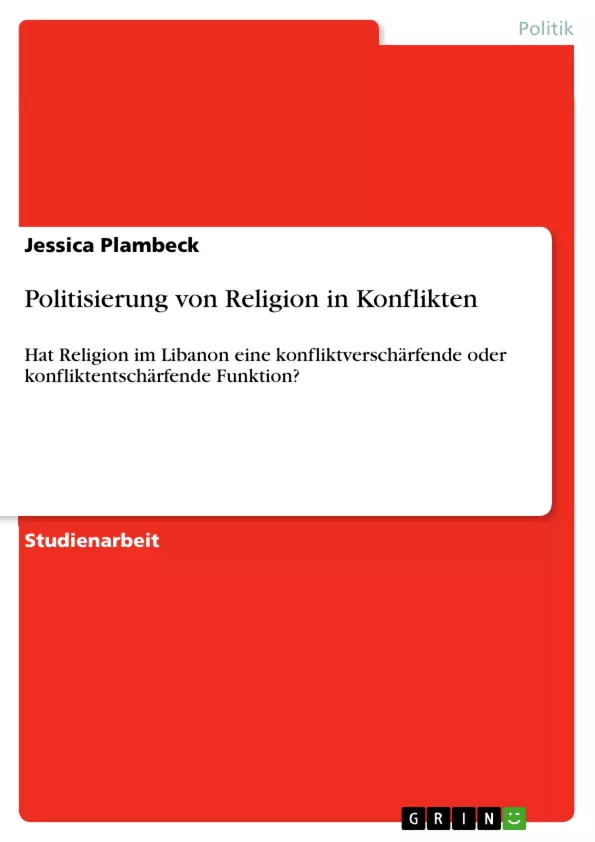Trotz Gegenteiliger Annahmen, dass Religion als eine politische Kraft aus der modernen Gesellschaft langsam verschwindet, ist in weiten Teilen der so genannten Dritten Welt, aber auch in manchen Industriestaaten, allen voran den USA, in den letzten zwei Jahrzehnten eine „politische Renaissance religiöser Gemeinschaften“ zu beobachten.Bisher lässt sich nicht absehen, ob es sich nur um eine Politisierung der Religion, im Rahmen der bisherigen Regelungen des Verhältnisses von Religion und Politik, religiösen Gemeinschaften und Staat handelt, oder ob nicht vielmehr eine genuine Renaissance der Religion im Gange ist. Eine Vielzahl höchst unterschiedlicher Entwicklungen deutet dabei auf die Beharrlichkeit von Religion in der Politik und ihre veränderte Rolle zur Politik hin. Hierzu zählen nicht nur die Entstehung fundamentalistischer Bewegungen, sowie ihre zunehmende Mobilisierung in nahezu allen religiösen Traditionen, sondern auch die steigende Zahl der gewaltsam ausgetragenen Konflikte, in denen religiöse Komponenten eine wesentliche Rolle spielen.
Gewaltsam ausgetragene Konflikte werden häufig durch religiöse Motivlagen beeinflusst. Dabei können religiös verfasste Institutionen, religiös motivierte Personen, religiöse Praxis und Tradition, sowie theologische Lehrbildung sowohl konfliktverschärfend als auch konfliktentschärfend wirken.[...]
Die Schwächung staatlicher Institutionen und nationaler Identitäten führt vor allem in Ländern der Dritten Welt zu einem ideologischem Vakuum, in dem religiöse Traditionen Mittelpunkt neuer kultureller Identitäten und transnationaler Einheitsprojekte werden.
Es lässt sich somit feststellen, dass dem Verhältnis von Politik und Religion, insbesondere seit 9/11, erhöhte Aufmerksamkeit im wissenschaftlichen Diskurs zukommt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Religion auch in der Politikwissenschaft, die das Feld bisweilen überwiegend den Religionssoziologen und Staatskirchenrechtlern überließen, oder ihr allenfalls marginale Betrachtung schenkte, Einzug erhält[...]
Nach einer kurzen theoretischen Einleitung, die auf dem Ansatz von Andreas Hasenclever und Volker Rittberger beruht, soll die Rolle von Religion im libanesischen Bürgerkrieg, welche von 1975 bis 1990 andauerte, untersucht werden. Im Speziellen wird die Frage behandelt werden, inwieweit man von einer Politisierung der Religion im Libanon sprechen kann bzw. inwieweit Religion während dieses Konfliktes von den einzelnen Konfliktparteien instrumentalisiert wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung. Theoretischer Ansatz und Einfluss von Religion in politischen Konflikten.
- Primordialisten
- Instrumentalisten
- Konstruktivisten.
- Gegenüberstellung der Positionen „Religion in Konflikten“.
- Ist Religion konfliktverschärfend oder entschärfend?.
- Mobilisierbarkeit der Anhänger
- Religiöse Aufklärung
- Strukturelle Toleranz bzw. Religiöses Bewusstsein
- Innerreligiöse Öffentlichkeit
- Religiöse Autonomie.
- Einleitung zum Empirieteil
- Historischer Abriss.
- Vom Osmanischen Reich zum Nationalstaat Libanon..
- Politisches System im Libanon.
- Ursachen, Auslöser und Verlauf des Bürgerkrieges
- Beteiligte Gruppen
- Die maronitische Religionsgemeinschaft.
- Die sunnitische Religionsgemeinschaft
- Die schiitische Religionsgemeinschaft..
- Profil der Gruppen mit Bezug auf den Bürgerkrieg
- Maroniten
- Sunniten...
- Schiiten.
- Externe Akteure.
- Analyse
- Konfliktverschärfend bzw. -entschärfend
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Rolle von Religion in Konfliktsituationen, insbesondere im libanesischen Bürgerkrieg (1975-1990). Sie analysiert, ob Religion eher konfliktverschärfend oder konfliktentschärfend wirkt, und ob von einer Politisierung der Religion im Libanon gesprochen werden kann.
- Theoretische Ansätze zum Verhältnis von Religion und Politik
- Die Rolle von Religion im libanesischen Bürgerkrieg
- Die Politisierung der Religion im Libanon
- Die Instrumentalisierung von Religion durch Konfliktparteien
- Die Funktion von Religion in der Konfliktaustragung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass Religion in der heutigen Welt eine zunehmend wichtige Rolle in der Politik spielt, und dass die Politisierung von Religion zu einer Renaissance der Religion führt. Sie beleuchtet die unterschiedlichen Positionen zum Verhältnis von Religion und Politik, die von Primordialisten, Instrumentalisten und Konstruktivisten vertreten werden.
- Theoretischer Ansatz: Das zweite Kapitel beschäftigt sich mit der Rolle von Religion in politischen Konflikten und stellt die drei wichtigsten Positionen in der sozialwissenschaftlichen Diskussion vor. Die Primordialisten gehen davon aus, dass religiöse Überzeugung eine eigenständige Wirkmacht in der Weltpolitik zukommt, während die Instrumentalisten Unterschiede im Glaubensbekenntnis als ursächlich für Konflikte ablehnen. Die Konstruktivisten argumentieren, dass Religion in Konflikten von Akteuren instrumentalisiert und genutzt wird, um politische Ziele zu erreichen.
- Einleitung zum Empirieteil: Der dritte Teil der Arbeit führt in den empirischen Teil ein und gibt einen historischen Abriss über die Entwicklung des Libanon vom Osmanischen Reich zum Nationalstaat. Er beschreibt das politische System des Landes und geht auf die Ursachen, Auslöser und den Verlauf des Bürgerkrieges ein.
- Beteiligte Gruppen: Der vierte Teil der Arbeit stellt die wichtigsten Konfliktparteien im libanesischen Bürgerkrieg vor: die maronitische, die sunnitische und die schiitische Religionsgemeinschaft. Er beschreibt die jeweilige Rolle der Gruppen im Konflikt und deren Konflikte.
Schlüsselwörter
Religion, Politik, Konflikte, Libanon, Bürgerkrieg, Politisierung, Instrumentalisierung, Primordialismus, Instrumentalismus, Konstruktivismus, Maroniten, Sunniten, Schiiten.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Religion in modernen politischen Konflikten?
Trotz Säkularisierungstrends ist eine "politische Renaissance" religiöser Gemeinschaften zu beobachten, wobei Religion oft als identitätsstiftende Kraft in Konflikten dient.
Was ist der Unterschied zwischen Primordialisten und Instrumentalisten?
Primordialisten sehen in religiöser Überzeugung eine eigenständige Macht; Instrumentalisten glauben, dass Religion lediglich zur Erreichung politischer Ziele genutzt wird.
Wie wirkte Religion im libanesischen Bürgerkrieg?
Im Libanon wurde Religion von verschiedenen Gruppen (Maroniten, Sunniten, Schiiten) instrumentalisiert, was den Konflikt sowohl verschärfen als auch strukturieren konnte.
Was versteht man unter der Politisierung von Religion?
Es beschreibt den Prozess, bei dem religiöse Traditionen und Institutionen zum Mittelpunkt politischer Mobilisierung und kultureller Identitätsprojekte werden.
Kann Religion auch konfliktentschärfend wirken?
Ja, religiöse Institutionen und Akteure können durch strukturelle Toleranz, ethische Lehren und Vermittlung auch zur Deeskalation von Gewalt beitragen.
- Citar trabajo
- Jessica Plambeck (Autor), 2008, Politisierung von Religion in Konflikten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/183237