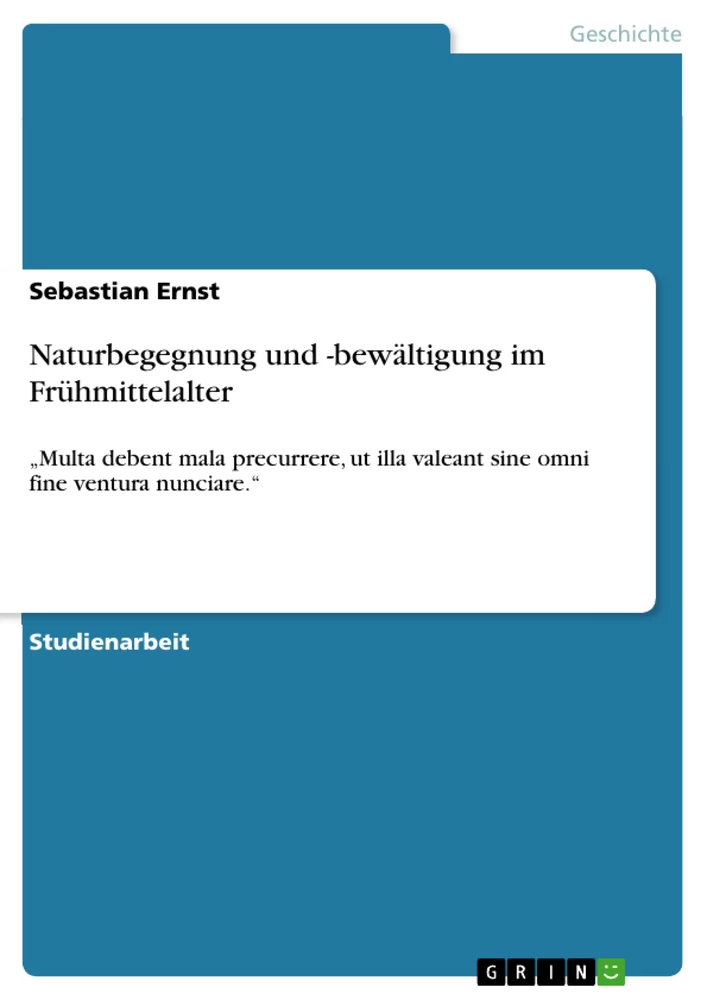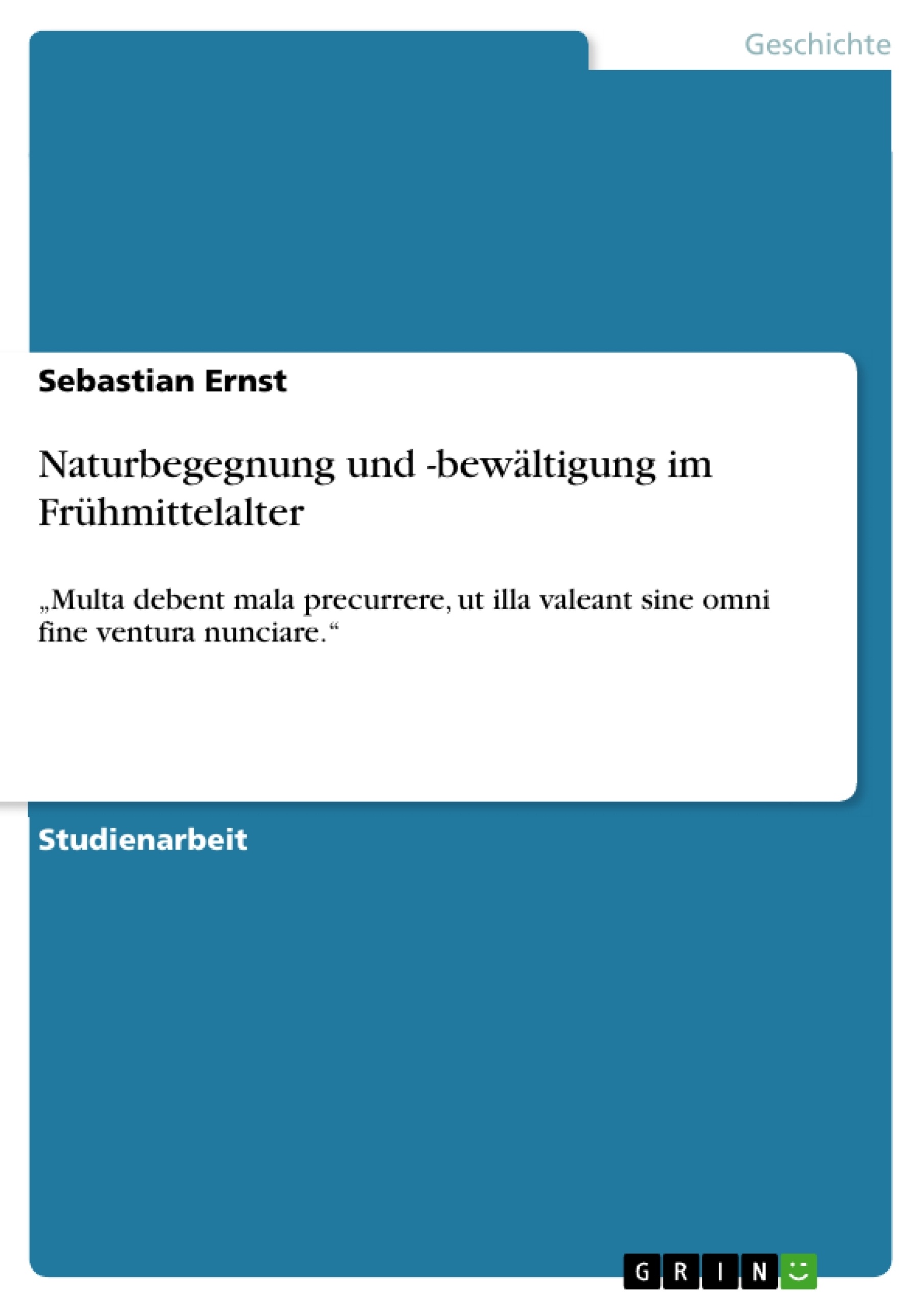In einem 2010 online erschienenen Nachrichtenartikel wurde von einem Meteoritenabsturz auf ein Haus berichtet. Dies allein ist zwar statistisch selten, jedoch nicht ungewöhnlich. In diesem Fall war es jedoch der sechste in kürzester Zeit, was den Besitzer zur Vermutung führte, er werde von Aliens als Ziel eines Spaßes benutzt.
Das Ereignis in diesem Artikel zeigt, dass auch heute noch bestimmte ungewöhnliche Naturereignisse auf ganz bestimmte und zugleich unterschiedliche Art gedeutet und bewältigt werden müssen. Dabei wird nicht selten sehr erregt und hitzig über Deutungsmöglichkeiten gestritten, in denen immer auch die jeweilige Weltanschauung mitschwingt, so dass die Deutung immer auch ein Schlachtfeld ist, auf dem um die „wahre“ Beschaffenheit der Welt gestritten wird.
Für die Betroffenen ist jedoch das Bedürfnis nach Bewältigung zentral. Es beschreibt den Versuch, der Ohnmacht des Zufalls oder der Sinnlosigkeit zu entkommen.
Nun ist dieser Fall recht außergewöhnlich, jedoch erliegen weitaus profanere Ereignisse ähnlichen Bedürfnissen nach Deutung und Sinnstiftung. Praktisch alle bedrohlichen und katastrophenhaften Naturerscheinungen erfreuen sich schon immer großer Beliebtheit in diesem Spiel.
Im Rahmen dieser Arbeit soll nun der Frage nachgegangen werden, wie mit solchen Problemen im Frühmittelalter umgegangen wurde und werden musste. Gerade das Frühmittelalter eignet sich für eine solche Untersuchung besonders, ist es doch auf den ersten Blick einerseits stärker mit der Natur verbunden als das moderne Mitteleuropa mit seinen Industrienationen und andererseits viel weiter entfernt, wenn man moderne Ökophilosophie oder Tierechtstheorien als Maßstab nimmt.
Wie sah also die Bewältigung von Natur und Naturkatastrophen im Frühmittelalter aus, welche Strategien und Möglichkeiten wurden wie genutzt und was steht dahinter? Dabei sind Naturkatastrophen nicht im engen modernen Sinne zu verstehen. Vielmehr sind damit alle vorkommenden, ängstigenden und bedrohlichen Naturerscheinungen, die in den Quellen genannt werden, gemeint.
Zeitlich und räumlich orientiert sich diese Untersuchung dabei an den Karolingern und Ottonen und damit zugleich auf den Anspruch und das Bestreben nach Christianisierung. Den Rahmen bildet somit ebenso das Einsetzen der karolingischen Renaissance auf der einen und der Wandel in der Naturwahrnehmung, der mit dem 11. Jh. angesetzt wird, auf der anderen Seite.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I Die Quellen
- II Natur- und Naturbegegnung in den Quellen
- 1. Natur als Rechts-und Grenzraum
- 2. Natur als Nutzungsraum für den Menschen
- 3. Natur als (potentielle) Bedrohung
- III Die Bewältigung von Natur
- 1. Pragmatisch
- 2. Magisch/religiös
- a. Deutung
- b. Ritual
- 3. Rational
- Zusammenfassung
- Quellen- und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Begegnung und Bewältigung von Natur im Frühmittelalter, insbesondere im karolingischen und ottonischen Herrschaftsraum. Sie analysiert, wie Natur in den Quellen des Frühmittelalters dargestellt wird und welche Strategien zur Bewältigung von Naturereignissen eingesetzt wurden. Dabei werden sowohl pragmatische, magisch-religiöse als auch rationale Ansätze betrachtet.
- Natur als Rechts- und Grenzraum
- Natur als Nutzungsraum für den Menschen
- Natur als Bedrohung und Quelle von Angst
- Pragmatische, magisch-religiöse und rationale Bewältigungsstrategien
- Die Rolle der Christianisierung in der Naturwahrnehmung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Problematik der Naturbegegnung und -bewältigung im Frühmittelalter vor und erläutert die Relevanz des Themas. Sie zeigt auf, dass auch heute noch Naturereignisse auf unterschiedliche Art gedeutet und bewältigt werden, und dass diese Deutungen von der jeweiligen Weltanschauung geprägt sind.
Das Kapitel „Die Quellen“ beleuchtet die Quellenlage für die Untersuchung der Naturwahrnehmung im Frühmittelalter. Es wird deutlich, dass die Quellenlage zwar schwierig ist, aber dennoch wichtige Einblicke in die Lebenswelt der Menschen im Frühmittelalter bietet.
Das Kapitel „Natur- und Naturbegegnung in den Quellen“ analysiert die Darstellung von Natur in den Quellen des Frühmittelalters. Es werden drei Aspekte betrachtet: Natur als Rechts- und Grenzraum, Natur als Nutzungsraum für den Menschen und Natur als (potentielle) Bedrohung.
Das Kapitel „Die Bewältigung von Natur“ untersucht die Strategien, die im Frühmittelalter zur Bewältigung von Naturereignissen eingesetzt wurden. Es werden drei Ansätze betrachtet: pragmatische, magisch-religiöse und rationale Ansätze.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Naturbegegnung und -bewältigung im Frühmittelalter, die Quellenlage des Frühmittelalters, die Naturwahrnehmung im Frühmittelalter, die Christianisierung, pragmatische, magisch-religiöse und rationale Bewältigungsstrategien, Rechts- und Grenzraum, Nutzungsraum, Bedrohung, Angst, Deutung, Ritual, karolingische und ottonische Zeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie nahmen Menschen im Frühmittelalter die Natur wahr?
Natur wurde als Rechts- und Grenzraum, als Nutzungsraum, aber vor allem auch als bedrohliche Macht wahrgenommen, die gedeutet werden musste.
Wie wurden Naturkatastrophen im Mittelalter bewältigt?
Man nutzte drei Strategien: pragmatische (Wiederaufbau), magisch-religiöse (Gebete, Rituale zur Deutung) und erste rationale Ansätze.
Welche Rolle spielte die Christianisierung für das Naturverständnis?
Die Christianisierung unter den Karolingern und Ottonen führte dazu, dass Naturereignisse oft als Zeichen Gottes oder göttliche Strafe interpretiert wurden.
Was versteht man unter der „karolingischen Renaissance“?
Es war eine Bildungsreform und kulturelle Erneuerung unter Karl dem Großen, die auch die Art und Weise beeinflusste, wie Naturereignisse schriftlich dokumentiert und gedeutet wurden.
Warum sind Quellen zum Naturverständnis im Frühmittelalter schwer zu finden?
Die Quellenlage ist oft lückenhaft und stark von religiösen Motiven geprägt, was eine objektive Untersuchung der damaligen „Ökophilosophie“ erschwert.
- Quote paper
- Sebastian Ernst (Author), 2010, Naturbegegnung und -bewältigung im Frühmittelalter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184054