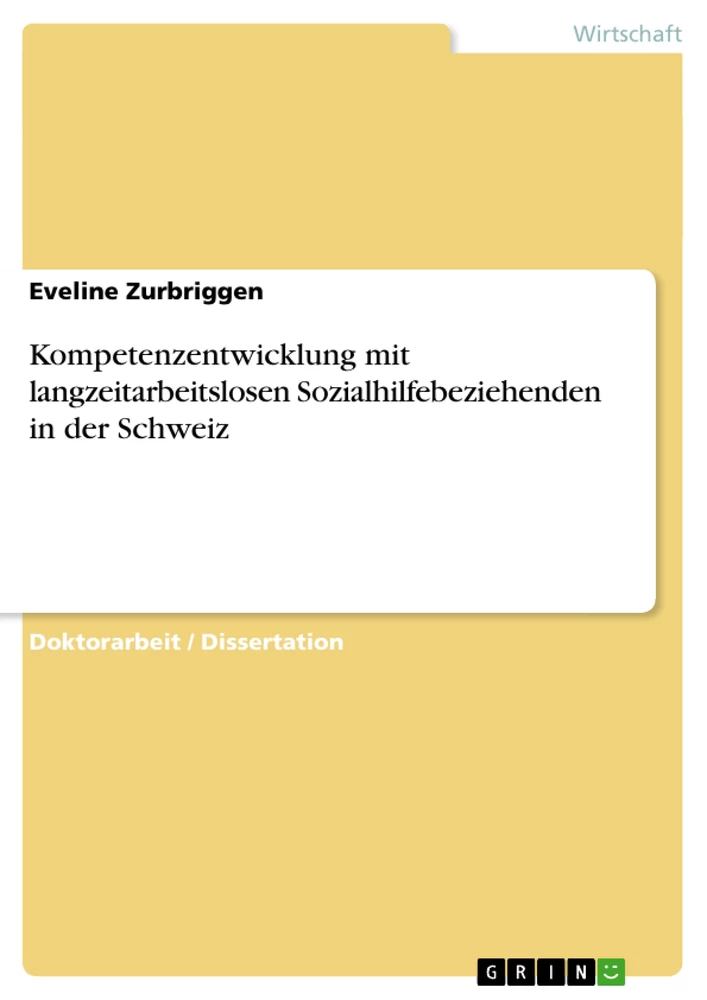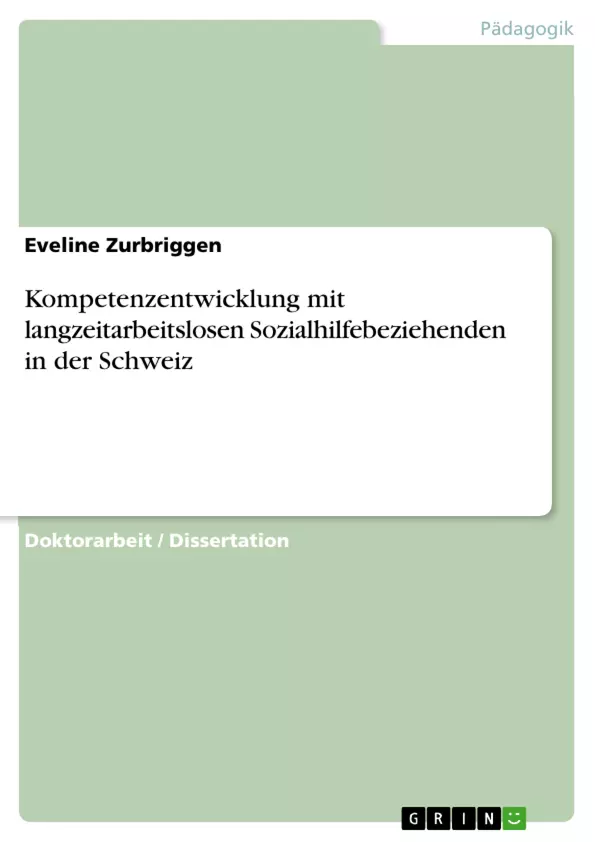Abstract
Die schwierige Wirtschaftslage am Ende des letzten und zu Beginn dieses Jahrhunderts hat die Zahl der Sozialhilfebeziehenden in der Schweiz sprunghaft ansteigen lassen. Ein namhafter Teil derselben verfügt nicht über eine berufliche Ausbildung, viele Jugendliche haben auch keinen Schulabschluss. Selbst die Klienten und Klientinnen, die eine Lehre absolviert haben, sehen sich mit der Situation konfrontiert, dass ihre Kompetenzen zu den aktuellen gestiegenen Anforderungen des ersten Arbeitsmarktes nicht kompatibel sind oder dem Anspruchsniveau nicht zu genügen vermögen.
Obwohl die Politik auf diese Situation unter anderem mit einem neuen Arbeitslosengesetz und einer Anpassung der für die Sozialhilfe relevanten Richtlinien reagiert hat, die beide ein Recht auf Beschäftigungsprogramme und Bildungsmassnahmen der beruflichen Integration vorsehen, erweist sich die Umsetzung als Weg mit vielen Stolpersteinen, die sich bei den Erwerbslosen selber und ihrer belastenden sozialen Lebenslage, im Kontext des Arbeitsmarktes, seitens des Betreuungssettings, aber auch auf struktureller Ebene manifestieren.
Anhand von Interviews mit Experten und Expertinnen der Fachstellen der beruflichen Integration werden diese Hindernisse konkretisiert und die systemischen Zusammenhänge aufgezeigt. Dieser mehrperspektivische Zugang soll zudem - weil er die Komplexität der Problematik spiegelt - sachdienliche Ansatzpunkte für mögliche Erfolgsfaktoren der arbeitsmarktlichen und Bildungsmassnahmen geben. Auf dieser Grundlage werden Optimierungsmöglichkeiten entwickelt und Empfehlungen für die verschiedenen Akteure in einem zeitlich gestaffelten Rahmen vorgeschlagen. Dabei steht die These im Raum, dass ein gut koordiniertes, zielgerichtetes und flexibles interdisziplinäres Vorgehen wirksamer ist als das Ausschöpfen der jeweiligen Einzelmöglichkeiten der Fachstellen.
Gefragt ist folglich ein Paradigmenwechsel hin zu einer systemischen Lebenslaufperspektive mit einem professionellen Diversity Management.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Vorwort
- Kompetenzentwicklung mit langzeit-arbeitslosen Sozialhilfebeziehenden
- 1 Menschen im Kontext von Ausbildung, Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe
- 2 Berufsbildungssystem in der Schweiz
- 2.1 Organisationsstruktur der Berufsbildung und Rahmengesetzgebung
- 2.2 Pädagogische Grundlagen der Berufsbildung
- 2.3 Berufsbildung unter erschwerten Rahmenbedingungen
- 2.4 Innovative Validierungsverfahren für Bildungsleistungen
- 3 Unterstützung Arbeitsloser in der Schweiz
- 3.1 Organisationsstruktur und Rahmengesetzgebung
- 3.2 Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes
- 3.3 Betreuung und Vermittlung - arbeitsmarktliche Massnahmen
- 3.4 Arbeitslosigkeit und ihre Folgen für die Betroffenen
- 3.5 Konzept der kantonalen Arbeitslosenhilfe
- 4 Sozialhilfe in der Schweiz
- 4.1 Organisation der Sozialhilfe und SKOS-Richtlinien
- 4.2 Merkmale und Lebenslage von Sozialhilfebeziehenden
- 4.3 Soziale und berufliche Integration
- 4.4 Massnahmen für die soziale und berufliche Integration
- 4.5 Ausbildungs- und arbeitslose Jugendliche und junge Erwachsene
- 5 Untersuchungsdesign
- 5.1 Auswahl der Fachstellen
- 5.2 Experteninterviews
- 5.3 Materialienpool
- 5.4 Qualitative Inhaltsanalyse
- 6 Stadt Bern - Kompetenzzentrum Arbeit
- 6.1 Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene
- 6.2 Angebote für Erwachsene
- 6.3 Angebote der Sektion Abklärung und Qualifizierung erwachsene Sozialhilfebeziehende
- 7 Kanton Wallis - topjoberwallis
- 7.1 Vertragsmodelle für die berufliche Integration
- 7.2 Umsetzung der Vertragsmodelle
- 7.3 Befristete Stelle in der öffentlichen Verwaltung
- 7.4 Ausbildungslose Jugendliche und junge Erwachsene
- 7.5 Sozialpädagogischer Förderprozess
- 8 Stadt Zürich - Arbeitsintegration
- 8.1 Arbeitsintegrationsangebote der Stadt Zürich
- 8.2 Abteilung Berufsbildung und Integration
- 8.3 Chancenmodell
- 8.4 Konzept der Ressourcen- und Sozialraumorientierung
- 9 Wirksamkeit der Massnahmen zur beruflichen Integration
- 9.1 Integrationshindernisse
- 9.1.1 Integrationshindernisse seitens der Sozialhilfebeziehenden
- 9.1.1.1 Ausbildungsniveau und Basiskompetenzen
- 9.1.1.2 Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdbild
- 9.1.1.3 Erwartungen hinsichtlich der Arbeitsbedingungen
- 9.1.1.4 Vom Wollen zum Umsetzen
- 9.1.1.5 Soziale Lebenslage als Kumulation ungünstiger Faktoren
- 9.1.1.6 Handlungsautonomie wahren
- 9.1.1.7 Ausgeprägtes Anspruchsdenken
- 9.1.1.8 Bezug zwischen Interviews und Forschungsliteratur
- 9.1.2 Integrationshindernisse seitens des Arbeitsmarktes
- 9.1.2.1 Allgemeine Wirtschaftslage
- 9.1.2.2 Wandel der Firmenstrukturen und Berufsfelder
- 9.1.2.3 Veränderungen der Arbeitsverhältnisse und Verlust von Nischenarbeitsplätzen
- 9.1.2.4 Grösse des Unternehmens
- 9.1.2.5 Betriebswirtschaftliche Aspekte
- 9.1.2.6 Öffentliche Hand als Arbeitgeberin
- 9.1.2.7 Vorurteile und negative Einstellungen
- 9.1.2.8 Gesamtarbeitsvertragliche Lohnbarrieren
- 9.1.2.9 Überflutung mit "unkoordinierten" Anfragen verschiedener Dienste
- 9.1.2.10 Bezug zwischen Interviews und Forschungsliteratur
- 9.1.3 Integrationshindernisse seitens der Sozialhilfe / Betreuung
- 9.1.3.1 Steigende Komplexität und wenig kompatible Prozesse
- 9.1.3.2 Hoher administrativer Aufwand der Fachstelle
- 9.1.3.3 Verständigungsbasis im Betreuungssetting
- 9.1.3.4 Arbeitsklima und Zusammenarbeit mit anderen Sozialhilfebeziehenden
- 9.1.3.5 Umgang mit Grenzen im Förderprozess
- 9.1.3.6 Auffangen struktureller Risiken
- 9.1.3.7 Interinstitutionelle Zusammenarbeit
- 9.1.3.8 Schnittstelle zu Unternehmen
- 9.1.3.9 Qualitätsmanagement und Kommunikation
- 9.1.4 Strukturelle Integrationshindernisse
- 9.1.4.1 Fehlender Fokus auf Berufsbildung
- 9.1.4.2 Nicht genutztes Potential des neuen Berufsbildungsgesetzes
- 9.1.4.3 Konkurrenzverbot der öffentlichen Hand
- 9.1.4.4 Interdependenzen der Sozialversicherungen
- 9.1.4.5 Föderalismus
- 9.1.4.6 Administrativer Aufwand in der interinstitutionellen Zusammenarbeit
- 9.1.4.7 Räumliche Trennung zwischen Sozialdiensten und Fachstellen
- 9.1.4.8 Finanzanreize und Lohnfreibeträge
- 9.1.4.9 Sanktionsmechanismen
- 9.1.4.10 Sprachregionale Zugehörigkeit
- 9.1.4.11 Genderproblematik
- 9.1.4.12 Gesellschaftliche Exklusionsprozesse
- 9.2 Erfolgsfaktoren
- 9.2.1 Erfolgsfaktoren seitens der Sozialhilfebeziehenden
- 9.2.2 Erfolgsfaktoren seitens des Arbeitsmarktes
- 9.2.3 Erfolgsfaktoren seitens der Sozialhilfe / Betreuung
- 9.2.4 Strukturelle Erfolgsfaktoren
- 9.1.1 Integrationshindernisse seitens der Sozialhilfebeziehenden
- 10 Optimierungsmöglichkeiten
- 10.1 Optimierungsmöglichkeiten bei den Sozialhilfebeziehenden
- 10.1.1 Kompetenzen entwickeln und zertifizieren
- 10.1.2 Veränderung des Verhaltensrepertoires und der Denkmuster
- 10.1.3 Stärkung des sozialen Umfelds
- 10.2 Optimierungsmöglichkeiten im Kontext des Arbeitsmarktes
- 10.2.1 Gesellschaftliche Verantwortung der Unternehmen
- 10.2.2 Etablierung eines zweiten und dritten Arbeitsmarkts
- 10.2.3 Öffentliche Hand in der Pflicht
- 10.3 Optimierungsmöglichkeiten bei der Sozialhilfe / Betreuung
- 10.3.1 Tragfähiges Commitment
- 10.3.2 Differenzierte Standortbestimmung - umfassendes Assessment
- 10.3.3 Interne Abläufe effizienter gestalten
- 10.3.4 Wirksame interinstitutionelle Zusammenarbeit
- 10.3.5 Supported Employment
- 10.4 Optimierungsmöglichkeiten bei den strukturellen Rahmenbedingungen
- 10.4.1 Gute Rahmenbedingungen für die Wirtschaft
- 10.4.2 Diskussion des Primats der Arbeit in der Gesellschaft
- 10.4.3 Poolfinanzierung "Berufliche Integration"
- 10.4.4 Berufsbildung neu denken
- 10.4.5 Ganzheitliche Sozialpolitik
- 10.1 Optimierungsmöglichkeiten bei den Sozialhilfebeziehenden
- 11 Empfehlungen und Schlussfolgerungen
- 11.1 Übersicht der Empfehlungen für die verschiedenen Akteure
- 11.2 Auf den Punkt gebracht
- 11.3 Grenzen der Arbeit
- 11.4 Paradigmenwechsel hin zu einer systemischen Lebenslaufperspektive
- 12 Literaturverzeichnis
- 13 Informationstools
- 13.1 Verzeichnis der Abkürzungen
- 13.2 Verzeichnis der Übersichten und Tabellen
- 14 Interviewleitfaden
- 15 Antwortraster Experteninterviews
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Dissertation befasst sich mit der Kompetenzentwicklung von langzeitarbeitslosen Sozialhilfebeziehenden in der Schweiz. Sie untersucht die Herausforderungen und Erfolgsfaktoren der beruflichen Integration dieser Personengruppe und analysiert die Wirksamkeit der bestehenden Massnahmen. Die Arbeit zielt darauf ab, Optimierungsmöglichkeiten für die verschiedenen Akteure im Integrationsprozess aufzuzeigen und Empfehlungen für eine nachhaltige und effektive Kompetenzentwicklung zu formulieren.
- Herausforderungen der beruflichen Integration von langzeitarbeitslosen Sozialhilfebeziehenden
- Wirksamkeit der bestehenden Massnahmen zur Kompetenzentwicklung
- Integrationshindernisse aus Sicht der Sozialhilfebeziehenden, des Arbeitsmarktes und der Sozialhilfe / Betreuung
- Erfolgsfaktoren für die berufliche Integration
- Optimierungsmöglichkeiten für die verschiedenen Akteure im Integrationsprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den Kontext von Ausbildung, Arbeitslosigkeit und Sozialhilfe und stellt die Herausforderungen für Menschen dar, die in diesen Bereichen Unterstützung benötigen. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Schweizer Berufsbildungssystem, seiner Organisationsstruktur, den pädagogischen Grundlagen und den Herausforderungen der Berufsbildung unter erschwerten Rahmenbedingungen. Das dritte Kapitel analysiert die Unterstützung von Arbeitslosen in der Schweiz, die Organisationsstruktur, die Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes, die arbeitsmarktlichen Massnahmen und die Folgen der Arbeitslosigkeit für die Betroffenen. Das vierte Kapitel widmet sich der Sozialhilfe in der Schweiz, der Organisation, den Merkmalen und der Lebenslage von Sozialhilfebeziehenden, den Massnahmen zur sozialen und beruflichen Integration sowie den Herausforderungen für Jugendliche und junge Erwachsene. Das fünfte Kapitel beschreibt das Untersuchungsdesign der Dissertation, die Auswahl der Fachstellen, die Durchführung von Experteninterviews, den Aufbau eines Materialienpools und die Anwendung der qualitativen Inhaltsanalyse. Die Kapitel 6, 7 und 8 präsentieren Fallbeispiele aus verschiedenen Kantonen der Schweiz, die sich mit der beruflichen Integration von langzeitarbeitslosen Sozialhilfebeziehenden befassen. Das neunte Kapitel analysiert die Wirksamkeit der Massnahmen zur beruflichen Integration und identifiziert Integrationshindernisse und Erfolgsfaktoren. Das zehnte Kapitel entwickelt Optimierungsmöglichkeiten für die verschiedenen Akteure im Integrationsprozess, die sich auf die Sozialhilfebeziehenden, den Arbeitsmarkt, die Sozialhilfe / Betreuung und die strukturellen Rahmenbedingungen beziehen. Das elfte Kapitel fasst die Empfehlungen und Schlussfolgerungen der Dissertation zusammen und beleuchtet die Grenzen der Arbeit sowie den Paradigmenwechsel hin zu einer systemischen Lebenslaufperspektive.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die berufliche Integration, Kompetenzentwicklung, Langzeitarbeitslosigkeit, Sozialhilfe, Integrationshindernisse, Erfolgsfaktoren, Optimierungsmöglichkeiten, Schweiz, Berufsbildungssystem, Arbeitsmarkt, Sozialhilfe / Betreuung, strukturelle Rahmenbedingungen, Lebenslaufperspektive.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die größten Integrationshindernisse für Langzeitarbeitslose in der Schweiz?
Dazu gehören fehlende berufliche Qualifikationen, gesundheitliche Belastungen, Vorurteile seitens der Arbeitgeber und komplexe administrative Hürden in der Sozialhilfe.
Welche Rolle spielt das Schweizer Berufsbildungssystem bei der Integration?
Das System bietet zwar hohe Standards, ist aber oft schwer zugänglich für Menschen ohne Schulabschluss oder mit veralteten Kompetenzen, weshalb neue Validierungsverfahren nötig sind.
Was versteht man unter dem „Paradigmenwechsel hin zu einer systemischen Lebenslaufperspektive“?
Es bedeutet, nicht nur die aktuelle Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, sondern die gesamte Biografie und Lebenslage des Klienten ganzheitlich und langfristig zu betrachten.
Wie können Unternehmen zur beruflichen Integration beitragen?
Durch gesellschaftliche Verantwortung, die Schaffung von Nischenarbeitsplätzen und die Teilnahme an Programmen wie „Supported Employment“.
Was sind Erfolgsfaktoren für arbeitsmarktliche Maßnahmen?
Wichtige Faktoren sind eine gute interinstitutionelle Zusammenarbeit, individuelle Standortbestimmungen und die Zertifizierung erworbener Kompetenzen.
- 9.1 Integrationshindernisse
- Quote paper
- Eveline Zurbriggen (Author), 2011, Kompetenzentwicklung mit langzeitarbeitslosen Sozialhilfebeziehenden in der Schweiz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184229