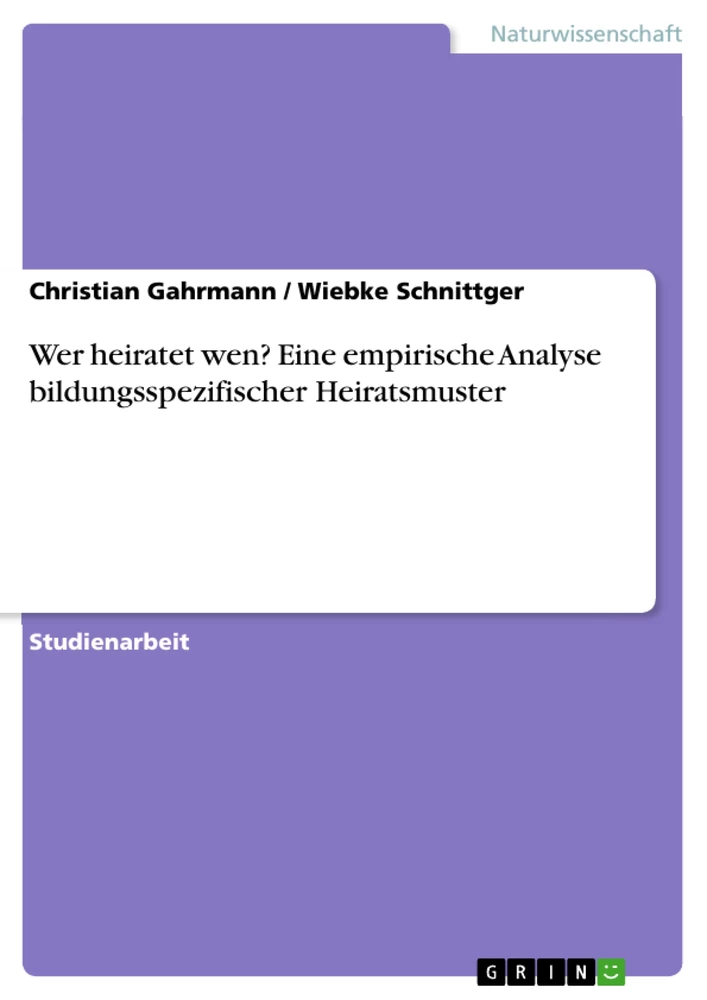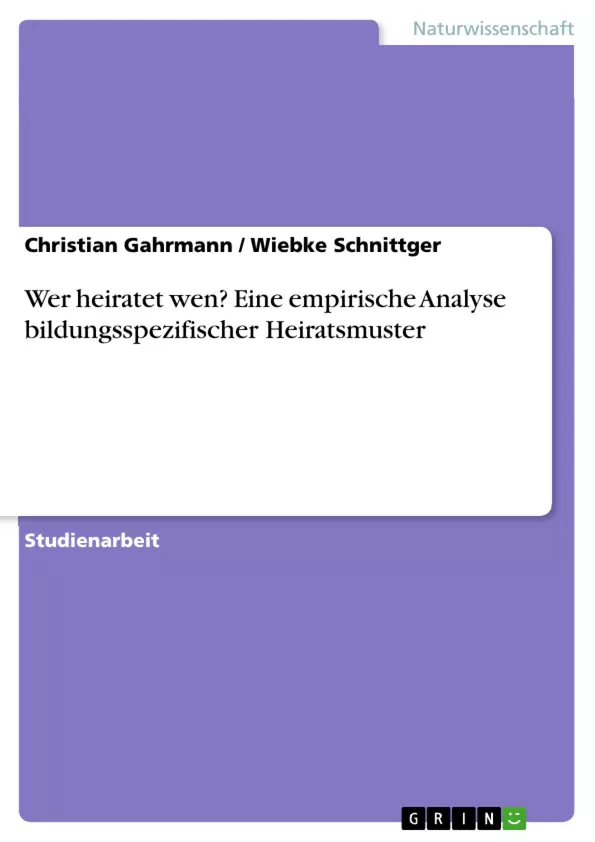Mit der Analyse bildungsspezifischer Heiratsmuster wollen wir untersuchen, inwieweit das Partnerwahlverhalten von dem Bildungsstand der Partner beeinflusst wird. Wir wollen der Frage nachgehen, ob und, wenn ja, welche Mechanismen dabei wirken und inwiefern dadurch das Partnermuster strukturiert wird.
Das Interesse an diesem Thema ergab sich zunächst aus der alltäglichen und individuellen Bedeutung, welche die Partnerwahl für die meisten Menschen hat. Jeder Mensch sammelt im Laufe seines Lebens Erfahrungen bei der Suche nach dem geeigneten Partner. Dabei ist im Selbstverständnis der meisten Menschen die Wahl eines Partners Ergebnis einer individuellen, durch das Gefühl der Liebe und Zuneigung bestimmten Entscheidung. Tatsächlich wird die Entscheidung jedoch nicht völlig losgelöst von sozialen Einflüssen und der Eingebundenheit von Menschen in soziale Kontexte sein. Die Frage, wie stark der soziale Einfluss der Bildung ist, soll Gegenstand unserer Analyse sein.
[...]
Die folgende Studie ist in vier große Kapitel gegliedert: Im folgenden 2. Kapitel werden die theoretischen Grundlagen gelegt. Die eigentliche Analyse beginnt mit dem 3. Kapitel, in dem mittels loglinearer Analyse das bildungsspezifische Partnerwahlverhalten in (Gesamt-)deutschland untersucht werden soll. In Kapitel 4 werden unterschiedliche Kontextfaktoren berücksichtigt: Im einzelnen soll betrachtet werden, ob sich das Partnerwahlverhalten junger Leute von älteren Personen unterscheidet, und ob sich zwischen Ost- und Westdeutschland Unterschiede ergeben. Erstmalig wird auch ein Vergleich zweier Partnerschaftsformen hergestellt - nämlich der traditionellen Hausfrauenehen mit moderneren Eheformen, in denen beide Partner berufstätig sind. Damit könnte u.a. die Frage beantwortet werden, ob sich ein verändertes - emanzipiertes - Rollenverständnis der Frau auch auf ihr Partnerwahlverhalten (in bezug auf die Bildung) auswirkt. Abschließend schauen wir im 5. Kapitel, welche Merkmale und Faktoren auf das bildungsspezifische Partnerwahlverhalten des einzelnen einwirken. Das geeignete statistische Verfahren hierzu wird die Diskriminanzanalyse sein.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Grundlagen und bisherige Forschungsergebnisse
- 2.1 Vorbemerkungen
- 2.2 Sozialtheoretische Modelle der Partnerwahl und deren bildungsbezogenen Implikationen
- 2.2.1 Normativer Ansatz
- 2.2.2 Rational-choice-Ansätze
- 2.2.2.1 Familienökonomischer Ansatz
- 2.2.2.2 Austauschtheorie
- 2.2.3 Strukturtheoretische Ansätze
- 2.2.3.1 Angebotsstrukturen des Heiratsmarktes
- 2.2.3.2 Teilheiratsmärkte
- 2.3 Empirische Ergebnisse bisheriger Studien
- 2.3.1 Deskriptive Analyse
- 2.3.2 Analyse dahinterliegender Mechanismen
- 2.3.3 Analyse unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kontextfaktoren
- 2.4 Diskussion der Ergebnisse im Lichte der theoretischen Modelle
- 3. Bildungsspezifische Partnerschaftsmuster in Deutschland
- 3.1 Vorbemerkungen
- 3.2 Beschreibung des Datensatzes
- 3.3 Bildungsklassifikation
- 3.4 Deskriptive Analyse
- 3.5 Loglineare Analyse
- 3.5.1 Statistisches Konzept loglinearer Modelle
- 3.5.2 Der Einfluss der Bildungsverteilung und die Unabhängigkeit der Partnerwahl
- 3.5.3 Strukturen der bildungsspezifischen Partnerwahl
- 3.5.4 Modellierung bildungsspezifischer Präferenzen
- 3.6 Ergebnis
- 4. Bildungsspezifische Partnerschaftsmuster im Vergleich
- 4.1 Vorbemerkungen
- 4.2 Räumlicher Vergleich: Paare aus Ost und West
- 4.3 Zeitlicher Vergleich: junge Paare – alte Paare
- 4.4 Sozialer Vergleich: Hausfrauenehe und Doppelverdiener
- 4.5 Ergebnis
- 5. Gruppenspezifische Betrachtung des Heiratsverhaltens: Aufwärtsheirat, Abwärtsheirat oder Homogamie
- 5.1 Vorbemerkungen
- 5.2 Statistisches Konzept der Diskriminanzanalyse
- 5.3 Durchführung der Diskriminanzanalyse
- 5.4 Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Studie untersucht den Einfluss des Bildungsstands auf das Partnerwahlverhalten. Es wird analysiert, ob und welche Mechanismen die Partnerwahl strukturieren und wie stark der soziale Einfluss der Bildung ist. Die gesellschaftliche Bedeutung von Heiratsmustern als Indikator für soziale Ungleichheit und gesellschaftliche Offenheit wird ebenfalls beleuchtet. Die Analyse basiert auf aktuellen Daten und erweitert die bisherigen Studien durch die Einbeziehung Gesamtdeutschlands.
- Einfluss des Bildungsstands auf die Partnerwahl
- Mechanismen der bildungsspezifischen Partnerwahl
- Bildung als Indikator für soziale Ungleichheit und gesellschaftliche Offenheit
- Räumliche und zeitliche Unterschiede im Partnerwahlverhalten
- Einfluss von Partnerschaftsmodellen (Hausfrauenehe vs. Doppelverdiener)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der bildungsspezifischen Heiratsmuster ein und betont die individuelle und gesellschaftliche Relevanz der Partnerwahl. Sie skizziert die Forschungslücke bestehender Studien (fokussiert auf Westdeutschland und veraltete Daten) und positioniert die vorliegende Arbeit als Erweiterung durch die Nutzung des Allbus-Datensatzes von 1998 und die Einbeziehung Gesamtdeutschlands. Die Bedeutung der Partnerwahl als Indikator für soziale Ungleichheit und gesellschaftliche Offenheit wird hervorgehoben.
2. Theoretische Grundlagen und bisherige Forschungsergebnisse: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Studie dar, indem es verschiedene sozialtheoretische Modelle der Partnerwahl (normativer Ansatz, Rational-Choice-Ansätze, strukturtheoretische Ansätze) und deren Implikationen für die bildungsspezifische Partnerwahl diskutiert. Weiterhin werden die empirischen Ergebnisse bisheriger Studien kritisch beleuchtet, wobei deskriptive Analysen und Analysen der zugrundeliegenden Mechanismen (Gelegenheitsstrukturen, Homogamie-, soziale Distanzen und Hypergamietendenzen) im Detail dargestellt werden. Die Analyse berücksichtigt unterschiedliche Kontextfaktoren (Ost/West-Vergleich, internationaler Vergleich, Alter, soziale Herkunft der Partner, Ehe vs. nichteheliche Lebensgemeinschaft) und setzt diese in Relation zu den vorgestellten theoretischen Modellen.
3. Bildungsspezifische Partnerschaftsmuster in Deutschland: In diesem zentralen Kapitel wird das bildungsspezifische Partnerwahlverhalten in Deutschland mittels loglinearer Analysen untersucht. Der Datensatz wird beschrieben, die Bildungsklassifikation erläutert und eine deskriptive Analyse durchgeführt. Es werden verschiedene loglineare Modelle (Unabhängigkeitsmodell, Linear-by-linear-Modell, Symmetrie-Modelle) geschätzt und deren Ergebnisse interpretiert, um den Einfluss der Bildungsverteilung und die Strukturen der bildungsspezifischen Partnerwahl zu beleuchten. Ein Schwerpunkt liegt auf der Modellierung bildungsspezifischer Präferenzen (Homogamie-, soziale Affinität- und Hypergamieeffekte).
4. Bildungsspezifische Partnerschaftsmuster im Vergleich: Dieses Kapitel vergleicht bildungsspezifische Partnerschaftsmuster unter Berücksichtigung verschiedener Kontextfaktoren. Es analysiert räumliche Unterschiede (Ost-West), zeitliche Unterschiede (junge vs. ältere Paare) und soziale Unterschiede (Hausfrauenehe vs. Doppelverdiener-Ehen) mittels loglinearer Modelle und deskriptiver Analysen. Der Fokus liegt auf der Identifizierung von Unterschieden im Partnerwahlverhalten und deren Interpretation im Hinblick auf die theoretischen Grundlagen.
5. Gruppenspezifische Betrachtung des Heiratsverhaltens: Aufwärtsheirat, Abwärtsheirat oder Homogamie: Dieses Kapitel wendet die Diskriminanzanalyse an, um die Faktoren zu identifizieren, welche das bildungsspezifische Partnerwahlverhalten beeinflussen. Es werden die Grundzüge der Diskriminanzanalyse erläutert, der Datensatz beschrieben und die Ergebnisse der Analyse interpretiert, um die Wahrscheinlichkeit von Aufwärts-, Abwärts- und Homogamen Heiraten zu bestimmen.
Schlüsselwörter
Partnerwahl, Bildung, Heiratsmuster, Soziale Ungleichheit, Homogamie, Heterogamie, Loglineare Analyse, Diskriminanzanalyse, Deutschland, Ost-West-Vergleich, Zeitlicher Vergleich, Hausfrauenehe, Doppelverdiener.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Bildungsspezifische Partnerschaftsmuster in Deutschland
Was ist der Gegenstand der Studie?
Die Studie untersucht den Einfluss des Bildungsstands auf das Partnerwahlverhalten in Deutschland. Sie analysiert die Mechanismen, die die Partnerwahl strukturieren, und die Bedeutung der Bildung als Indikator für soziale Ungleichheit und gesellschaftliche Offenheit. Ein besonderer Fokus liegt auf dem Vergleich von Ost- und Westdeutschland sowie jungen und älteren Paaren.
Welche theoretischen Modelle werden verwendet?
Die Studie stützt sich auf verschiedene sozialtheoretische Modelle der Partnerwahl, darunter den normativen Ansatz, Rational-Choice-Ansätze (familienökonomischer Ansatz und Austauschtheorie) und strukturtheoretische Ansätze (Angebotsstrukturen des Heiratsmarktes und Teilheiratsmärkte). Diese Modelle werden verwendet, um die empirischen Ergebnisse zu interpretieren und zu erklären.
Welche Daten werden verwendet?
Die Analyse basiert auf dem Allbus-Datensatz von 1998 und umfasst ganz Deutschland, im Gegensatz zu vielen früheren Studien, die sich auf Westdeutschland konzentrierten. Dies ermöglicht eine umfassendere Betrachtung der bildungsspezifischen Partnerschaftsmuster.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Studie verwendet sowohl deskriptive Analysen als auch multivariaten statistische Verfahren. Loglineare Analysen werden eingesetzt, um den Einfluss der Bildungsverteilung und die Strukturen der bildungsspezifischen Partnerwahl zu untersuchen. Die Diskriminanzanalyse dient der Identifizierung von Faktoren, die die Wahrscheinlichkeit von Aufwärts-, Abwärts- und Homogamen Heiraten beeinflussen.
Welche Kapitel umfasst die Studie?
Die Studie gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen und bisherige Forschungsergebnisse, Bildungsspezifische Partnerschaftsmuster in Deutschland, Bildungsspezifische Partnerschaftsmuster im Vergleich und Gruppenspezifische Betrachtung des Heiratsverhaltens: Aufwärtsheirat, Abwärtsheirat oder Homogamie. Jedes Kapitel behandelt spezifische Aspekte der Partnerwahl im Hinblick auf den Bildungsstand.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Studie präsentiert deskriptive Analysen der bildungsspezifischen Partnerwahl, Ergebnisse loglinearer Analysen zur Modellierung von Bildungspräferenzen (Homogamie, Hypergamie) und Ergebnisse der Diskriminanzanalyse zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Heiratsformen (Aufwärts-, Abwärts- und Homogamie). Die Ergebnisse werden im Kontext der verwendeten theoretischen Modelle interpretiert und im Hinblick auf räumliche (Ost/West), zeitliche (junge/alte Paare) und soziale (Hausfrauenehe/Doppelverdiener) Unterschiede verglichen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Studie?
Die Studie liefert Erkenntnisse über den Einfluss des Bildungsstands auf die Partnerwahl, die Mechanismen dahinter und die Rolle der Bildung als Indikator für soziale Ungleichheit und gesellschaftliche Offenheit in Deutschland. Die Ergebnisse tragen zum Verständnis der komplexen Zusammenhänge zwischen Bildung, Partnerwahl und gesellschaftlicher Struktur bei. Die genaue Interpretation der Schlussfolgerungen erfordert die Lektüre der vollständigen Studie.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie am besten?
Partnerwahl, Bildung, Heiratsmuster, Soziale Ungleichheit, Homogamie, Heterogamie, Loglineare Analyse, Diskriminanzanalyse, Deutschland, Ost-West-Vergleich, Zeitlicher Vergleich, Hausfrauenehe, Doppelverdiener.
- Citation du texte
- Christian Gahrmann (Auteur), Wiebke Schnittger (Auteur), 2001, Wer heiratet wen? Eine empirische Analyse bildungsspezifischer Heiratsmuster, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1844