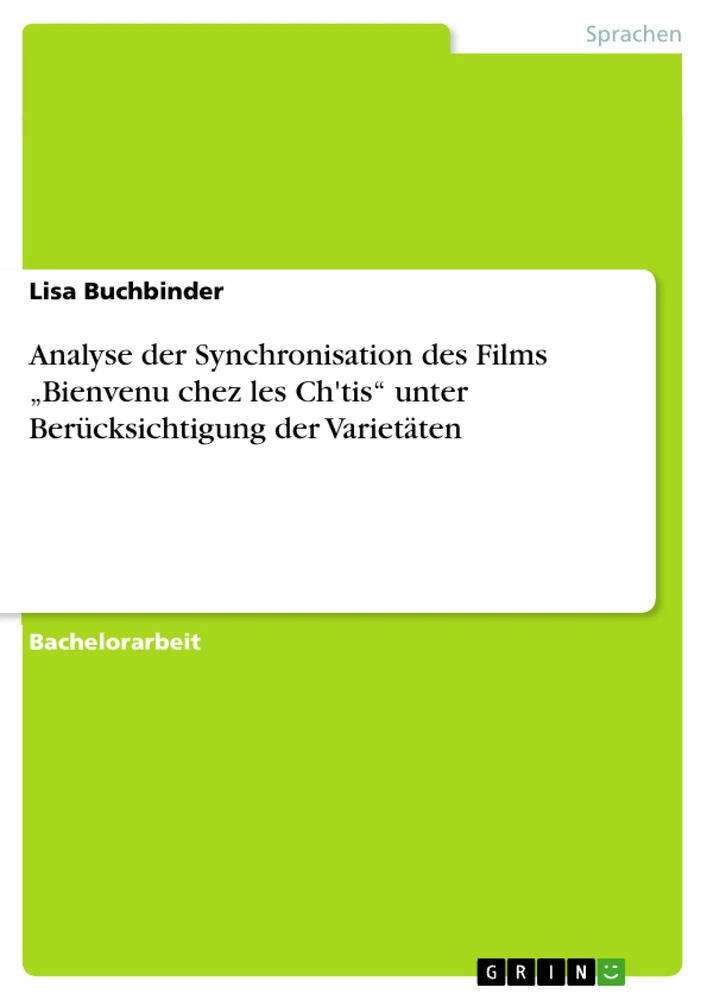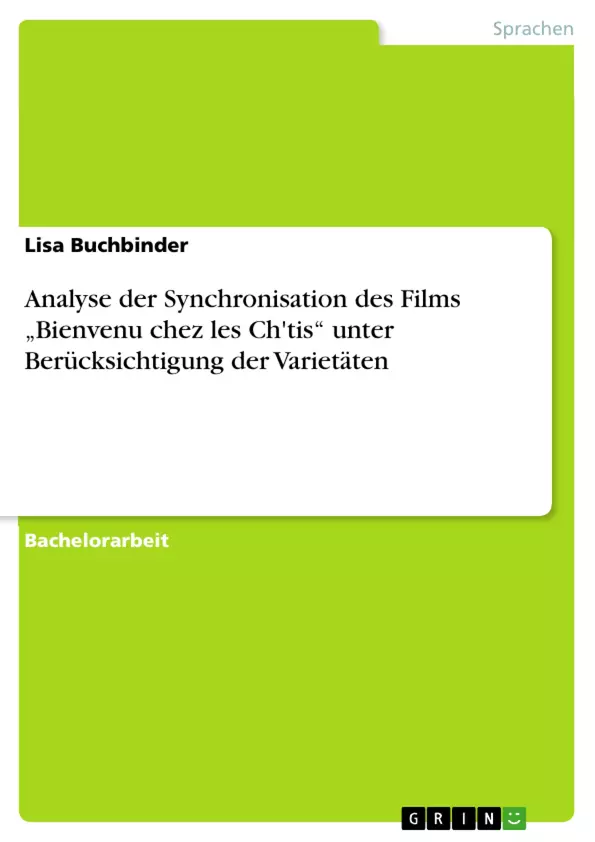Mit dieser Arbeit soll die Synchronisation des Films "Bienvenu chez les Ch'tis" analysiert werden. Der Fokus liegt dabei auf der Defnition der Synchronisation und dessen Rolle für die Übersetzung. Darüber hinaus wird die Synchronsation auf Grundlage der Varietäten (Diatopik, Diaphasik und Diastratik) von Coseriu ausgewertet werden.
Abschließend soll bewertet werden, inwiefern die Synchronisation den Varietäten gerecht wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Ziele der Arbeit
- 2 Definition des Begriffs Synchronisation
- 3 Synchronisation in Deutschland: früher und heute.
- 4 Synchronisationsprozess....
- 5 Allgemeine Merkmale der Synchronisation
- 5.1 Lippensynchronität.
- 5.1.1 Qualitative Lippensynchronität..
- 5.1.2 Quantitative Lippensynchronität.
- 5.2 Paralinguistische Synchronität.
- 6 Linguistische Aspekte der Synchronisation.......
- 6.1 Die Standardsprache
- 6.2 Der Varietätenraum
- 6.2.1 Diatopik....
- 6.2.2 Diastratik
- 6.2.3 Diaphasik.
- 6.3 Die Einordnung des Chti im Varietätenraum Frankreich....
- 6.3.1 Syntopische Einordnung.....
- 6.3.2 Synstratische Einordnung.
- 6.3.3 Symphasische Einordnung
- 6.4 Der Varietätenraum in Deutschland.
- 7 Filmübersetzung als kultureller Transfer........
- 7.1 Realien.....
- 7.2 Toponyme
- 7.3 Nachnamen
- 8 Synchronisationsanalyse des Films Bienvenue chez les Ch'tis
- 8.1 Analyse der synchrontechnischen Ebene
- 8.1.1 Lippensynchronität.
- 8.1.2 Paralinguistische Synchronität..
- 8.1 Analyse der synchrontechnischen Ebene
- 9 Analyse der Übersetzung des Films Bienvenue chez les Ch'tis
- 9.1 Inhalt des Films.
- 9.2 Die Rolle der Standardsprache…......
- 9.3 Übertragung der Diatopik .
- 9.4 Übertragung der Diastratik
- 9.5 Übertragung der Diaphasik
- 9.6 Übertragung der kulturspezifischen Elemente.....
- 9.6.1 Realien
- 9.6.2 Toponyme.....
- 9.6.3 Nachnamen
- 10 Schlussbemerkung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit analysiert die deutsche Synchronfassung des französischen Films „Bienvenue chez les Ch'tis“ und untersucht, inwieweit sie dem Original hinsichtlich Sprache, Lippensynchronität und Übertragung kulturspezifischer Elemente gerecht wird. Die Arbeit möchte herausfinden, wie die besonderen sprachlichen und kulturellen Besonderheiten der Chti-Region in der deutschen Synchronfassung wiedergegeben werden und welche Herausforderungen sich für die Übersetzerin und die Synchronregisseurin hierbei gestellt haben.
- Die Besonderheiten der Sprache und Kultur der Chtis im Film „Bienvenue chez les Ch'tis“
- Die Rolle der Standardsprache in der Übersetzung
- Die Übertragung von diatopischen, diastratischen und diaphasischen Merkmalen
- Die Übertragung von kulturspezifischen Elementen wie Realien, Toponymen und Nachnamen
- Die Rolle der Lippensynchronität und paralinguistischen Synchronität in der Übersetzung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsgegenstand und die Ziele der Arbeit erläutert. Anschließend werden die Begriffe „Synchronisation“ und „Varietätenraum“ definiert und im Kontext der deutschen und französischen Sprachlandschaft dargestellt. Dabei wird besonders auf die Besonderheiten des Chti-Dialekts und seine Einordnung im Varietätenraum Frankreich eingegangen. Anschließend werden die kulturspezifischen Elemente im Film, wie Realien, Toponyme und Nachnamen, analysiert. Der Hauptteil der Arbeit widmet sich der Analyse der deutschen Synchronfassung des Films „Bienvenue chez les Ch'tis“. Dabei werden die Lippensynchronität und die Übertragung der verschiedenen sprachlichen und kulturellen Aspekte des Films untersucht und mit dem französischen Original verglichen. Abschließend werden die Ergebnisse der Analyse zusammengefasst und eine Schlussfolgerung gezogen.
Schlüsselwörter
Synchronisation, Filmübersetzung, Chti, Nord-Pas-de-Calais, Varietätenraum, Diatopik, Diastratik, Diaphasik, Realien, Toponyme, Nachnamen, Lippensynchronität, Paralinguistische Synchronität
Häufig gestellte Fragen
Welche Herausforderungen bietet der Chti-Dialekt für die Synchronisation?
Da Chti ein spezifischer nordfranzösischer Dialekt ist, muss die Übersetzung entscheiden, ob ein deutscher Dialekt als Äquivalent genutzt wird oder eine Kunstsprache erfunden wird.
Was ist der Unterschied zwischen qualitativer und quantitativer Lippensynchronität?
Quantitative Synchronität achtet auf die Dauer der Lippenbewegung, während qualitative Synchronität die Übereinstimmung der Mundstellung bei Labialen (wie P, B, M) prüft.
Wie werden Realien und Toponyme im Film übersetzt?
Kulturspezifische Begriffe (Realien) und Ortsnamen (Toponyme) werden entweder beibehalten, angepasst oder durch deutsche Entsprechungen ersetzt, um den kulturellen Transfer zu ermöglichen.
Was bedeuten Diatopik, Diastratik und Diaphasik?
Diese Begriffe beschreiben sprachliche Varietäten nach Region (Diatopik), sozialer Schicht (Diastratik) und situativem Kontext (Diaphasik).
Wird die deutsche Fassung dem französischen Original gerecht?
Die Arbeit analysiert kritisch, ob der komische Effekt des Originals durch die gewählten synchrontechnischen und linguistischen Mittel im Deutschen erhalten bleibt.
- Citation du texte
- Lisa Buchbinder (Auteur), 2009, Analyse der Synchronisation des Films „Bienvenu chez les Ch'tis“ unter Berücksichtigung der Varietäten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184531