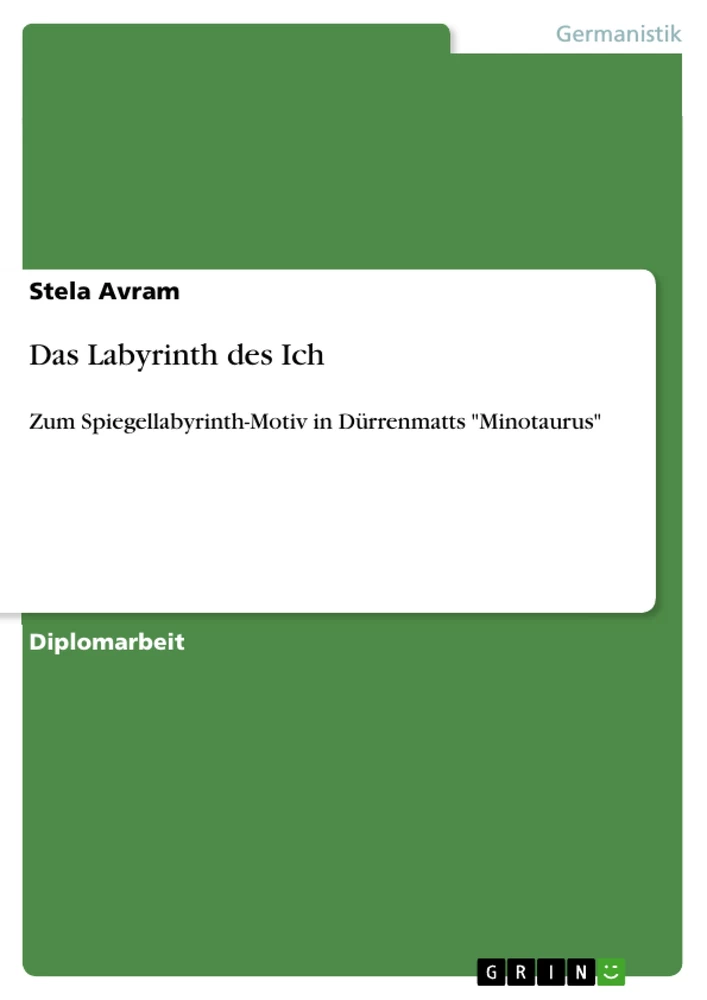Das klassische Labyrinth wird von Dürrenmatt in ein Spiegellabyrinth umgewandelt, in dem Minotaurus dazu verdammt ist, immer nur sich selbst zu begegnen. Das Spiegellabyrinth, das den Raum des Labyrinths und das Bild des Minotaurus ad infinitum widerspiegelt, wird für den Schweizer Schriftsteller zu einem ästhetischen Ausdrucksmittel für die Erkenntnis- und Metaphysikkritik.
Damit entspricht Dürrenmatt einer Tendenz der Postmoderne, die die Sinnpluralität und das Paradoxon der Welt in der bildhaften Form eines rhizomatischen Labyrinths hervorhebt. Im Unterschied zu dem Platonischen Paradigma, in dem die Reflexivität eine indirekte Erkenntnisform der transzendenten Welt der Ideen vermittelt, funktioniert die Reflexivität in der Dürrenmattschen Ballade als eine tautologische Erkenntnisform, die den Zugang zu einer echten Alterität verwehrt und dadurch jede Erkenntnismöglichkeit annulliert. Der reflexive Blick in den Spiegel verdeckt das Fehlen von Transzendenz und verwandelt dadurch das Spiegellabyrinth in einen Raum der reinen Immanenz.
Demzufolge verknüpft das Dürrenmattsche Spiegellabyrinth-Motiv die Erkenntnisskepsis der Platonischen Philosophie mit der existentialistischen Weltanschauung.Das Spiegellabyrinth verwandelt sich in ein Paradoxon, und zwar in einen Raum ohne Räumlichkeit, in einen Unraum, der die reine Projektion der ontologischen Lage seines Bewohners, eines Unwesens, ist.
Dadurch annulliert Dürrenmatt die Rolle des klassischen Labyrinths als Initiationsraum, der den Helden zur Selbsterkenntnis führt. Denn das Spiegellabyrinth ermöglicht nur eine illusorische Erleuchtung, in Form der fragmentierten, ständig unterbrochenen Entwicklungsversuche.Minotaurus versucht seine ontologische Lage zu überschreiten, aber die Grenzen seiner Natur sind ihm nicht bewusst. Deshalb projiziert er sie nach außen, in das Bild eines Feindes, den aber - wie Narcis - als eine Ich-Projektion anerkennt, ein Zeichen dafür, dass die Rebellion nur gegen sich selbst möglich ist.
Demzufolge hebt das Spiegellabyrinth-Motiv die existentielle Lage des Menschen in der Welt hervor: als “eine irrationale Rationalität” (Dürrenmatt: WA36, S.180) modelliert jedes Individuum für sich selbst eine Welt, deren Grenzen die Grenzen seines Ich sind. Der Mensch lebt - wie Minotaurus - in einem Spiegellabyrinth bzw. in einem Labyrinth des Ich, in dem alle anderen möglichen Welten integriert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- I. Theoretische Grundlagen
- I.1. Der Labyrinth-Mythos
- I.2. Dürrenmatts ästhetisches Credo
- II. Umdeutung des Mythos bei Dürrenmatt: Das Spiegellabyrinth
- II.1. Widerspiegelungen
- II.2. Indentitätsproblematik
- II.3. Rebellion
- II.4. Flucht aus dem Labyrinth
- III Zusammenfassung/Ausblick
- IV. Anhang
- V. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Analyse des Spiegellabyrinth-Motivs in Friedrich Dürrenmatts Ballade "Minotaurus". Ziel ist es, die Umdeutung des klassischen Labyrinth-Mythos in Dürrenmatts Werk zu untersuchen und die Aktualität des Motivs am Ende des 20. Jahrhunderts zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet die Ballade als eine literarische und zeichnerische Bearbeitung des Labyrinth-Motivs, die in einem philosophischen Kontext weiterentwickelt wird.
- Die Rolle des Spiegellabyrinths als Metapher für die menschliche Erkenntnis und Selbsterkenntnis
- Die Identitätsproblematik des Minotaurus im Spannungsfeld zwischen Tierischem und Menschlichem
- Die Bedeutung der Rebellion in der Entwicklung des Minotaurus und des Individuums
- Die Frage nach der Fluchtmöglichkeit aus dem Spiegellabyrinth und die Paradoxie des unüberwindbaren Raumes
- Die Verbindung von Sprache und Bildern in Dürrenmatts Ballade
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit legt die theoretischen Grundlagen für die Analyse des Spiegellabyrinth-Motivs. Es werden sowohl der Labyrinth-Mythos in der Postmoderne als auch Dürrenmatts ästhetisches Credo beleuchtet. Dabei werden die Aspekte hervorgehoben, die für die spätere Analyse des Spiegellabyrinth-Motivs relevant sind.
Das zweite Kapitel untersucht die Umdeutung des Labyrinths ins Spiegellabyrinth in Dürrenmatts "Minotaurus". Es werden die erkenntnistheoretischen Aspekte des Motivs, die Identitätsproblematik des Minotaurus, die Rolle der Rebellion und die Frage nach der Fluchtmöglichkeit aus dem Spiegellabyrinth analysiert.
Das dritte Kapitel bietet einen Ausblick auf die Ergebnisse der Untersuchung und die davon eröffneten Forschungsperspektiven. Es wird die Verwandlung des klassischen Mythos bei Dürrenmatt deutlich gemacht und die Zusammenhänge zwischen Sprache und Bildern in der Ballade beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Labyrinth-Mythos, Friedrich Dürrenmatt, "Minotaurus", Spiegellabyrinth, Erkenntnis, Selbsterkenntnis, Identität, Rebellion, Flucht, Sprache, Bilder, Postmoderne, Philosophie, Mythologie, Kunst.
Häufig gestellte Fragen zu Dürrenmatts „Minotaurus“
Wie deutet Dürrenmatt das klassische Labyrinth um?
Dürrenmatt verwandelt das Labyrinth in ein Spiegellabyrinth, in dem der Minotaurus nur noch seinen eigenen Reflexionen begegnet.
Was symbolisiert das Spiegellabyrinth?
Es ist eine Metapher für die menschliche Existenz als „Labyrinth des Ich“, in dem echte Selbsterkenntnis und der Zugang zu anderen durch ständige Selbstspiegelung erschwert werden.
Welche Identitätsproblematik hat der Minotaurus?
Er steht im Spannungsfeld zwischen Tier und Mensch und erkennt in seinen Spiegelbildern Feinde oder Freunde, ohne zu wissen, dass er es selbst ist.
Ist das Spiegellabyrinth ein Ort der Erkenntnis?
Nein, es ist eher ein Raum der reinen Immanenz und Erkenntnisskepsis, in dem jede Erleuchtung illusorisch bleibt.
Welche Rolle spielt die Rebellion in der Ballade?
Der Minotaurus versucht seine ontologische Lage zu überschreiten, aber seine Rebellion bleibt letztlich gegen sich selbst gerichtet.
- Citar trabajo
- Stela Avram (Autor), 2011, Das Labyrinth des Ich, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184929