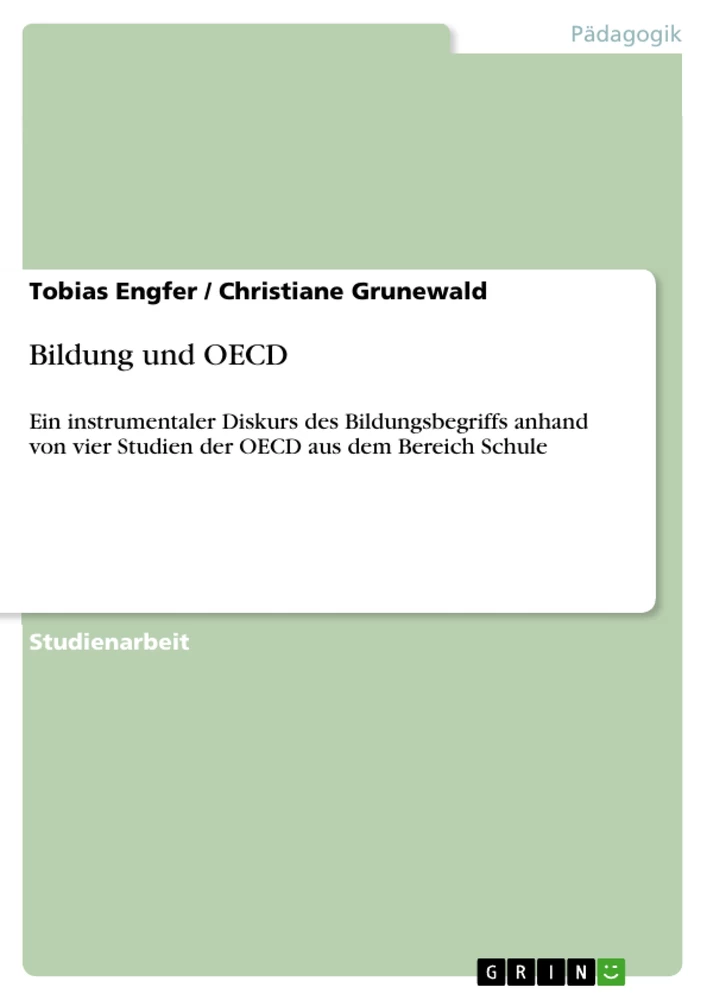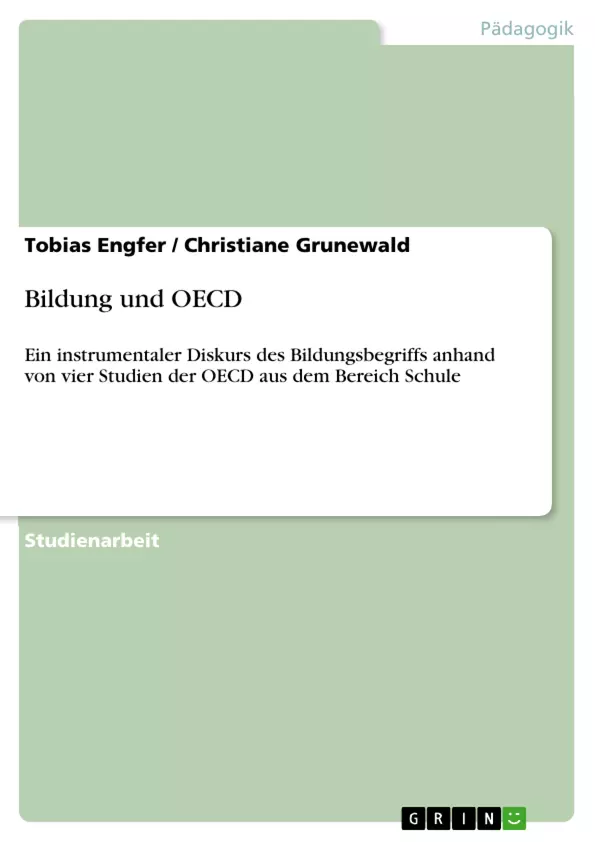Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern, sondern das Entzünden von Flammen.
Heraklit
Schon Heraklit hatte dieses Einsehen, was im Laufe von nahezu zweieinhalb tausend Jahren wieder verloren gegangen sein muss. Die Kritik an der deutschen Bildungspolitik ist laut und harsch zugleich. Geschossen wird dabei mit allerlei Argumenten aus den unterschiedlichsten Reihen. Zu starr und unflexibel seien die gegenwärtigen Strukturen. Zu segregativ und selektiv in viel zu jungen Jahren der Schülerschaft. Nicht integrativ und sowieso schon mal gar nicht fördernd (vgl. SpiegelOnline, 2007).
Richtig „angefeuert“ wurden diese ständigen Debatten durch den ersten PISA-Test im Jahre 2000. Das Land der „Dichter und Denker“ wurde degradiert und deplatziert. Die OECD hat, nach eigenen Maßstäben, bisher nicht erkannte schwer wiegende Diskrepanzen zu Tage gefördert und Nationen damit überrascht, erfreut und erschreckt.
Von diesem Zeitpunkt an, wurde fast buchstäblich der Begriff der Bildung neu gedacht. Viele Länder haben es sich seit 2000 zur Aufgabe gemacht, ihre Bildungssysteme zu reformieren und den sich verändernden Voraussetzungen einer stetig globaleren Weltgemeinschaft anzupassen.
Dabei war eine Variable von vornherein als gesetzt zu betrachten, nämlich die des Bildungsbegriffes. Fraglich bleibt ob man unter Bildung in England, Deutschland, den USA, Japan, China, Südafrika, Brasilien und viele andere Staaten, das gleiche versteht. Zudem ist ein weiterer fragwürdiger Gedanke, wie die OECD diesen Terminus näher bestimmt. Denn erst auf Grundlage einer deckungsgleichen Begrifflichkeit, kann und sollte ein adäquater Vergleich stattfinden. Bei den unzähligen Projekten, die sich innerhalb der OECD mit dem Thema Bildung beschäftigen, ist es umso interessanter, ob eben diese wenigstens das gleiche (Gesamt-)Ziel verfolgen.
In der vorliegenden Arbeit soll es genau darum gehen. Der Bildungsbegriff im Allgemeinen, spezieller auf Deutschland bezogen, und der von der OECD sollen betrachtet werden, nachdem im ersten Teil ein kurzer Abriss über die OECD und ihre Beschäftigung im Bildungssektor dargestellt wurde. Im sich anschließenden Teil sollen dann vier Instrumente (Erhebungen) näher vorgestellt werden, um im letzten Teil ein Resümee zu ziehen, ob sich eine Verbindung zwischen den beiden Bildungsbegriffen finden lässt und wenn ja, wie sie aussieht. Doch zunächst soll wie angesprochen, die OECD näher vorgestellt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wer ist die OECD?
- Allgemein
- Bildungsebene
- Bildungsbegriff
- Allgemein
- OECD
- Konstrukte
- PISA
- Allgemeines
- Ziele
- Methoden
- Ergebnisse
- Ausblick
- TALIS
- Allgemeines
- Ziele
- Methoden
- Ergebnisse
- Ausblick
- No more Failures. Ten Steps to Equity in Education.
- Allgemeines
- Ziele
- Methoden
- Ergebnisse
- Schooling for Tomorrow.
- Allgemeines
- Ziele
- Methoden
- Ergebnisse
- Ausblick
- Schlussbetrachtungen
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit dem Bildungsbegriff im Kontext der OECD und analysiert, wie dieser in vier Studien der Organisation zum Ausdruck kommt. Ziel ist es, die instrumentale Verwendung des Bildungsbegriffs in diesen Studien zu untersuchen und die Verbindung zwischen dem allgemeinen Bildungsbegriff und dem von der OECD verwendeten Begriff zu beleuchten.
- Die OECD als Organisation und ihre Rolle im Bildungsbereich
- Der Bildungsbegriff im Allgemeinen und im Kontext der OECD
- Die Analyse von vier OECD-Studien (PISA, TALIS, No more Failures, Schooling for Tomorrow)
- Die Verbindung zwischen dem allgemeinen Bildungsbegriff und dem von der OECD verwendeten Begriff
- Die Bedeutung der OECD-Studien für die Bildungspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Kritik an der deutschen Bildungspolitik im Kontext der OECD-Studien. Sie stellt die Frage nach der Vergleichbarkeit des Bildungsbegriffs in verschiedenen Ländern und die Bedeutung einer gemeinsamen Definition für die Vergleichbarkeit von Bildungssystemen.
Kapitel 2 gibt einen Überblick über die OECD, ihre Geschichte, ihre Ziele und ihre Arbeitsbereiche. Es wird die Bedeutung der OECD für die Bildungspolitik und die Förderung einer stärkeren, saubereren und faireren Weltwirtschaft hervorgehoben.
Kapitel 3 befasst sich mit dem Bildungsbegriff im Allgemeinen und im Kontext der OECD. Es werden die unterschiedlichen Perspektiven auf Bildung und die Bedeutung einer gemeinsamen Definition für die Vergleichbarkeit von Bildungssystemen diskutiert.
Kapitel 4 analysiert vier OECD-Studien (PISA, TALIS, No more Failures, Schooling for Tomorrow) und beleuchtet die jeweiligen Ziele, Methoden, Ergebnisse und den Einfluss auf die Bildungspolitik.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen den Bildungsbegriff, die OECD, PISA, TALIS, No more Failures, Schooling for Tomorrow, Bildungspolitik, Vergleichbarkeit von Bildungssystemen, internationale Bildungsstandards, Bildungsgerechtigkeit, Bildung für alle.
- Quote paper
- Tobias Engfer (Author), Christiane Grunewald (Author), 2011, Bildung und OECD, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/184990