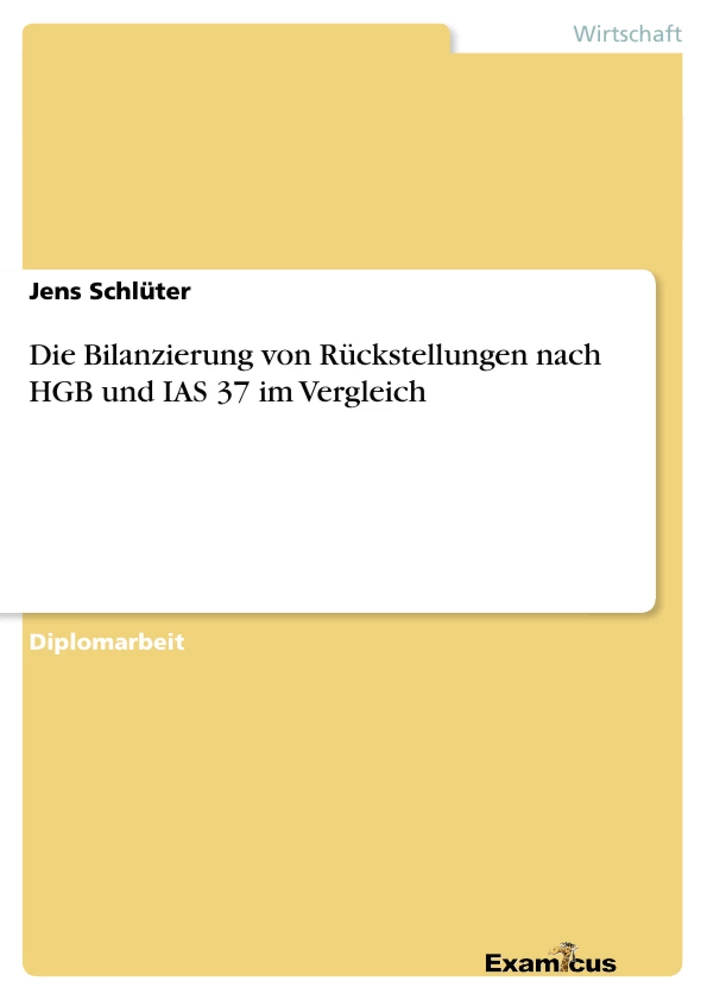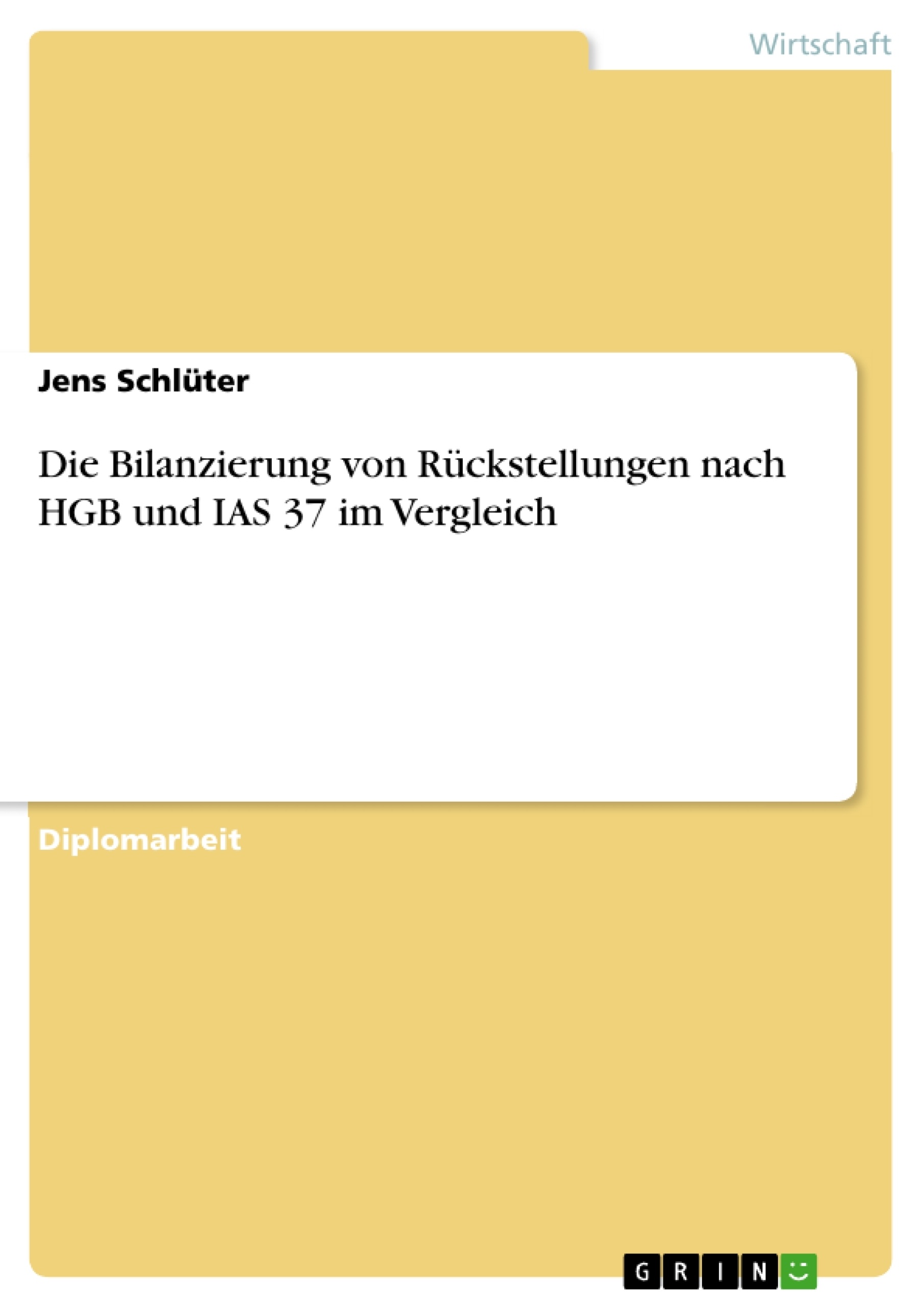„Accounting is often referred to as the language of business.“
Mit dieser Aussage weisen MUELLER/GERNON/MEEK der Rechnungslegung eine entscheidende Funktion im Wirtschaftsleben zu: sie dient als Kommunikationsmittel. Damit die Wirtschaftssubjekte und Teilnehmer am Wirtschaftsverkehr untereinander Informationen austauschen können, müssen sie eine gemeinsame Sprache sprechen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Verlauf der Untersuchung
- 2. Grundlagen für die Rückstellungsbilanzierung
- 2.1 Struktur, Zielsetzung und Aufbau der Rechnungslegung
- 2.2 Rechnungslegungsgrundsätze
- 2.3 Schulden
- 2.4 Rückstellungen
- 2.4.1 Definition und Arten
- 2.4.2 Überblick über die zulässigen Rückstellungen
- 2.4.3 Steuerliche Einflüsse auf die Rückstellungsbilanzierung
- 2.4.4 Abgrenzung von den Verbindlichkeiten
- 2.4.5 Abgrenzung von den Eventualverbindlichkeiten
- 3. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
- 3.1 Passivierungsvoraussetzungen nach dem HGB
- 3.1.1 Ansatz
- 3.1.2 Passivierungsvoraussetzungen nach den IAS
- 3.2 Bewertung
- 3.3 Auflösung und Verbrauch
- 3.1 Passivierungsvoraussetzungen nach dem HGB
- 4. Drohverlustrückstellungen
- 4.1 Ansatz
- 4.1.1 Passivierungsvoraussetzungen nach dem HGB
- 4.1.2 Passivierungsvoraussetzungen nach den IAS
- 4.2 Bewertung
- 4.3 Auflösung und Verbrauch
- 4.4 Abgrenzung von den ungewissen Verbindlichkeiten
- 4.1 Ansatz
- 5. Aufwandsrückstellungen
- 6. Besondere Rückstellungen
- 6.1 Steuerrückstellungen
- 6.2 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
- 6.3 Restrukturierungsrückstellungen
- 7. Ausweis und Berichterstattung
- 7.1 Ausweis in der Bilanz
- 7.2 Ausweis in der GuV
- 7.3 Berichterstattung im Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit dem Vergleich der Bilanzierung von Rückstellungen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Accounting Standards (IAS 37). Ziel ist es, die Unterschiede in den Ansatz- und Bewertungsmethoden aufzuzeigen und die Konsequenzen für die Darstellung im Jahresabschluss zu analysieren.
- Vergleich der Passivierungsvoraussetzungen nach HGB und IAS 37
- Unterschiede in der Bewertung von Rückstellungen
- Analyse der Auswirkungen auf den Jahresabschluss
- Spezifische Betrachtung verschiedener Rückstellungsarten
- Ausweis und Berichterstattung von Rückstellungen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein, beschreibt die Problemstellung des Vergleichs der Rückstellungsbilanzierung nach HGB und IAS 37 und skizziert den Aufbau und den Ablauf der Untersuchung. Sie dient als Orientierungshilfe für den Leser und umreißt die zentrale Fragestellung der Arbeit.
2. Grundlagen für die Rückstellungsbilanzierung: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für die Bilanzierung von Rückstellungen dar. Es behandelt die Struktur und Zielsetzung der Rechnungslegung, wichtige Rechnungslegungsgrundsätze, die Definition von Schulden und Rückstellungen, sowie die Abgrenzung von Rückstellungen zu Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten. Es liefert somit den notwendigen Kontext für das Verständnis der späteren Kapitel, die sich mit den spezifischen Bilanzierungsvorschriften befassen.
3. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten: Dieses Kapitel analysiert detailliert die Passivierungsvoraussetzungen und Bewertungsmethoden für Rückstellungen ungewisser Verbindlichkeiten nach HGB und IAS 37. Es vergleicht die Kriterien für den Ansatz (Bestehen einer Verpflichtung, wirtschaftliche Verursachung, Ungewissheit der Verbindlichkeit, Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme etc.) und die Bewertungsmethoden (vernünftige kaufmännische Beurteilung vs. Best Estimate). Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen Anforderungen und deren Konsequenzen für die Bilanzierung.
4. Drohverlustrückstellungen: Dieses Kapitel widmet sich den Drohverlustrückstellungen und behandelt die jeweiligen Passivierungsvoraussetzungen und Bewertungsmethoden nach HGB und IAS 37. Es wird die Abgrenzung zu ungewissen Verbindlichkeiten erläutert und die Unterschiede in der Behandlung dieser Rückstellungsart unter den beiden Regelwerken herausgearbeitet. Dies beinhaltet auch eine Auseinandersetzung mit den jeweiligen Kriterien für Ansatz und Bewertung.
5. Aufwandsrückstellungen: In diesem Kapitel werden die Aufwandsrückstellungen im Rahmen des HGB und der IAS 37 untersucht. Es wird ein Überblick über die jeweiligen Regelungen gegeben und die Konsequenzen der unterschiedlichen Bilanzierungsmethoden analysiert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Abgrenzung dieser Rückstellungen von den Verbindlichkeitsrückstellungen.
6. Besondere Rückstellungen: Dieses Kapitel behandelt spezielle Rückstellungsarten, darunter Steuerrückstellungen (für entstandene Steuerschulden und latente Steuern), Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie Restrukturierungsrückstellungen. Für jede Rückstellungsart werden die Bilanzierung nach HGB und IAS 37 im Detail erklärt und verglichen, inklusive der Berücksichtigung von Innenverpflichtungen (bei Restrukturierungsrückstellungen).
7. Ausweis und Berichterstattung: Das Kapitel beschreibt den Ausweis von Rückstellungen in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Berichterstattung im Anhang. Es erläutert die notwendigen qualitativen und quantitativen Angaben und die Bedeutung der Schutzklausel. Es fasst die wichtigsten Punkte bezüglich der Transparenz und der Informationspflichten für den Jahresabschluss zusammen.
Schlüsselwörter
Rückstellungen, HGB, IAS 37, Bilanzierung, Passivierung, Bewertung, ungewisse Verbindlichkeiten, Drohverlustrückstellungen, Aufwandsrückstellungen, Steuerrückstellungen, Pensionen, Restrukturierung, Jahresabschluss, Rechnungslegung.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Vergleich der Rückstellungsbilanzierung nach HGB und IAS 37
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit vergleicht die Bilanzierung von Rückstellungen nach dem Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Accounting Standards (IAS 37). Sie untersucht die Unterschiede in den Ansatz- und Bewertungsmethoden und analysiert die Konsequenzen für die Darstellung im Jahresabschluss.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Rückstellungsbilanzierung, darunter den Vergleich der Passivierungsvoraussetzungen nach HGB und IAS 37, die Unterschiede in der Bewertung von Rückstellungen, die Auswirkungen auf den Jahresabschluss, spezifische Betrachtung verschiedener Rückstellungsarten (z.B. ungewisse Verbindlichkeiten, Drohverlustrückstellungen, Aufwandsrückstellungen, Steuerrückstellungen, Pensionen, Restrukturierungsrückstellungen) und den Ausweis und die Berichterstattung von Rückstellungen.
Welche Arten von Rückstellungen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Arten von Rückstellungen, inklusive Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, Drohverlustrückstellungen, Aufwandsrückstellungen, und besondere Rückstellungen wie Steuerrückstellungen, Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sowie Restrukturierungsrückstellungen.
Wie werden die Unterschiede zwischen HGB und IAS 37 dargestellt?
Die Arbeit vergleicht die Ansatz- und Bewertungsmethoden für jede Rückstellungsart nach HGB und IAS 37 im Detail. Die Unterschiede in den Passivierungsvoraussetzungen und deren Auswirkungen auf die Bilanzierung werden analysiert.
Welche Aspekte des Jahresabschlusses werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert den Ausweis von Rückstellungen in der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Berichterstattung im Anhang gemäß HGB und IAS 37. Die Bedeutung der Transparenz und der Informationspflichten wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rückstellungen, HGB, IAS 37, Bilanzierung, Passivierung, Bewertung, ungewisse Verbindlichkeiten, Drohverlustrückstellungen, Aufwandsrückstellungen, Steuerrückstellungen, Pensionen, Restrukturierung, Jahresabschluss, Rechnungslegung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Grundlagen der Rückstellungsbilanzierung, Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, Drohverlustrückstellungen, Aufwandsrückstellungen, Besondere Rückstellungen und Ausweis und Berichterstattung. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Rückstellungsbilanzierung und vergleicht die Regelungen nach HGB und IAS 37.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die Unterschiede in der Bilanzierung von Rückstellungen nach HGB und IAS 37 aufzuzeigen und die Konsequenzen für die Darstellung im Jahresabschluss zu analysieren.
- Citation du texte
- Jens Schlüter (Auteur), 1999, Die Bilanzierung von Rückstellungen nach HGB und IAS 37 im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185371