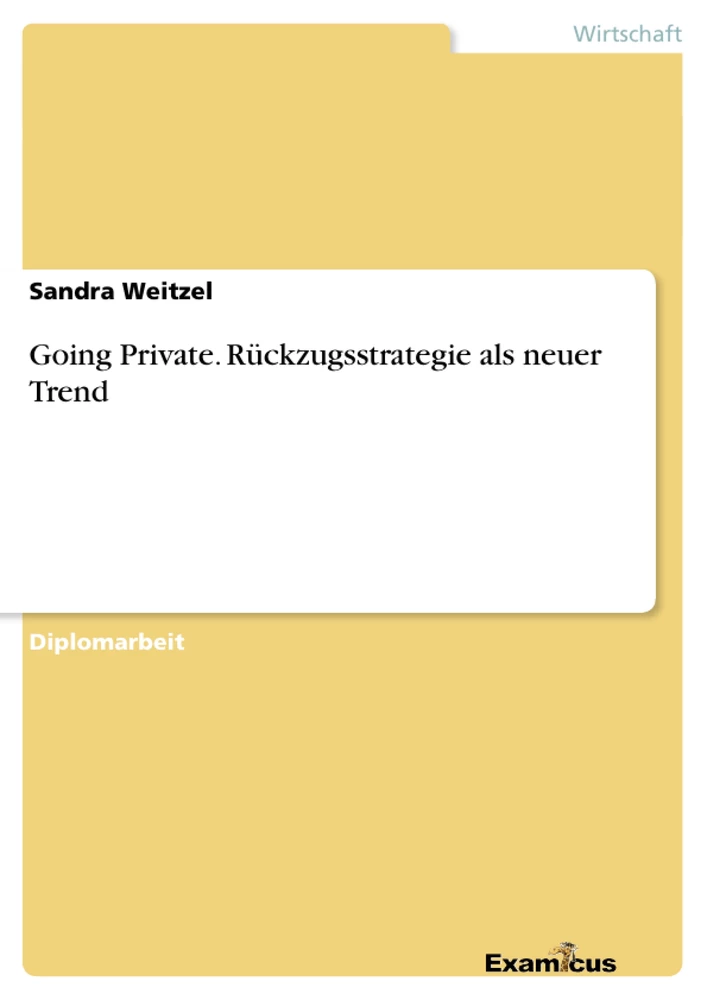Going Private bezeichnet die Überführung einer an den Aktienmärkten gehandelten Gesellschaft („public company“) in ein nicht börsengelistetes „privates“ Unternehmen („private company“). Damit ist ein Going Private (Börsenrückzug) eine dem Going Public (Börsengang) genau entgegengesetzte Kapitalmarkttransaktion.
Der Erfolg des Neuen Markts löste einen Boom der Börsengänge aus. Die Kapitalbeschaffungs-, Bewertungs- und Liquiditätsfunktion der Börse locken fast täglich ein Unternehmen in die unterschiedlichen Börsensegmente. Eine Rückzugsstrategie von den deutschen Aktienmärkten haben aber erst wenige Gesellschaften für sich entdeckt. Während Going Private auf angelsächsischen Kapitalmärkten schon eine hundertjährige, volumenstarke Tradition haben , ist der Rückzug aus der Börsennotierung auf deutschen Aktienmärkten noch eine Rarität. Zwei aktuelle Beispiele für Going Private sind die Umwandlung der Honsel AG in eine Kommanditgesellschaft oder der Aktienrückkauf der Friedrich Grohe AG.
Die Definition des Going Private macht im Rahmen des derzeitigen „Going Public-Fiebers“ neugierig auf eine Diskussion der Gründe, Gestaltungsmöglichkeiten und Zukunftschancen dieses Phänomens.
Das Entscheidungsproblem jeder börsennotierten Gesellschaft ist, zwischen der Fortführung ihrer Börsennotiz und einem Going Private abzuwägen. Keine Unternehmensstruktur sollte als Dauerlösung verstanden werden, sondern sich ständig kritischer Überprüfung − und eventuell eben auch einem Wandel − unterziehen. Hintergrund des Entscheidungsproblems ist eine Analyse, ob Kosten und Nutzen einer Börsenpräsenz noch in einem sinnvollen Verhältnis zueinander stehen. Hierfür können Kapitalstruktur, steuerliche Situation, Eigentümerstruktur, Unternehmenswert, Wettbewerbssituation oder Nachfolgeregelungen als Beurteilungskriterien dienen. Dabei kann es durchaus sinnvoll sein, auf ein Going Private nach einer Zeitspanne von ca. fünf Jahren eine erneute Börsenplatzierung folgen zu lassen.
Diese Arbeit greift das Entscheidungsproblem börsennotierter Gesellschaften auf und stellt das Going Private als Rückzugsstrategie vor. Diese Strategie ist durch ein weites Feld von Entscheidungsbausteinen charakterisiert. Ziel ist es, den Börsenrückzug mit seinen Hintergründen, Entscheidungsparametern, Ausprägungsformen und gesellschafts- und steuerrechtlichen Regelungen als Kapitalmarktmaßnahme in einem Über-blick zu beleuchten.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Vorstellung und Systematisierung der Arbeit
- 1.1 Going Private als Entscheidungsproblem
- 1.2 Gang der Untersuchung in Anlehnung an den Ablauf eines Going Private
- 1.3 Begriffsabgrenzung
- 2 Gründe für ein Going Private
- 2.1 Kostenvermeidung einer Börsennotierung und Funktionslosigkeit des Listing
- 2.2 Verringerung der Agency-Kosten und Profitabilitätssteigerung
- 2.3 Präventive Maßnahme gegen feindliche Übernahmen
- 2.4 Verbesserter Zugriff auf Vermögen und Liquidität
- 2.5 Verdrängen von Minderheitsaktionären (Squeeze-Out)
- 2.6 Steuervorteile durch Schuldzinsabzug und erhöhte Abschreibung
- 2.7 Abgrenzung der Vorteile von Nachteilen eines Going Private
- 3 Entscheidungsfelder einer Going Private Transaktion
- 3.1 Formen von Going Private in Abhängigkeit der Investorengruppe
- 3.1.1 Maßgeblicher Einfluß des Managements
- 3.1.2 Maßgeblicher Einfluß anderer Parteien
- 3.2 Charakteristika eines Going Private Kandidaten
- 3.3 Finanzierung einer Going Private Transaktion
- 3.3.1 Strukturierung der Finanzierung
- 3.3.2 Eigenkapital
- 3.3.3 Fremdkapital
- 3.3.3.1 Vorrangig besicherte Kredite als Baustein der Finanzierung
- 3.3.3.2 Mezzanine-Kapital als Baustein der Finanzierung
- 3.3.3.3 Besicherung und Tilgung des Fremdkapitals
- 3.3.3.4 Strip Financing
- 4 Ausprägungen von Going Private und steuerliche Wirkungen
- 4.1 Delisting
- 4.2 Aktienrückkauf
- 4.3 Kapitalherabsetzung und Aktienzusammenlegung (Reverse-stock-split)
- 4.4 Share Deal, Asset Deal und Kombinationsmodell
- 4.4.1 Interessenfelder der am Unternehmenskauf beteiligten Parteien
- 4.4.2 Share Deal
- 4.4.3 Asset Deal
- 4.4.4 Kombinationsmodell
- 4.4.5 Mitunternehmermodell
- 4.4.6 Umgekehrtes Kombinationsmodell
- 4.5 Umwandlung
- 4.5.1 Formwechsel in eine GmbH
- 4.5.2 Formwechsel in eine GmbH & Co. KG
- 4.5.3 Formwechsel in eine KGaA
- 4.6 Going Private Merger (Fusion)
- 4.6.1 Eingliederung nach AktG
- 4.6.2 Verschmelzung auf die Erwerbergesellschaft
- 4.6.2.1 Verschmelzung auf eine Kapitalgesellschaft
- 4.6.2.2 Verschmelzung auf eine Personengesellschaft
- 4.7 Abschließende Betrachtung der Techniken
- 5 Ausblick
- Going Private Kandidat: Schmalbach-Lubeca AG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht das Going Private als strategische Entscheidung für Unternehmen. Ziel ist es, die verschiedenen Aspekte und Entscheidungsfelder einer Going Private Transaktion zu beleuchten und zu analysieren. Die Arbeit betrachtet dabei unterschiedliche Ausprägungen und Finanzierungsformen sowie die steuerlichen Implikationen.
- Analyse der Gründe für ein Going Private
- Untersuchung verschiedener Formen des Going Private
- Bewertung der Finanzierungsaspekte einer Going Private Transaktion
- Behandlung der steuerlichen Auswirkungen
- Fallstudie: Schmalbach-Lubeca AG
Zusammenfassung der Kapitel
1 Vorstellung und Systematisierung der Arbeit: Dieses einführende Kapitel beschreibt den Gegenstand der Arbeit, das Going Private, und skizziert den methodischen Ansatz. Es definiert den Begriff "Going Private" und grenzt ihn von anderen Unternehmensaktivitäten ab. Das Kapitel erläutert den Aufbau der Arbeit und legt den Fokus auf die verschiedenen Entscheidungsfelder und die methodische Vorgehensweise.
2 Gründe für ein Going Private: Dieses Kapitel untersucht die vielfältigen Motive, die Unternehmen zum Going Private bewegen. Es werden sowohl finanzielle Aspekte wie Kostenreduktion durch den Verzicht auf die Börsennotierung, die Senkung von Agency-Kosten und die Steigerung der Profitabilität behandelt, als auch strategische Überlegungen, z.B. die Abwehr feindlicher Übernahmen. Die Kapitel analysiert den verbesserten Zugriff auf Vermögen und Liquidität sowie die Möglichkeit, Minderheitsaktionäre zu verdrängen und Steuervorteile zu nutzen. Die Vor- und Nachteile werden gegeneinander abgewogen.
3 Entscheidungsfelder einer Going Private Transaktion: Dieser Abschnitt befasst sich eingehend mit den zentralen Entscheidungsfeldern im Going-Private-Prozess. Es werden verschiedene Formen des Going Private abhängig von der beteiligten Investorengruppe (Management vs. Externe) untersucht und die Charakteristika eines geeigneten Kandidaten für ein Going Private analysiert. Ein wichtiger Aspekt ist die detaillierte Betrachtung der Finanzierungsstrategien, einschließlich Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung sowie der Strukturierung der Finanzierung.
4 Ausprägungen von Going Private und steuerliche Wirkungen: Dieses Kapitel beleuchtet die verschiedenen Ausprägungen von Going Private-Transaktionen, wie Delisting, Aktienrückkauf, Kapitalherabsetzung und Aktienzusammenlegung. Es beschreibt die verschiedenen Deal-Strukturen (Share Deal, Asset Deal, Kombinationsmodelle) und analysiert deren steuerliche Konsequenzen. Die verschiedenen Umwandlungsformen (z.B. in GmbH, GmbH & Co. KG, KGaA) werden im Detail erörtert, ebenso wie die steuerlichen Implikationen von Fusionen im Kontext des Going Private.
Schlüsselwörter
Going Private, Delisting, Aktienrückkauf, Finanzierung, Agency-Kosten, feindliche Übernahmen, Squeeze-Out, Steuervorteile, Aktiengesellschaft, GmbH, GmbH & Co. KG, KGaA, Fusion, Merger, Share Deal, Asset Deal, Finanzierungsstrukturen, Unternehmensbewertung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Going Private
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht das Going Private als strategische Entscheidung für Unternehmen. Im Fokus stehen die verschiedenen Aspekte und Entscheidungsfelder einer Going-Private-Transaktion, inklusive unterschiedlicher Ausprägungen, Finanzierungsformen und steuerlicher Implikationen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die Gründe für ein Going Private, untersucht verschiedene Formen des Going Private, bewertet die Finanzierungsaspekte, behandelt die steuerlichen Auswirkungen und beinhaltet eine Fallstudie zur Schmalbach-Lubeca AG. Spezifische Themen umfassen Kostenvermeidung durch Börsennotierung, Senkung von Agency-Kosten, Abwehr feindlicher Übernahmen, verbesserter Zugriff auf Vermögen und Liquidität, Verdrängung von Minderheitsaktionären (Squeeze-Out), Steuervorteile, verschiedene Deal-Strukturen (Share Deal, Asset Deal, Kombinationsmodelle) und Umwandlungsformen (GmbH, GmbH & Co. KG, KGaA).
Welche Arten von Going Private werden unterschieden?
Die Arbeit differenziert Going Private nach der beteiligten Investorengruppe (Management vs. Externe) und beschreibt verschiedene Ausprägungen wie Delisting, Aktienrückkauf, Kapitalherabsetzung, Aktienzusammenlegung (Reverse-stock-split), Share Deal, Asset Deal, Kombinationsmodelle und Going Private Merger (Fusionen).
Welche Finanzierungsaspekte werden beleuchtet?
Die Arbeit analysiert detailliert die Finanzierungsstrategien einer Going Private Transaktion, einschließlich Eigen- und Fremdkapitalfinanzierung (vorrangig besicherte Kredite, Mezzanine-Kapital, Strip Financing) und der Strukturierung der Finanzierung.
Welche steuerlichen Auswirkungen werden betrachtet?
Die steuerlichen Konsequenzen der verschiedenen Deal-Strukturen und Umwandlungsformen werden eingehend untersucht, einschließlich der Implikationen von Fusionen im Kontext des Going Private.
Welche Fallstudie wird präsentiert?
Die Arbeit enthält eine Fallstudie zur Schmalbach-Lubeca AG, die den praktischen Aspekt des Going Private verdeutlicht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Going Private, Delisting, Aktienrückkauf, Finanzierung, Agency-Kosten, feindliche Übernahmen, Squeeze-Out, Steuervorteile, Aktiengesellschaft, GmbH, GmbH & Co. KG, KGaA, Fusion, Merger, Share Deal, Asset Deal, Finanzierungsstrukturen, Unternehmensbewertung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel gegliedert, beginnend mit einer Einführung und Systematisierung, gefolgt von Kapiteln zu den Gründen für ein Going Private, den Entscheidungsfeldern, den Ausprägungen und steuerlichen Wirkungen sowie einem Ausblick. Ein Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Abschnitte.
- Citar trabajo
- Sandra Weitzel (Autor), 2000, Going Private. Rückzugsstrategie als neuer Trend, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185442