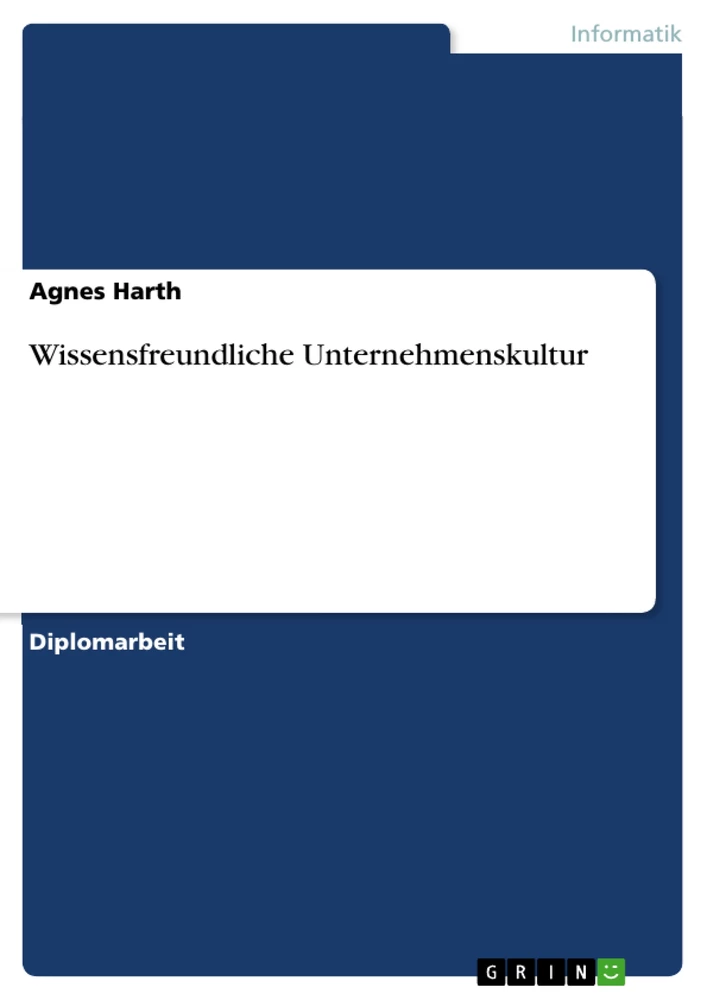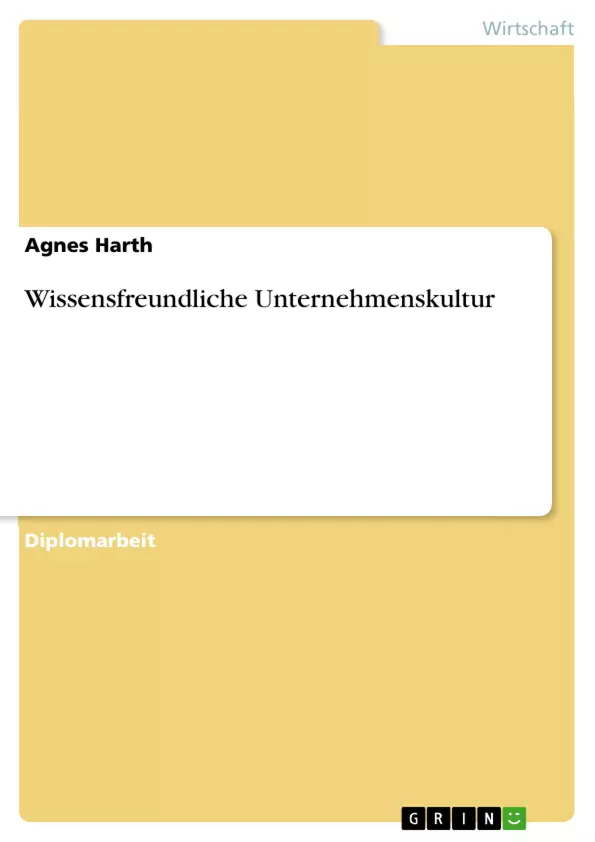In den siebziger Jahren erschien das zweite Hauptwerk zum sozioökonomischen Wandel, Daniel Bells “Die nachindustrielle Gesellschaft”. Als Kennzeichen der postindustriellen Gesellschaft nennt er neben dem zunehmenden Übergewicht der Dienstleistungswirtschaft über die produzierende Wirtschaft die zentrale Stellung des theoretischen Wissens. Die Hauptursache für den Übergang von der industriellen zur postindustriellen Gesellschaft ist seiner Ansicht nach ein Wandel in der Art des Wissens in Richtung auf eine Kodifizierung des theoretischen Wissens.
Sowohl Bell als auch Fourastié schildern wichtige Teilaspekte der Wissensgesellschaft. Allerdings stecken beide den Rahmen zu eng. Die Wissensgesellschaft umfasst mehr Wissensbereiche und Wirtschaftssektoren als von ihnen angenommen. Bells Hervorhebung des “theoretischen Wissens”, also des wissenschaftlichen Wissens, führt dazu, dass die von ihm geschilderte postindustrielle Gesellschaft eher als Wissenschaftsgesellschaft denn als Wissensgesellschaft zu bezeichnen wäre. Damit erkennt er zwar die zukunftsträchtige Rolle der wissensbasierten Technologie und technikrealisierten Wissenschaft, aber sieht die fast noch größere Transformationskraft der Informations- und Telekommunikationstechnologien in den außerwissenschaftlichen Anwendungsfeldern nicht.
Die Wissensgesellschaft beschränkt sich auch nicht auf den von Fourastié betonten Dienstleistungssektor. Zwar ist im tertiären Sektor der Prozess, der die Wissensgesellschaft charakterisiert, nämlich dass Wissen zum zentralen Element des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens wird, besonders stark im Gange.
Aber auch im primären und sekundären Sektor kommt es zu einer Verlagerung der wertschöpfenden Tätigkeiten von der Hand- zur Kopfarbeit. Im Gegensatz zum intersektoriellen Strukturwandel zur Dienstleistungsgesellschaft ist der Strukturwandel zur Wissensgesellschaft metasektoriell.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Bedeutung einer wissensfreundlichen Unternehmenskultur
- 1.1 Wissensgesellschaft
- 1.1.1 Abgrenzung von der Dienstleistungs- und Wissenschaftsgesellschaft
- 1.1.2 Wirkfaktoren und Entwicklungsstand
- 1.2 Bedeutung des Wissens in der Wirtschaft
- 1.2.1 Wissen als Produktionsfaktor
- 1.2.2 Wissen als Wettbewerbsfaktor
- 1.2.3 Wissen als immaterielles Vermögen
- 1.3 Bedeutung der Unternehmenskultur im Wissensmanagement
- 2 Grundlegende Begriffe und Konzepte
- 2.1 Kultur
- 2.1.1 Begriff der Kultur
- 2.1.2 Teilbereiche der Kultur
- 2.1.3 Ebenen der Kultur
- 2.2 Unternehmenskultur
- 2.2.1 Zusammenhang zwischen Kultur und Unternehmenskultur
- 2.2.2 Variablenansatz versus Metaphernansatz
- 2.2.3 Drei-Ebenen-Modell von Schein
- 2.3 Wissen
- 2.3.1 Abgrenzung von Daten und Informationen
- 2.3.2 Arten von Wissen
- 2.3.3 Organisationale Wissensbasis
- 2.4 Wissensmanagement
- 2.4.1 Ebenen des Wissensmanagements
- 2.4.2 Bausteine des Wissensmanagements
- 2.4.3 Dimensionen des Wissensmanagements
- 2.5 Wissensfreundliche Unternehmenskultur
- 3 Wissensfreundliche Unternehmenskultur
- 3.1 Wissensfreundliche Artefakte und Schöpfungen
- 3.1.1 Organisation
- 3.1.2 Personal
- 3.1.3 Infrastruktur
- 3.1.4 Instrumente
- 3.2 Wissensfreundliche Werte
- 3.2.1 Wissen
- 3.2.2 Offenheit
- 3.2.3 Vertrauen
- 3.2.4 Gemeinschaft
- 3.3 Wissensfreundliche Grundannahmen
- 4 Veränderung hin zu einer wissensfreundlichen Unternehmenskultur
- 4.1 Veränderbarkeit der Unternehmenskultur
- 4.2 Veränderungsmanagement
- Literaturverzeichnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Bedeutung einer wissensfreundlichen Unternehmenskultur. Ziel ist es, die Relevanz von Wissen in der heutigen Wissensgesellschaft aufzuzeigen und die Rolle der Unternehmenskultur im Wissensmanagement zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die verschiedenen Ebenen und Dimensionen einer wissensfreundlichen Unternehmenskultur und untersucht, wie diese durch gezielte Maßnahmen und Veränderungen gefördert werden kann.
- Wissensgesellschaft und die Bedeutung von Wissen in der Wirtschaft
- Begriffe und Konzepte der Kultur, Unternehmenskultur und des Wissensmanagements
- Die Gestaltung einer wissensfreundlichen Unternehmenskultur durch Artefakte, Werte und Grundannahmen
- Veränderungsprozesse und das Management von Veränderungen hin zu einer wissensfreundlichen Unternehmenskultur
- Praktische Implikationen und Handlungsempfehlungen für Unternehmen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit beleuchtet die Bedeutung einer wissensfreundlichen Unternehmenskultur im Kontext der Wissensgesellschaft. Es wird die Abgrenzung von der Dienstleistungs- und Wissenschaftsgesellschaft diskutiert und die zentralen Wirkfaktoren und den Entwicklungsstand der Wissensgesellschaft dargestellt. Des Weiteren wird die Bedeutung von Wissen als Produktionsfaktor, Wettbewerbsfaktor und immaterielles Vermögen in der Wirtschaft erläutert. Abschließend wird die Rolle der Unternehmenskultur im Wissensmanagement hervorgehoben.
Das zweite Kapitel widmet sich grundlegenden Begriffen und Konzepten, die für das Verständnis einer wissensfreundlichen Unternehmenskultur relevant sind. Es werden die Definition und die verschiedenen Ebenen der Kultur sowie der Zusammenhang zwischen Kultur und Unternehmenskultur beleuchtet. Darüber hinaus werden verschiedene Ansätze zur Beschreibung von Unternehmenskulturen, wie der Variablenansatz und der Metaphernansatz, vorgestellt. Das Kapitel schließt mit einer detaillierten Analyse des Drei-Ebenen-Modells von Schein, das die sichtbaren Artefakte, die Werte und die Grundannahmen einer Unternehmenskultur beschreibt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Aspekten einer wissensfreundlichen Unternehmenskultur. Es werden die wissensfreundlichen Artefakte und Schöpfungen, wie Organisation, Personal, Infrastruktur und Instrumente, analysiert. Darüber hinaus werden die wissensfreundlichen Werte, wie Wissen, Offenheit, Vertrauen und Gemeinschaft, untersucht. Abschließend werden die wissensfreundlichen Grundannahmen, die die zugrundeliegenden Denk- und Handlungsweisen in einem Unternehmen prägen, beleuchtet.
Das vierte Kapitel widmet sich der Frage, wie eine Veränderung hin zu einer wissensfreundlichen Unternehmenskultur gestaltet werden kann. Es wird die Veränderbarkeit der Unternehmenskultur diskutiert und verschiedene Ansätze des Veränderungsmanagements vorgestellt. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die mit der Transformation einer Unternehmenskultur verbunden sind, und gibt praktische Handlungsempfehlungen für Unternehmen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die wissensfreundliche Unternehmenskultur, die Wissensgesellschaft, das Wissensmanagement, die Kultur, die Unternehmenskultur, die Werte, die Grundannahmen, die Veränderung und das Veränderungsmanagement. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung von Wissen in der heutigen Wirtschaft und die Rolle der Unternehmenskultur im Kontext des Wissensmanagements. Sie analysiert die verschiedenen Ebenen und Dimensionen einer wissensfreundlichen Unternehmenskultur und untersucht, wie diese durch gezielte Maßnahmen und Veränderungen gefördert werden kann.
Häufig gestellte Fragen
Was kennzeichnet eine Wissensgesellschaft?
In einer Wissensgesellschaft wird Wissen zum zentralen Produktionsfaktor und zum Hauptelement des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens.
Welche Rolle spielt die Unternehmenskultur im Wissensmanagement?
Die Kultur bestimmt, ob Wissen geteilt, geschätzt und als Wettbewerbsvorteil genutzt wird; sie ist das Fundament für erfolgreiches Wissensmanagement.
Was ist das Drei-Ebenen-Modell von Schein?
Es beschreibt Unternehmenskultur auf drei Ebenen: sichtbare Artefakte, kollektive Werte und tief verwurzelte Grundannahmen.
Welche Werte fördern eine wissensfreundliche Kultur?
Wichtige Werte sind Offenheit, gegenseitiges Vertrauen, Gemeinschaftssinn und die Wertschätzung von kontinuierlichem Lernen.
Ist eine Unternehmenskultur veränderbar?
Ja, die Arbeit diskutiert Ansätze des Veränderungsmanagements, um eine Organisation hin zu einer wissensfreundlicheren Kultur zu transformieren.
- Citation du texte
- Agnes Harth (Auteur), 2000, Wissensfreundliche Unternehmenskultur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185615