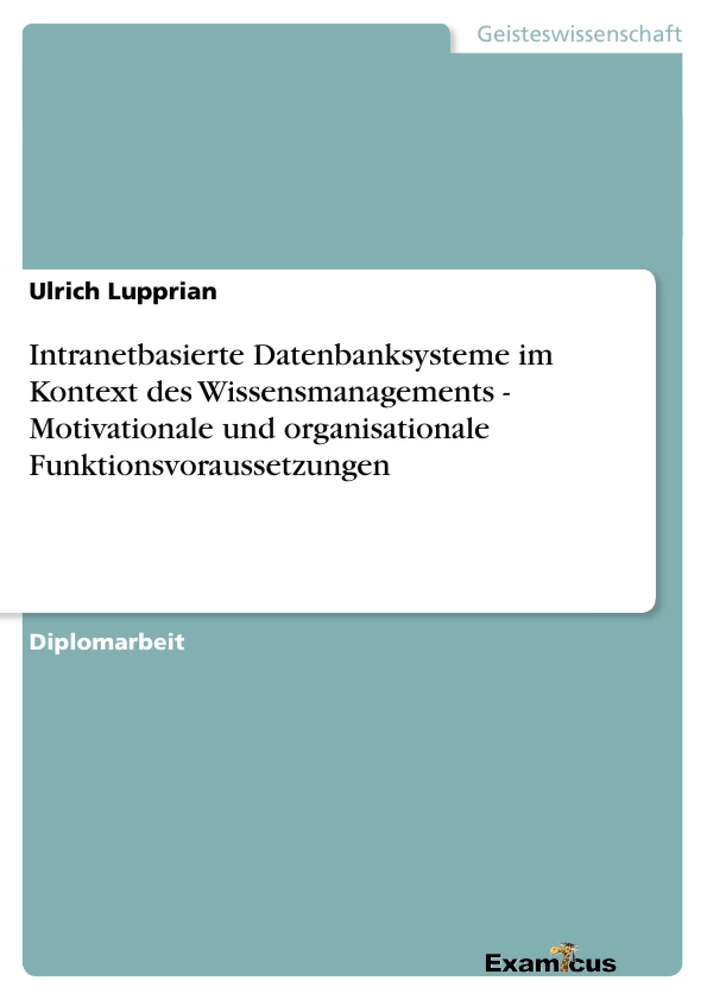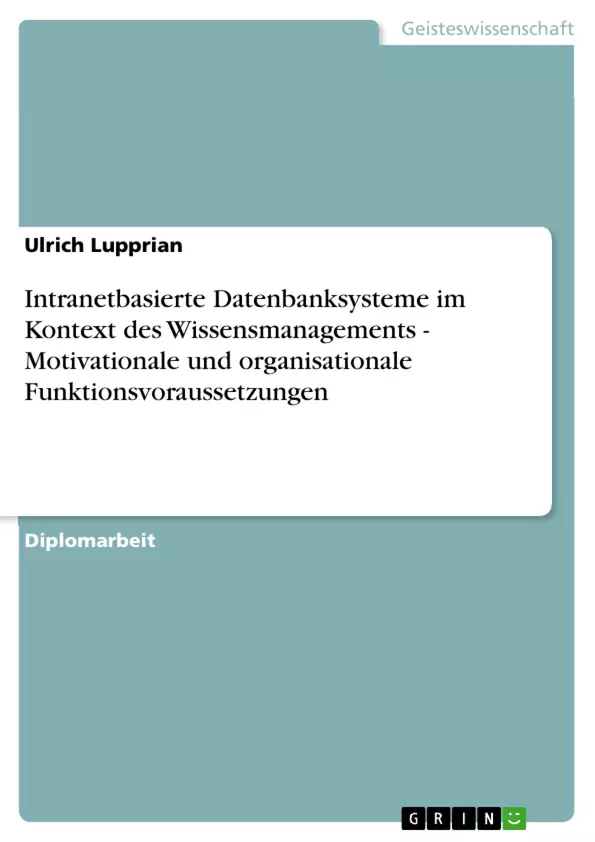Schon seit längerer Zeit sind dramatische Transformationsprozesse der hochindustriali-sierten Gesellschaften und eng damit verbunden der wirtschaftlichen Rahmenbedingun-gen zu beobachten, die insbesondere aufgrund ihrer Intensität und Geschwindigkeit be-eindrucken. Vor dem Hintergrund sich wandelnder Beschaffungs-, Produktions- und Verkaufsbedingungen (vgl. Schüppel 1996 S.7f) ergeben sich u.a. eine zunehmende In-ternationalisierung und Dynamisierung der Märkte, eine wachsende Geschwindigkeit der technologischen Innovationen sowie verkürzte Produkt-Lebenszyklen, so dass die Unternehmen insgesamt einem erhöhten Konkurrenz- und Innovationsdruck innerhalb einer globalisierten Wirtschaft gegenüberstehen. Typische Reaktionen der Unternehmen zielten zunächst primär (und tun dies teilweise noch immer) auf die Optimierung des Arbeits- und Kapitaleinsatzes; sie manifestieren sich in Konzepten wie „Business Reen-gineering“, „Total Quality Management“ oder „Prozessmanagement“ (vgl. Pawlowsky 1998 S.11f). Allerdings lässt eine differenzierte Betrachtung wirtschaftlicher Entwick-lungstrends weitergehende Managementbemühungen notwendig erscheinen. Während die ökonomische Bedeutung des tertiären Sektors die der beiden anderen inzwischen schon weit übersteigt, wird der Wert von Wirtschaftstätigkeiten in zunehmendem Maße nicht durch Arbeitsaufwand oder Materialwert, sondern durch die Qualität von Dienst-leistungen und kundenzentrierten Problemlösungen bestimmt. Gleichzeitig verschwimmt die Grenze zwischen Produkten und Dienstleistungen. Auch bei Produkten bilden häufig nicht mehr die Material- oder Produktionskosten den Hauptposten bei der Preiskalkula-tion, sondern die „embedded intelligence“ (Soukup 2001 S.42) – bspw. in Form von integrierten, forschungsintensiven Elektronikbestandteilen oder Serviceleistungen – ge-neriert den meisten Mehrwert und wird so zum zentralen Differenzierungskriterium auf dem kundenbasierten Markt. Dieser Wandel der Wertschöpfungsanteile führt auf Unter-nehmensebene dazu, dass weniger die Ressourcenausstattung mit Arbeit, Kapital und Rohstoffen, sondern vielmehr die (Kern-)Kompetenz diese Produktionsfaktoren zu einer wissensbasierten kundenspezifischen Problemlösung zu kombinieren entscheidende Wettbewerbsvorteile ermöglicht. Diese Entwicklung schlägt sich auch im Charakter der Arbeitsprozesse nieder, d.h. immer mehr Tätigkeiten sind auf den Umgang mit Informa-tionen und deren Veredelung zu wertschöpfendem Wissen ausgerichtet.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Wissensmanagement – Darstellung des Forschungsstandes
- 1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements
- 1.1 Wissen als Wettbewerbsfaktor
- 1.2 Einordnung – Inhalte, Ziele und Entwicklung von Wissensmanagement
- 1.3 Wissensmanagement als Mode – das Neue am Wissensmanagement…....
- 2. Relevante Begriffe und Modelle für das Management von Wissen
- 2.1 Diskussion des Wissensbegriffes
- 2.1.1 Erkenntnistheorie und Perspektiven auf Wissen..
- 2.1.2 Daten, Informationen und Wissen - Und wo ist Wissen zu lokalisieren?
- 2.1.3 Implizites und explizites Wissen und andere Systematisierungsversuche.
- 2.1.4 Eigenschaften von Wissen als Ressource sui generis
- 2.2 Lernen auf verschiedenen Ebenen
- 2.2.1 Individuelles Lernen – Lernen als Prozess, Wissen als Basis und Ergebnis..
- 2.2.2 Kollektives Lernen.
- 2.2.3 Organisationales Lernen – und die organisatorische Wissensbasis
- 2.1 Diskussion des Wissensbegriffes
- 3. Skizzierung wichtiger Ansätze des Wissensmanagements
- 3.1 Die Bausteine des Wissensmanagements von Probst, Raub und Romhardt.
- 3.1.1 Die Interventionsquadranten von Romhardt
- 3.2 Das Systemische Wissensmanagement nach Willke
- 3.3 Das Praxisbuch von Davenport und Prusak.
- 3.4 Wissensgenerierung in der Wissensspirale nach Nonaka und Takeuchi
- 4. Organisationstheorie und Wissensmanagement - Macht im Kontext von Handlung und Struktur..
- 1. Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements
- III. Datenbanken als Instrumente des Wissensmanagements -
Funktionen und Funktionsvoraussetzungen
- 1. Informationstechnologische Tools im Wissensmanagement.
- 1.1 Das Intranet als Basistechnologie
- 1.2 Beschreibung und Funktion wichtiger Tools des Wissensmanagements
- 1.2.1 Groupware..
- 1.2.2 Workflow-Management-Systeme
- 1.2.3 Data Mining
- 2. Datenbanken im Wissensmanagement.
- 2.1 Charakterisierung und Klassifizierung von Datenbanken.....
- 2.2 Wissensmanagementfunktionen von Datenbanken....
- 2.3 Datenbanken im Kontext von Wissensmanagementstrategie und Wissensgenerierung – Bezugspunkte für die weitere Analyse
- 2.4 Was Datenbanken (alleine) nicht leisten können ….
- 3. Die Basisdimensionen Input und Output -
Barrieren und Problemfelder für das Engagement der Anwender...……………………………………..
- 3.1 Input in Datenbanksysteme und mögliche Barrieren..
- 3.1.1 Input als Gefangenendilemma und Gründe für die Abgabe von Wissen
- 3.1.2 Wissen als potentielle Machtressource und weitere Barrieren der Wissensabgabe
- 3.2 Output aus Datenbanksystemen und mögliche Barrieren
- 3.2.1 Zusammenhänge zwischen Input- und Output-Dimension sowie weiterführende empirische Studienergebnisse zum Nutzungsverhalten
- 3.2.2 Finden, Verstehen, Akzeptieren und Verwenden der Daten.
- 3.1 Input in Datenbanksysteme und mögliche Barrieren..
- 4. Exkurs: Relevante motivationstheoretische Überlegungen.
- 4.1 Motiv, Anreiz und Motivation
- 4.2 Konzept der intrinsischen Motivation......
- 4.3 Gründe für die Bedeutung und Vorteile der intrinsischen Motivation
- 4.3.1 Allgemeine Bedeutungsaspekte für das Management von Wissen.
- 4.3.2 Spezielle Bedeutung der intrinsischen Motivation für Datenbanken.
- 4.4 Einflüsse externer Eingriffe auf die intrinsische Motivation Verdrängungs-, Verstärkungs- und Übertragungseffekte
- 4.5 Wissensarbeiter und der Aufbau intrinsischer Motivation
- 5. Rahmenbedingungen und Gestaltungsempfehlungen
zur erfolgreichen Datenbankimplementation und -anwendung
- 5.1 Partizipation
- 5.2 Communities of Practice als Leitbild..
- 5.3 Bedeutung und Einflussmöglichkeiten der Führung.
- 5.3.1 Der Einfluss der Führungskräfte auf die Unternehmenskultur und die (intrinsische) Motivation.
- 5.3.2 Prozesse und Maßnahmen zur Unterstützung von Datenbanken
- 5.4 Anreizsysteme – Die Gestaltung von Entlohnung und Anreizen.
- 5.5 Arbeitsgestaltung und Organisationsstruktur
- 5.6. Gestaltungselemente innerhalb von Datenbanksystemen
- 6. Resümee - Datenbanksysteme im Kontext eines ganzheitlichen Wissensmanagements
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Thematik der intranetbasierten Datenbanksysteme im Kontext des Wissensmanagements. Ziel ist es, die motivationalen und organisationalen Funktionsvoraussetzungen für die erfolgreiche Implementierung und Anwendung solcher Systeme zu analysieren. Die Arbeit untersucht, wie Datenbanken als Instrumente des Wissensmanagements eingesetzt werden können, um Wissen zu erfassen, zu speichern, zu teilen und wiederzuverwenden. Dabei werden die Herausforderungen und Barrieren beleuchtet, die mit der Bereitstellung und Nutzung von Wissen in Unternehmen verbunden sind.
- Wissensmanagement als strategisches Instrument zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
- Die Rolle von Datenbanken im Wissensmanagement
- Motivationale und organisationale Faktoren für die erfolgreiche Implementierung und Nutzung von Datenbanken
- Barrieren und Problemfelder im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Nutzung von Wissen
- Gestaltungsempfehlungen für die erfolgreiche Implementierung und Anwendung von Datenbanksystemen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der intranetbasierten Datenbanksysteme im Kontext des Wissensmanagements ein und erläutert die Relevanz des Themas. Sie stellt die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit dar.
Kapitel II bietet einen Überblick über den Forschungsstand zum Thema Wissensmanagement. Es werden die Hintergründe, Inhalte, Ziele und Entwicklung des Wissensmanagements beleuchtet. Der Wissensbegriff wird diskutiert und verschiedene Modelle zur Systematisierung von Wissen vorgestellt. Zudem werden wichtige Ansätze des Wissensmanagements skizziert, darunter die Bausteine des Wissensmanagements von Probst, Raub und Romhardt, das Systemische Wissensmanagement nach Willke und das Praxisbuch von Davenport und Prusak.
Kapitel III widmet sich der Analyse von Datenbanken als Instrumenten des Wissensmanagements. Es werden die Funktionen und Funktionsvoraussetzungen von Datenbanken im Kontext des Wissensmanagements untersucht. Die Arbeit beleuchtet die Rolle von Informationstechnologien, insbesondere des Intranets, im Wissensmanagement und beschreibt wichtige Tools wie Groupware, Workflow-Management-Systeme und Data Mining.
Kapitel IV befasst sich mit den Basisdimensionen Input und Output von Datenbanksystemen und den damit verbundenen Barrieren und Problemfeldern für das Engagement der Anwender. Es werden die Gründe für die Abgabe von Wissen in Datenbanken untersucht, sowie die Herausforderungen, die mit der Nutzung von Wissen aus Datenbanken verbunden sind.
Kapitel V widmet sich den Rahmenbedingungen und Gestaltungsempfehlungen für die erfolgreiche Implementierung und Anwendung von Datenbanksystemen. Es werden die Bedeutung von Partizipation, Communities of Practice und Führung für die erfolgreiche Nutzung von Datenbanken beleuchtet. Zudem werden Anreizsysteme, Arbeitsgestaltung und Organisationsstruktur sowie Gestaltungselemente innerhalb von Datenbanksystemen diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das Wissensmanagement, intranetbasierte Datenbanksysteme, Motivation, Organisation, Funktionsvoraussetzungen, Implementierung, Anwendung, Barrieren, Problemfelder, Gestaltungsempfehlungen, Wissensgenerierung, Wissensteilung, Wissensnutzung, Wissensarbeiter, intrinsische Motivation, Communities of Practice, Führung, Anreizsysteme, Arbeitsgestaltung, Organisationsstruktur.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Wissensmanagement heute ein Wettbewerbsfaktor?
In einer globalisierten Wirtschaft bildet nicht mehr Materialwert, sondern "embedded intelligence" und die Kompetenz, Wissen kundenspezifisch zu veredeln, den entscheidenden Mehrwert.
Welche Rolle spielen Intranets im Wissensmanagement?
Das Intranet dient als Basistechnologie für Tools wie Groupware, Workflow-Systeme und Datenbanken, um Wissen unternehmensweit zu erfassen und zu teilen.
Was sind die Barrieren bei der Wissensabgabe in Datenbanken?
Wissen wird oft als Machtressource wahrgenommen. Barrieren sind das "Gefangenendilemma" (Angst vor Kontrollverlust) und mangelnde Motivation, eigenes Wissen preiszugeben.
Was ist der Unterschied zwischen implizitem und explizitem Wissen?
Explizites Wissen ist dokumentierbar (z.B. in Datenbanken), während implizites Wissen an Personen gebunden ist und oft nur durch Erfahrung und Austausch (Lernen) weitergegeben werden kann.
Warum ist intrinsische Motivation für Wissensarbeiter wichtig?
Wissensarbeit lässt sich schwer erzwingen. Nur durch intrinsische Motivation und eine unterstützende Unternehmenskultur nutzen Mitarbeiter Datenbanken nachhaltig und kreativ.
- Citation du texte
- Ulrich Lupprian (Auteur), 2002, Intranetbasierte Datenbanksysteme im Kontext des Wissensmanagements - Motivationale und organisationale Funktionsvoraussetzungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/185800