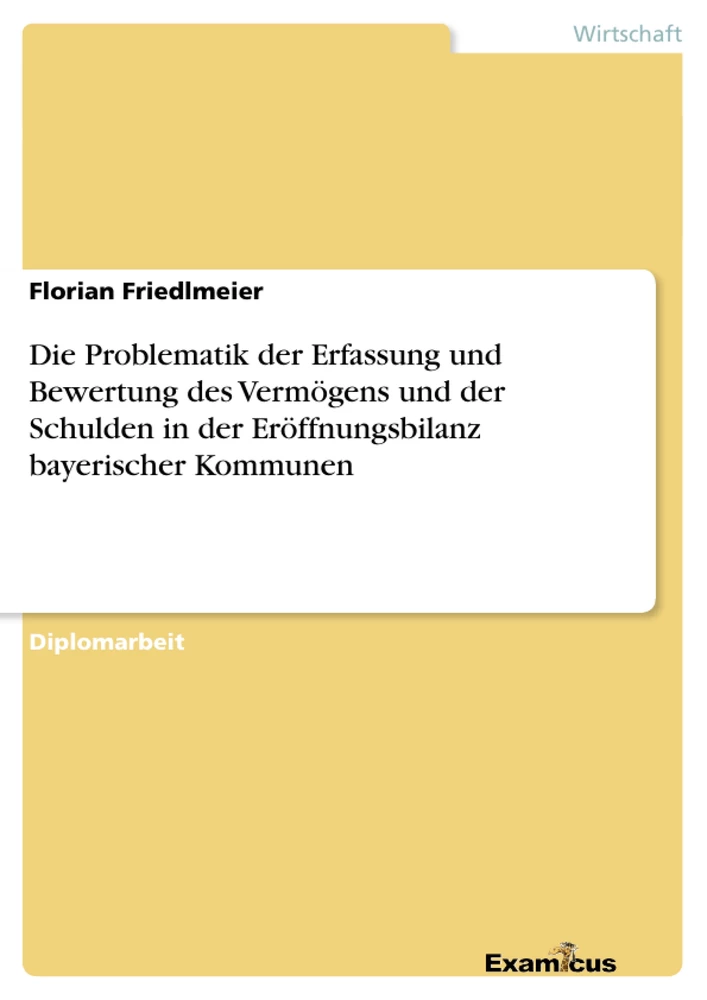Gemeinden gehen neue Wege, so titelt die Stadtzeitung der Gemeinde Friedberg in ihrer Ausgabe vom Mittwoch, den 25. Februar 2004, und meint damit, dass die Einführung eines grundlegend reformierten Rechnungswesens nötig ist, um sich aus der misslichen Lage, in der sich die Kommunen momentan befinden, zu befreien.1
Dies wird anhand der ständigen finanziellen Probleme der bayerischen Städte und Gemeinden und darüber hinaus recht deutlich. Eindrücke, die diese Veränderungen notwendig machen, konnte der Verfasser anhand eines halbjährigen Praktikums im Landratsamt Rottal-Inn, in der Abteilung für Controlling und Verwaltungsreform, gewinnen.
Jedoch lässt sich so eine Reformierung mit den bisherigen Haushaltsinstrumenten nicht erreichen. Deshalb wurde seitens des jüngsten Beschlusses der Innenministerkonferenz
vom 21. November vergangenen Jahres in Jena beschlossen,
dass das bisherige, für Kommunen zuständige Rechnungswesen, die Kameralistik, in den nächsten Jahren bundesweit von der erweiterten Kameralistik oder der Doppik abgelöst wird.2
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen des neuen kommunalen Rechnungswesens
- 2.1 Wesentliche Eckpunkte des neuen Kommunalen Finanzmanagements
- 2.2 Das Drei-Komponenten-System des NKF
- 2.2.1 Die Vermögensrechnung
- 2.2.2 Die Ergebnisrechnung
- 2.2.3 Die Finanzrechnung
- 3 Erfassung und Bewertung kommunales Vermögen und Schulden
- 3.1 Erfassung
- 3.1.1 Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur
- 3.1.1.1 Vollständigkeit
- 3.1.1.2 Richtigkeit
- 3.1.1.3 Klarheit und Nachprüfbarkeit
- 3.1.1.4 Wirtschaftlichkeit
- 3.1.2 Prozess der Erfassung
- 3.1.2.1 Inventurrahmenplan
- 3.1.2.1.1 Zeitplan
- 3.1.2.1.2 Sachplan
- 3.1.2.1.3 Personalplan
- 3.1.2.2 Durchführung der Inventur
- 3.1.2.2.1 Buch- und Beleginventur
- 3.1.2.2.2 Körperliche Inventur
- 3.1.2.3 Aufstellung des Inventars
- 3.1.2.1 Inventurrahmenplan
- 3.1.1 Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur
- 3.2 Bewertung
- 3.2.1 Grundsätze ordnungsmäßiger Bewertung
- 3.2.1.1 Vollständigkeit und Verrechnungsverbot
- 3.2.1.2 Bilanzidentität
- 3.2.1.3 Stetigkeit der Bewertung
- 3.2.1.4 Fortführung der Tätigkeit
- 3.2.1.5 Einzelbewertung
- 3.2.1.5.1 Bewertungsvereinfachungsverfahren
- 3.2.1.5.1.1 Festbewertung
- 3.2.1.5.1.2 Gruppenbewertung
- 3.2.1.5.1.3 Sofortabschreibung
- 3.2.1.5.1.4 Verbrauchsfolgeverfahren
- 3.2.1.5.1.5 Durchschnittsbewertung
- 3.2.1.5.1 Bewertungsvereinfachungsverfahren
- 3.2.1.6 Vorsichtsprinzip
- 3.2.1.6.1 Realisationsprinzip
- 3.2.1.6.2 Imparitätsprinzip
- 3.2.1.7 Periodisierungsprinzip
- 3.2.2 Bilanzgliederung
- 3.2.3 Wahl des Wertansatzes in der Eröffnungsbilanz
- 3.2.4 Abschreibungen
- 3.2.4.1 Zulässige Abschreibungsmethoden
- 3.2.4.1.1 Lineare Abschreibung
- 3.2.4.1.2 Degressive Abschreibung
- 3.2.4.1.3 Leistungsabschreibung
- 3.2.4.1.4 Kombination von Abschreibungsmethoden
- 3.2.4.2 Bestimmung der Nutzungsdauer
- 3.2.4.1 Zulässige Abschreibungsmethoden
- 3.2.1 Grundsätze ordnungsmäßiger Bewertung
- 3.3 Bewertung von kommunalen Vermögens
- 3.3.1 Bebaute / Unbebaute Grundstück
- 3.3.1.1 Ertragswertverfahren
- 3.3.1.2 Sachwertverfahren
- 3.3.1.3 Vergleichswertverfahren
- 3.3.2 Übriges Infrastrukturvermögen
- 3.3.2.1 Grün- und Parkanlagen, Sport- und Spielplätze und andere Freiflächen
- 3.3.2.2 Landwirtschaftlich genutzte Flächen
- 3.3.2.3 Straßen und Plätze
- 3.3.3 Bewegliches Sachanlagevermögen
- 3.3.3.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3.3.3.2 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
- 3.3.3.3 Fahrzeuge
- 3.3.3.4 Anlagen und Maschinen
- 3.3.3.4.1 Anlagen der Abwasserentsorgung
- 3.3.3.4.2 Anlagen der Verkehrstechnik
- 3.3.4 Immaterielle Vermögensgegenstände
- 3.3.5 Finanzanlagen
- 3.3.6 Umlaufvermögen
- 3.3.7 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
- 3.3.1 Bebaute / Unbebaute Grundstück
- 3.4 Bewertung der Schulden
- 3.4.1 Eigenkapital
- 3.4.2 Sonderposten
- 3.4.3 Rückstellungen
- 3.4.3.1 Pensionsrückstellungen
- 3.4.3.1.1 Unterstützungskasse / (Bayer.) Versorgungsverband
- 3.4.3.1.2 Pensionskasse / Versicherungsunternehmen
- 3.4.3.1.3 Bewertung der unmittelbaren Pensionsverpflichtung
- 3.4.3.2 Aufwandsrückstellungen
- 3.4.3.1 Pensionsrückstellungen
- 3.4.4 Verbindlichkeiten
- 3.4.5 Passive Rechnungsabgrenzung
- 4 Zusammenfassung
- Literatur- und Quellenverzeichnis
- Erklärung
- Anlagenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Problematik der Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden in der Eröffnungsbilanz bayerischer Kommunen. Sie analysiert die Herausforderungen, die sich im Rahmen des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKF) für die Kommunen ergeben, und beleuchtet die relevanten rechtlichen und praktischen Aspekte der Vermögens- und Schuldenbewertung. Die Arbeit zielt darauf ab, ein tiefergehendes Verständnis für die komplexen Prozesse der Erfassung und Bewertung zu vermitteln und Handlungsempfehlungen für die Praxis zu entwickeln.
- Einführung in das neue kommunale Rechnungswesen (NKF)
- Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur und Bewertung
- Bewertung von kommunalem Vermögen (Grundstücke, Infrastruktur, bewegliches Sachanlagevermögen, immaterielle Vermögensgegenstände, Finanzanlagen, Umlaufvermögen)
- Bewertung von Schulden (Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung)
- Praktische Herausforderungen und Handlungsempfehlungen für die Kommunen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden in der Eröffnungsbilanz bayerischer Kommunen ein. Sie erläutert die Relevanz des Themas im Kontext des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKF) und skizziert den Aufbau der Arbeit.
Kapitel 2 befasst sich mit den Grundlagen des neuen kommunalen Rechnungswesens. Es werden die wesentlichen Eckpunkte des NKF sowie das Drei-Komponenten-System (Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung) vorgestellt.
Kapitel 3 widmet sich der Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens und der Schulden. Es werden die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur und Bewertung sowie die verschiedenen Bewertungsmethoden und -verfahren erläutert. Darüber hinaus werden die spezifischen Herausforderungen bei der Bewertung von verschiedenen Vermögensarten und Schuldenarten beleuchtet.
Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen und bietet einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich des kommunalen Rechnungswesens.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen das neue kommunale Finanzwesen (NKF), die Eröffnungsbilanz, die Erfassung und Bewertung von kommunalem Vermögen und Schulden, die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur und Bewertung, die verschiedenen Bewertungsmethoden und -verfahren, die spezifischen Herausforderungen bei der Bewertung von verschiedenen Vermögensarten und Schuldenarten sowie die praktische Anwendung des NKF in bayerischen Kommunen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das "Neue Kommunale Finanzmanagement" (NKF)?
NKF bezeichnet die Umstellung des kommunalen Rechnungswesens von der Kameralistik auf die Doppik (doppelte Buchführung), um Ressourcenverbrauch und Vermögen besser darzustellen.
Warum ist die Eröffnungsbilanz für Kommunen so schwierig?
Die Schwierigkeit liegt in der erstmaligen vollständigen Erfassung und Bewertung aller Vermögensgegenstände (Straßen, Gebäude, Grundstücke) und Schulden, die oft über Jahrzehnte nicht bilanziert wurden.
Wie werden Grundstücke in der Kommunalbilanz bewertet?
Dafür kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz, wie das Ertragswert-, Sachwert- oder Vergleichswertverfahren, je nach Art und Nutzung der Fläche.
Was sind "Pensionsrückstellungen" im kommunalen Kontext?
Dies sind finanzielle Rücklagen, die eine Kommune für künftige Pensionszahlungen an ihre Beamten bilden muss, was eine erhebliche Belastung der Bilanz darstellen kann.
Welche Inventurverfahren werden angewendet?
Es wird zwischen der Buch- und Beleginventur (für Finanzen/Rechte) und der körperlichen Inventur (für bewegliche Güter und Infrastruktur) unterschieden.
- 3.1 Erfassung
- Citar trabajo
- Dipl. Betriebswirt FH Florian Friedlmeier (Autor), 2005, Die Problematik der Erfassung und Bewertung des Vermögens und der Schulden in der Eröffnungsbilanz bayerischer Kommunen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186012