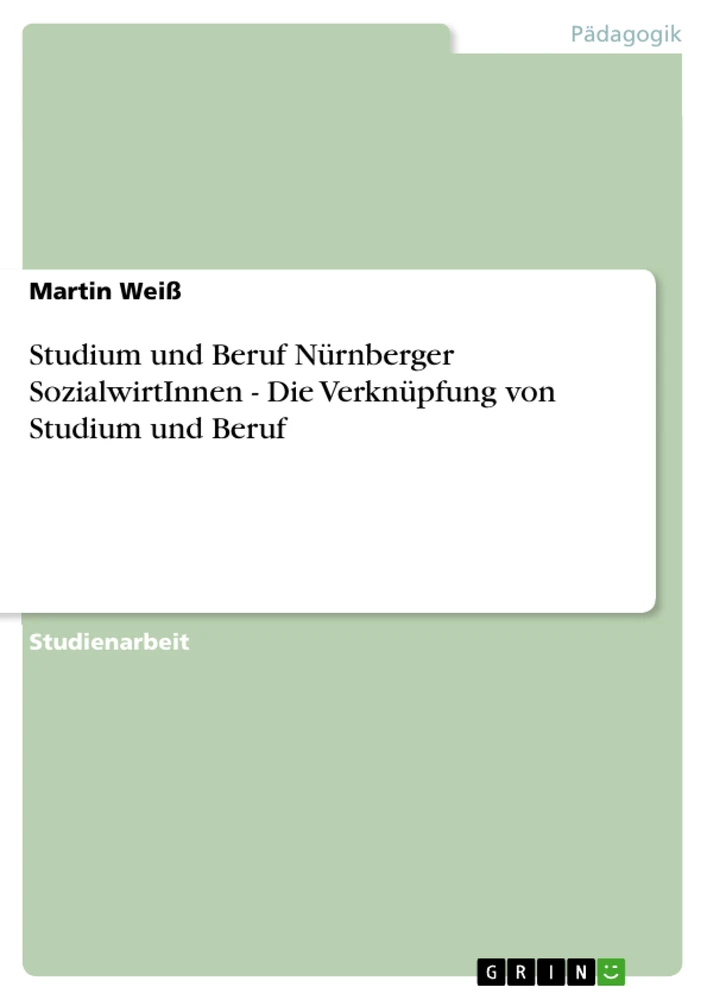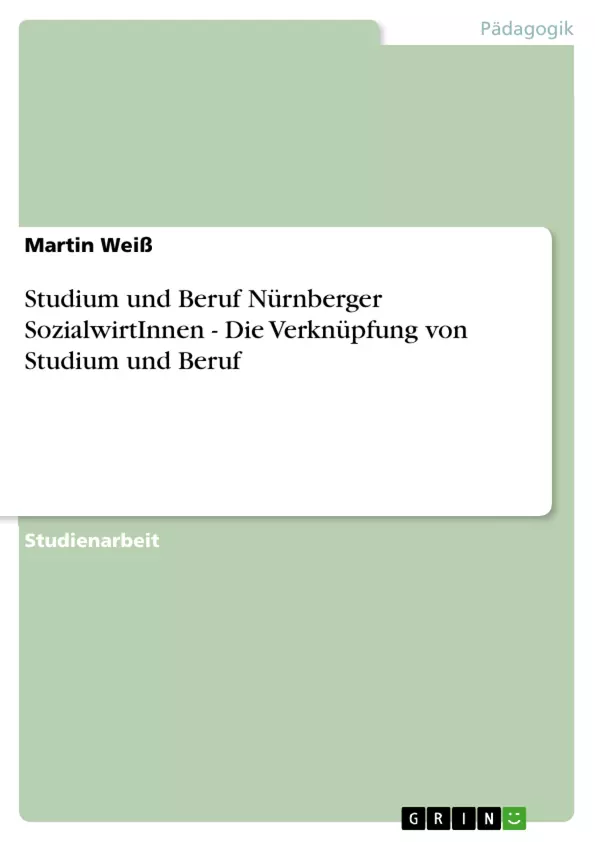Um das Studium für den Arbeitsmarkt attraktiver zu gestalten, ist es erforderlich herauszufinden,
wo die Nürnberger AbsolventInnen Schwachpunkte bei der Ausbildung in der
Universität sehen. Ebenso ist es notwendig zu untersuchen welche Bereiche der Ausbildung
überhaupt bedeutend für den Beruf sind. Gibt es Unterschiede zwischen Frauen und
Männern? Hat sich die universitäre Ausbildung auf Grund neuer Prüfungsordnungen verbessert?
Welche Bereiche sind wichtig für den Beruf? Alle diese Fragen sollen so weit
wie möglich im Folgenden geklärt werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kenngrößen
- Modell und Einflussfaktoren
- Auswertung der Einzelnen Gebiete
- Vorbemerkung
- Schlüsselqualifikationen und Fachkenntnisse
- Personale und soziale Fähigkeiten
- Einflussfaktoren auf die Vermittlung durch die Hochschule und deren berufliche Bedeutung
- Sachliche Kenntnisse und Fähigkeiten
- Personale und soziale Fähigkeiten
- Berufliche Zukunftsperspektiven
- Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Studie ist es, die Verknüpfung von Studium und Beruf aus der Perspektive von Nürnberger Absolventinnen und Absolventen der Sozialwissenschaften zu untersuchen. Dabei soll herausgefunden werden, welche Kenntnisse und Fähigkeiten im Studium vermittelt werden, welche für den Beruf relevant sind und welche Unterschiede in der Bewertung von Frauen und Männern sowie zwischen verschiedenen Studiengängen und Abschlussjahren bestehen.
- Relevanz von Schlüsselqualifikationen und Fachkenntnissen für den Beruf
- Bedeutung von personalen und sozialen Fähigkeiten im Beruf
- Einflussfaktoren auf die Vermittlung von Kompetenzen durch die Hochschule
- Berufliche Zukunftsperspektiven von SozialwirtInnen
- Unterschiede zwischen Frauen und Männern in der Wahrnehmung von Studium und Beruf
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Studie vor und erläutert die Notwendigkeit, die Verknüpfung von Studium und Beruf zu untersuchen.
- Kenngrößen: In diesem Kapitel werden die wichtigsten Kenngrößen der Studie definiert, die zur Analyse der Verknüpfung von Studium und Beruf herangezogen werden.
- Modell und Einflussfaktoren: Dieses Kapitel präsentiert das Modell, das zur Untersuchung der Einflussfaktoren auf die Wichtigkeit und Vermittlung von Kompetenzen verwendet wird. Es werden drei Typen von Einflussfaktoren (Geschlecht, Studienrichtung, Abschlussjahr) erläutert.
- Auswertung der Einzelnen Gebiete: Dieses Kapitel enthält eine detaillierte Auswertung der einzelnen Bereiche, die für die Verknüpfung von Studium und Beruf relevant sind. Die Ergebnisse der Untersuchungen zu Schlüsselqualifikationen, Fachkenntnissen, personalen und sozialen Fähigkeiten sowie zu den Einflussfaktoren werden hier präsentiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Studie sind: Sozialwissenschaften, Berufliche Qualifikation, Studium und Beruf, Schlüsselqualifikationen, Fachkenntnisse, Personale und Soziale Fähigkeiten, Einflussfaktoren, Geschlecht, Studienrichtung, Abschlussjahr, Nürnberger SozialwirtInnen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Studie über Nürnberger SozialwirtInnen?
Die Studie untersucht die Verknüpfung von Studium und Beruf, um Schwachpunkte in der universitären Ausbildung aufzudecken und die Relevanz der vermittelten Inhalte für den Arbeitsmarkt zu prüfen.
Welche Kompetenzen sind für den Beruf besonders wichtig?
Die Auswertung unterscheidet zwischen fachlichen Kenntnissen, Schlüsselqualifikationen sowie personalen und sozialen Fähigkeiten (Soft Skills).
Gibt es Unterschiede zwischen den Geschlechtern?
Ja, die Arbeit untersucht explizit, ob Frauen und Männer die berufliche Bedeutung bestimmter Studieninhalte unterschiedlich bewerten.
Hat die neue Prüfungsordnung die Ausbildung verbessert?
Ein Teil der Forschungsfrage befasst sich damit, ob sich die Qualität der Vorbereitung auf den Beruf durch veränderte universitäre Rahmenbedingungen im Laufe der Zeit gesteigert hat.
Wie sehen die beruflichen Zukunftsperspektiven für Absolventen aus?
Die Arbeit analysiert die aktuellen Karrierechancen und Tätigkeitsfelder der Nürnberger Absolventinnen und Absolventen der Sozialwissenschaften.
- Arbeit zitieren
- Martin Weiß (Autor:in), 2004, Studium und Beruf Nürnberger SozialwirtInnen - Die Verknüpfung von Studium und Beruf, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186145