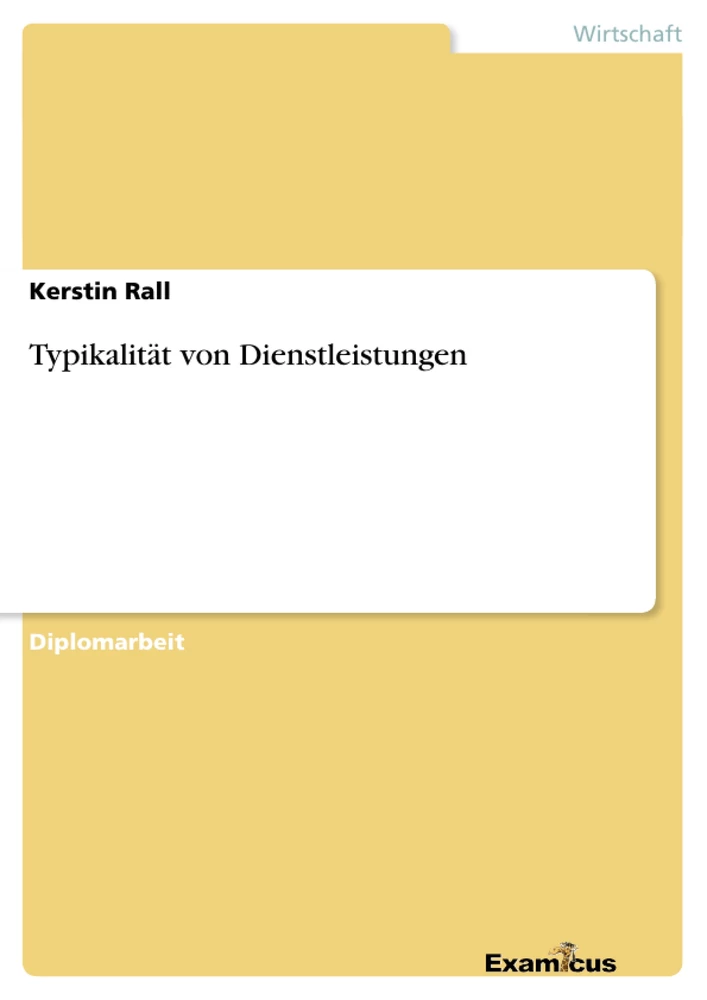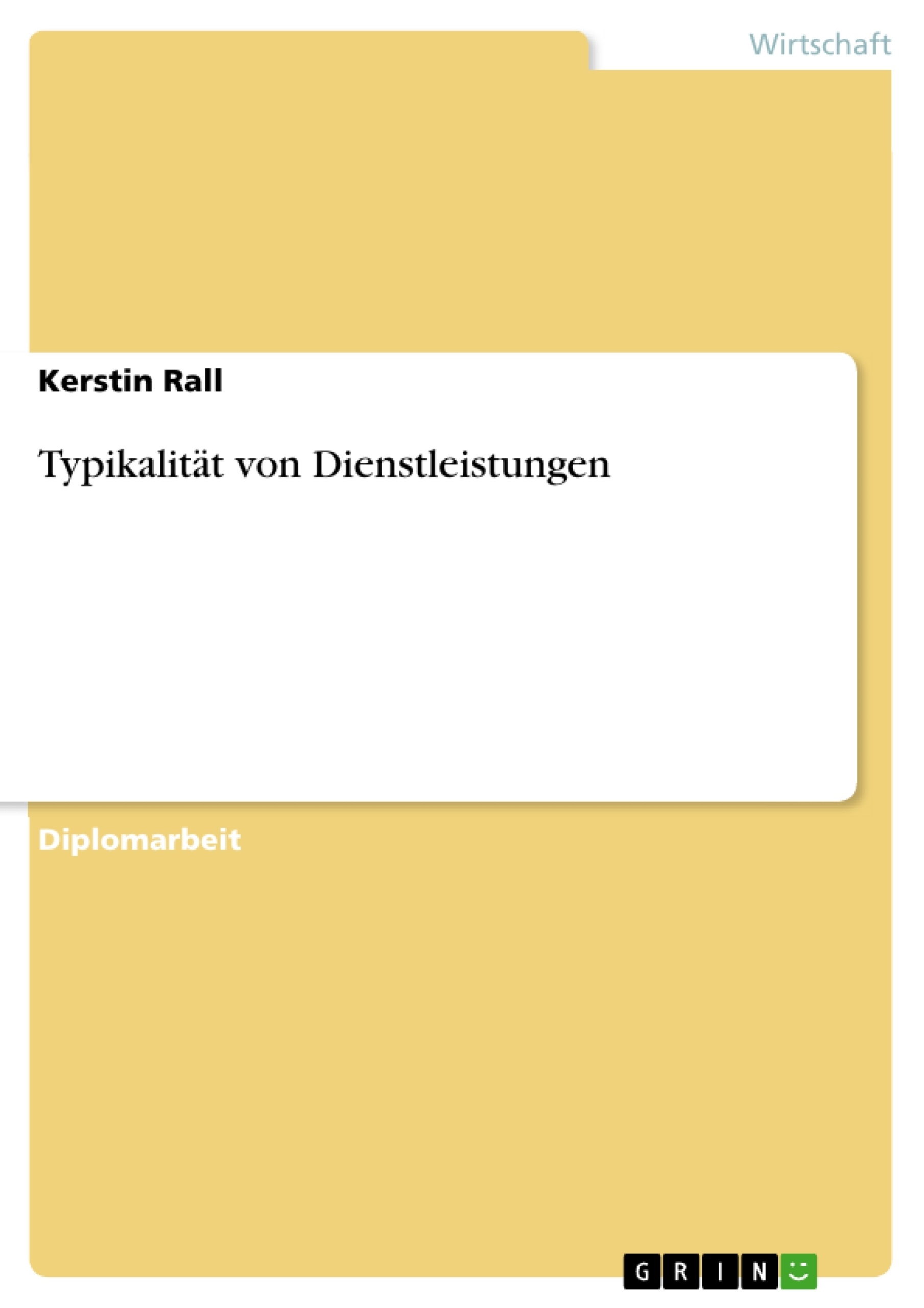Seit den 1960er Jahren sind Deutschland und andere hoch entwickelte Gesellschaften durch einen tiefgreifenden Wandel hin zur Dienstleistungsgesellschaft geprägt. Die heutige dominierende Stellung des Tertiären Sektors lässt sich an Merkmalen wie der Bruttowertschöpfung und der Beschäftigung ableiten, aber auch aus der Tatsache, dass Dienstleistungen nicht mehr nur von klassischen Dienstleistungsunternehmen sondern zunehmend auch von Sachgüterunternehmen angeboten werden. So existieren zwar einige wenige Absatzleistungen, die ausschließlich aus Dienstleistungen bestehen (z.B. ärztliche Beratung); es gibt allerdings keine Sachleistung, die ohne jeglichen, wenn auch mitunter geringen Dienstleistungsanteil abgesetzt werden kann (z.B. erklärungsbedürftige Gebrauchsgüter).
Design und Werbung entscheiden in der heutigen, schnelllebigen Welt mehr als je zuvor, ob und wie sich ein Produkt oder eine Dienstleistung im Markt etablieren kann. Doch was entscheidet letztendlich über Erfolg oder Misserfolg? Welche kognitiven Prozesse laufen im Konsumenten ab, wenn es um die Frage geht, ein typisches oder untypisches Produkt zu kaufen bzw. eine vertraute oder eine neuartige Dienstleistung in Anspruch zu nehmen? Die kognitive Psychologie bietet hierzu einige interessante Ansätze, die im Zuge dieser Arbeit diskutiert werden sollen. Phänomene wie ?Prototyp? und ?Typikalität? stehen dabei im Mittelpunkt der Betrachtung. Sie wurden aus der psychologischen Literatur zur Kategorisierung übernommen und fanden in den letzten Jahren in verschiedenen Untersuchungen im Marketingbereich Anwendung. Demnach sind einzelne Beispiele unterschiedlich typisch für eine Kategorie. Typikalität ist demzufolge der Grad der Repräsentativität bzw. Kategoriezu-gehörigkeit. Allerdings konzentrieren sich die empirischen Studien bis heute fast ausschließlich auf Allgemeinbegriffe für Klassen von konkreten, sinnlich wahrnehmbaren Objekten oder Sachverhalten.
Ziel dieser Arbeit ist es, zu diskutieren, ob und inwieweit sich das Typikalitätsphänomen, insbesondere seine Determinanten, die Wirkungen sowie dessen Messung, auf Dienstleis-tungen übertragen lässt.
Kapitel 2 soll zunächst die Relevanz der Dienstleistungstypikalität für das Marketing aufzeigen. Ausgehend von der Dienstleistungsdefinition und der sich daraus ergebenden Besonderheiten beim Absatz, wird anschließend der Begriff der Typikalität konkretisiert und sein Einfluss auf das Konsumentenverhalten verdeutlicht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. PROBLEMSTELLUNG, ZIELSETZUNG UND GANG DER UNTERSUCHUNG
- 2. RELEVANZ DER DIENSTLEISTUNGSTYPIKALITÄT FÜR DAS MARKETING
- 2.1. Der Begriff der Dienstleistung
- 2.2. Besonderheiten beim Absatz von Dienstleistungen
- 2.3. Der Begriff der Typikalität
- 2.4. Typikalität als Einflussgröße des Konsumentenverhaltens
- 3. TYPIKALITÄT IM KONTEXT DER KOGNITIONSPSYCHOLOGIE
- 3.1. Informationsverarbeitung und Gedächtnis
- 3.1.1. Prinzipien menschlicher Informationsverarbeitung
- 3.1.1.1. Modelle der Informationsverarbeitung
- 3.1.1.2. Prinzipien der menschlichen Informationsverarbeitung
- 3.1.1.3. Formen der Informationsverarbeitung
- 3.1.2. Prozedurales vs. Deklaratives Gedächtnis
- 3.2. Wissen und seine Struktur
- 3.2.1. Psychometrischer Ansatz
- 3.2.2. Netzwerk-Ansatz
- 3.2.3. Schemata und Skripte
- 3.3. Wahrnehmung und Kategorisierung
- 3.3.1. Wahrnehmungsprozess und Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Wissen
- 3.3.2. Kategorisierung und ihre Determinanten
- 3.3.2.1. Kategorisierungsprozess und gradiententheoretische Modelle
- 3.3.2.2. Hierarchieebenen von Begriffen
- 4. DETERMINANTEN, WIRKUNGEN UND MESSUNG DER TYPIKALITÄT VON DIENSTLEISTUNGEN
- 4.1. Einführung und Definition
- 4.2. Determinanten der Typikalität
- 4.2.1. Attribute Sharing
- 4.2.1.1. Familienähnlichkeit
- 4.2.1.2. Feature-Similarity Approach nach Tversky
- 4.2.2. Vertrautheit und Häufigkeit der Instantiierung
- 4.2.2.1. Vertrautheit
- 4.2.2.2. Begriffsspezifische Exemplar-Häufigkeit
- 4.2.3. Einstellung zu einem Exemplar und Attributgewichtung
- 4.2.3.1. Ähnlichkeit zu Idealen bzw. Ad hoc-Begriffe und Ziel-Begriffe
- 4.2.3.2. Attributstruktur
- 4.2.4. Einflüsse des Kontextes
- 4.3. Wirkungen der Typikalität
- 4.3.1. Typikalität und Verarbeitungsprozesse
- 4.3.2. Typikalität und Risikoempfinden
- 4.3.3. Typikalität und Produktbeurteilung
- 4.4. Messung der Typikalität
- 4.4.1. Direkte Urteilsmethoden
- 4.4.2. Produktionsmethoden
- 5. IMPLIKATIONEN FÜR DAS MARKETING
- 6. ZUSAMMENFASSUNG
- Literaturverzeichnis
- Ehrenwörtliche Erklärung
- akt.
- Aufl.
- aktualisiert
- Auflage
- beispielsweise
- Bd.
- Band
- bspw.
- bzw.
- d.h.
- erg.
- erw.
- et al.
- etc.
- beziehungsweise
- das heißt
- ergänzt
- erweiterte
- (et alia) und andere
- et cetera
- folgende
- f.
- ff.
- fortfolgende
- ggü.
- gegenüber
- Hrsg.
- Herausgeber
- i.d.R.
- in der Regel
- Kap.
- Kapitel
- o.J.
- ohne Jahr
- o.V.
- ohne Verfasser
- S.
- Seite
- sog.
- so genannt
- u.
- und
- verb.
- Vpn
- Vol.
- Volume
- vollst.
- vollständig
- vs.
- u. a.
- überarb.
- verbessert
- Versuchspersonen
- unter anderem
- Überarbeitet
- z.B.
- versus
- zum Beispiel
- Die Relevanz der Dienstleistungstypikalität für das Marketing
- Die Determinanten der Typikalität von Dienstleistungen
- Die Wirkungen der Typikalität auf Konsumentenverhalten und Verarbeitungsprozesse
- Die Messung der Typikalität von Dienstleistungen
- Implikationen für das Marketing
Abkürzungsverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit dem Thema der Typikalität von Dienstleistungen und untersucht, ob und inwieweit sich das Typikalitätsphänomen auf Dienstleistungen übertragen lässt. Die Arbeit analysiert die Determinanten, Wirkungen und Messung der Typikalität im Kontext von Dienstleistungen und untersucht deren Relevanz für das Marketing.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 beleuchtet die Relevanz der Dienstleistungstypikalität für das Marketing. Es werden die Besonderheiten des Dienstleistungsabsatzes im Vergleich zum Absatz von Sachgütern herausgestellt und der Begriff der Typikalität im Kontext von Dienstleistungen definiert. Darüber hinaus wird die Bedeutung der Typikalität als Einflussgröße des Konsumentenverhaltens diskutiert.
Kapitel 3 untersucht die Typikalität im Kontext der Kognitionspsychologie. Es werden verschiedene Modelle der Informationsverarbeitung und des Gedächtnisses vorgestellt, sowie die Rolle von Wissen und seiner Struktur bei der Kategorisierung von Objekten und Dienstleistungen. Der Fokus liegt auf der Wahrnehmung und Kategorisierung von Dienstleistungen und den Determinanten der Typikalität.
Kapitel 4 analysiert die Determinanten, Wirkungen und Messung der Typikalität von Dienstleistungen. Es werden verschiedene Ansätze zur Bestimmung der Typikalität vorgestellt, wie z.B. Attribute Sharing, Vertrautheit und Häufigkeit der Instantiierung, sowie die Rolle der Einstellung und des Kontextes. Darüber hinaus werden die Auswirkungen der Typikalität auf Verarbeitungsprozesse, Risikoempfinden und Produktbeurteilung untersucht.
Kapitel 5 beleuchtet die Implikationen der Typikalität für das Marketing. Es werden verschiedene Strategien zur Gestaltung von Dienstleistungen und Marketingmaßnahmen im Hinblick auf die Typikalität vorgestellt und die Bedeutung der Typikalität für die Positionierung und Differenzierung von Dienstleistungen im Markt diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Typikalität von Dienstleistungen, die Determinanten der Typikalität, die Wirkungen der Typikalität, die Messung der Typikalität, die Relevanz der Typikalität für das Marketing, die Kognitionspsychologie, Informationsverarbeitung, Gedächtnis, Wissen, Wahrnehmung, Kategorisierung, Konsumentenverhalten, Produktbeurteilung, Risikoempfinden, Marketingstrategien, Positionierung und Differenzierung.
- Quote paper
- Kerstin Rall (Author), 2004, Typikalität von Dienstleistungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186163