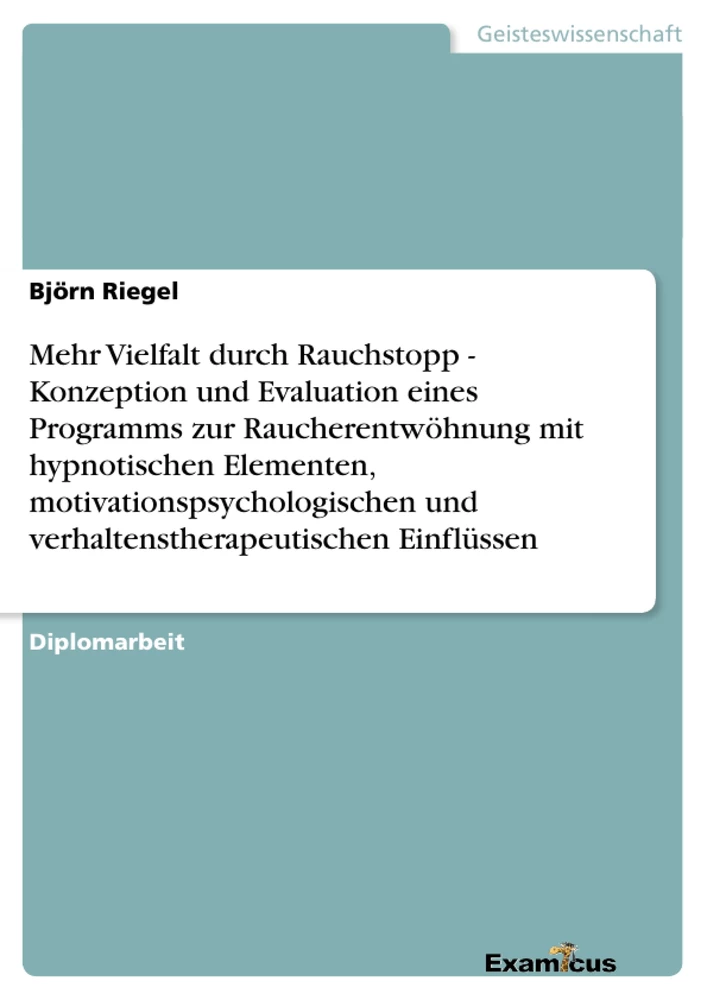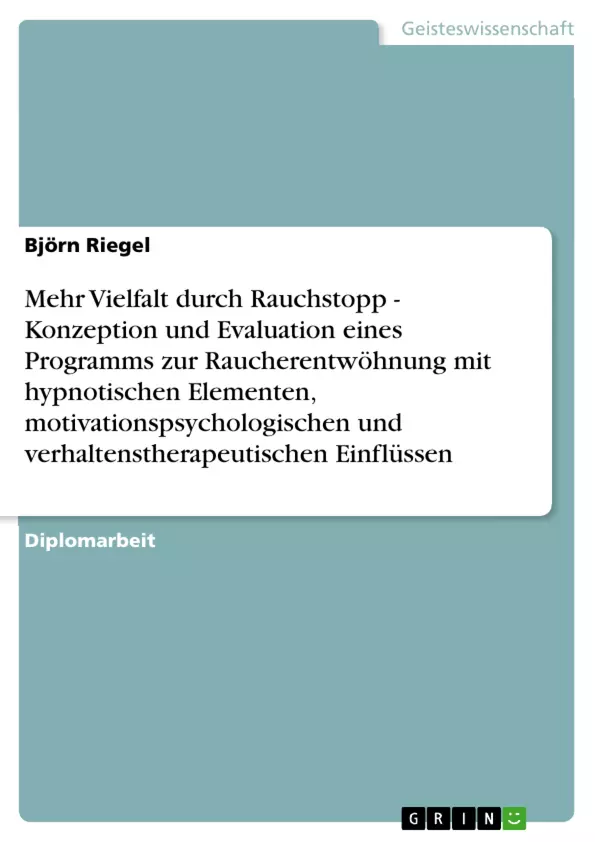Eine außergewöhnlich umfangreiche Diplomarbeit, in der die gängigen Verfahren der Raucherentwöhnung dargestellt werden und eine Einführung in die systemische Theorie und die Hypnose erfolgt. Daraus wurde ein Konzept zur Raucherentwöhnung entwickelt und an 100 Personen evaluiert, die sich in Einzel-, Gruppen- und Vergleichsbedingung aufteilen. Erfolgsquote der Hypnosegruppen: 42,5% nach 3 Monaten. Inklusive allen Tests und Handouts und ausführlichem Manual.
Inhaltsverzeichnis
- I. Theorieteil
- 1. Einleitung
- 2. Tabakkonsum und Nikotinabhängigkeit
- 2.1 Konsumverhalten in Deutschland
- 2.2 Inhaltsstoffe einer Zigarette
- 2.3 Gesundheitliche Folgen des andauernden Konsums
- 2.4 Abhängigkeit
- 2.4.1 Kriterien
- 2.4.2 Erklärungsmodelle
- 2.4.2.1 Systemische Theorien
- 2.4.2.2 Lernpsychologische Theorien
- 2.4.2.3 Psychodynamische Theorien
- 2.4.2.4 Physiologische Aspekte
- 3. Methoden der Raucherentwöhnung in Deutschland
- 3.1 Nicht-hypnotische Programme
- 3.1.1 Allen Carr’s „Easyway“
- 3.1.1.1 Carr-Gruppen
- 3.1.1.2 Selbsthilfeliteratur: „Endlich Nichtraucher“
- 3.1.2 Ärztliche Beratungsangebote
- 3.1.2.1 Rauchersprechstunde
- 3.1.2.2 Beratung für Schwangere
- 3.1.3 Verhaltenstherapeutische Programme
- 3.1.4 Selbsthilfe-Literatur
- 3.1.5 Nikotinsubstitution
- 3.2 Hypnose-Programme
- 3.2.1 SmokeX
- 3.2.2 Qualmstopp
- 3.2.3 Das Tübinger Modell
- 3.3 Rückfallverhütung
- 4. Hypnose und Hypnotherapie
- 4.1 Hypnotherapie nach Milton H. Erickson
- 4.2 Der Hypnosystemische Ansatz
- 4.3 Begrifflichkeiten und Prämissen der Therapie
- 4.4 Empirische Belege
- 4.5 Abgrenzung zur „Showhypnose“
- 5. Erfolgsparameter und Hypothesen
- 5.1 Erfolgsparameter
- 5.2 Hypothesen und Fragestellungen
- II. Empirischer Teil
- 6. Entwicklung des Programms „Rauchstopp“
- 6.1 Haltung des „Rauchstopp“-Beraters
- 6.2 Rahmenbedingungen und Ablauf
- 6.3 Hypnotische Interventionen
- 6.3.1 Transparente Interventionen
- 6.3.1.1 Ambivalenzarbeit
- 6.3.1.2 Dehypnotisieren der Eigensuggestionen
- 6.3.1.3 Sicherer Ort
- 6.3.1.4 Ideomotorik und Abschiedsdrehbuch
- 6.3.2 Indirekte Methoden
- 6.3.2.1 „My Friend John Technik“
- 6.3.2.2 Therapeutische und motivierende Geschichten
- 6.3.2.3 Minimax-Interventionen
- 6.4 Selbsthypnose-Training
- 6.5 Entspannungsmethoden
- 6.6 Verhaltenstherapeutische Elemente
- 6.7 Motivationspsychologische Einflüsse
- 6.8 Weitere Elemente
- 7. Methoden
- 7.1 Forschungsdesign
- 7.1.1 Experimentalbedingung
- 7.1.1.1 Gruppenhypnose-Setting
- 7.1.1.2 Einzelhypnose-Setting
- 7.1.2 Vergleichsbedingung
- 7.2 Stichprobe
- 7.2.1 Rekrutierung der Stichprobe
- 7.2.2 Beschreibung der Ausgangsstichprobe
- 7.2.3 Beschreibung der Katamnesestichprobe
- 7.3 Messinstrumente
- 7.3.1 Soziodemographische Daten
- 7.3.2 Fagerströmtest für Nikotinabhängigkeit FTNA
- 7.3.3 Symptomchecklist nach Derogatis SCL-90
- 7.3.4 Creative Imagination Scale CIS
- 7.3.5 Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens VEV
- 7.4 Ablaufschema der Datenerhebung
- 8. Ergebnisse
- 8.1 Datenauswertung
- 8.2 Darstellung der Ergebnisse
- 8.2.1 Haupthypothese 1: Hypnosebehandlung vs. Vergleichsgruppe
- 8.2.1.1 Abstinenzraten zur letzten Sitzung und nach drei Monaten
- 8.2.1.2 Reduktion der Nikotinabhängigkeit zur letzten Sitzung und nach drei Monaten
- 8.2.1.3 Zigarettenkonsum nach der letzten Sitzung und zum Katamnesezeitpunkt
- 8.2.2 Haupthypothese 2: Einzel- vs. Gruppenbehandlung
- 8.2.2.1 Abstinenzraten zu drei Messzeitpunkten
- 8.2.2.2 Reduktion der Nikotinabhängigkeit zu drei Messzeitpunkten
- 8.2.2.3 Reduktion des Konsums zu drei Messzeitpunkten
- 8.2.3 Hypothese 3: Suggestibilität als Moderatorvariable
- 8.2.4 Hypothese 4: Rauchverhalten
- 8.2.5 Hypothese 5: Psychische Belastung
- 8.2.5.1 Psychische Belastung anhand des Globalen Kennwertes GSI
- 8.2.5.2 Differenzierte Betrachtung einzelner Skalen
- 8.2.6 Hypothese 6: Erlebte Veränderung
- 8.2.7 Hypothese 7: Demographische Variablen
- 8.2.7.1 Alter
- 8.2.7.2 Geschlecht
- 8.2.7.3 Partnerschaft
- 8.2.7.4 Schulabschluss
- 8.2.8 Hypothese 8: Motivation
- 8.2.9 Weitere Ergebnisse
- 8.2.9.1 Differenzierte Erfolgsmessung in der Experimentalgruppe
- 8.2.9.2 Zusammenhang zwischen der Abstinenz zu verschiedenen Messzeitpunkten
- 8.2.9.3 Vergleich der Dropout-Teilnehmer mit der Ausgangsstichprobe
- 9. Qualitative Auswertung
- 9.1 Qualitatives Vorgehen
- 9.2 Erste Fragestellung: Motivation
- 9.3 Zweite Fragestellung: Zustandsumschreibung
- 9.4 Dritte Fragestellung: Gründe für den vorzeitigen Programm-Abbruch
- 10. Diskussion und Ausblick
- 10.1 Diskussion der Ergebnisse
- 10.2 Methodenkritik und Ausblick
- Zusammenfassung
- Wirksamkeit hypnotherapeutischer Interventionen bei der Raucherentwöhnung
- Vergleich von Einzel- und Gruppentherapie im Kontext der Raucherentwöhnung
- Einflussfaktoren auf den Erfolg der Raucherentwöhnung (z.B. Suggestibilität, psychische Belastung, Motivation)
- Qualitative Analyse der Motive und des Erlebens von Rauchern
- Entwicklung einer positiven Bezeichnung für den rauchfreien Zustand
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit zielt auf die Entwicklung und Evaluation eines ökonomischen Programms zur Raucherentwöhnung ab. Das Programm „Rauchstopp“ kombiniert hypnotherapeutische Elemente mit verhaltenstherapeutischen und motivationspsychologischen Ansätzen. Die Evaluation soll die Wirksamkeit des Programms im Vergleich zu einer Selbsthilfemethode belegen.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Theorieteil: Dieser Teil legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Kapitel 1 führt in das Thema ein und beleuchtet die Herausforderungen beim Rauchstopp. Kapitel 2 beschreibt Tabakkonsum, Nikotinabhängigkeit und deren gesundheitliche Folgen, inklusive verschiedener Erklärungsmodelle. Kapitel 3 präsentiert verschiedene Methoden der Raucherentwöhnung in Deutschland, sowohl hypnotische als auch nicht-hypnotische. Kapitel 4 beschreibt die theoretischen Grundlagen der Hypnose und Hypnotherapie, insbesondere den Ansatz von Milton H. Erickson und den hypnosystemischen Ansatz. Schließlich werden in Kapitel 5 die Erfolgsparameter und Hypothesen der Studie definiert.
II. Empirischer Teil: Dieser Teil präsentiert die empirische Untersuchung des entwickelten Programms „Rauchstopp“. Kapitel 6 beschreibt detailliert die Konzeption des Programms, einschließlich der therapeutischen Haltung, des Ablaufs und der verwendeten Interventionen. Kapitel 7 erläutert das Forschungsdesign, die Stichprobe und die eingesetzten Messinstrumente. Kapitel 8 präsentiert die quantitativen Ergebnisse der Studie, analysiert die Haupthypothesen und untersucht weitere Einflussfaktoren auf den Erfolg der Raucherentwöhnung. Kapitel 9 widmet sich der qualitativen Auswertung der Daten, analysiert die Motive der Teilnehmer und die Gründe für vorzeitige Programmabbruche. (Der Schluss wird aufgrund der Anweisung, keine Spoiler zu enthalten, hier ausgelassen).
Schlüsselwörter
Raucherentwöhnung, Hypnotherapie, Hypnosystemischer Ansatz, Verhaltenstherapie, Motivationspsychologie, Nikotinabhängigkeit, Suggestibilität, Selbsthilfe, Erfolgsfaktoren, Qualitative Forschung, Abstinenz, Rückfallprävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Raucherentwöhnung durch Hypnose
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und Evaluation eines ökonomischen Programms zur Raucherentwöhnung namens „Rauchstopp“. Dieses Programm kombiniert hypnotherapeutische Elemente mit verhaltenstherapeutischen und motivationspsychologischen Ansätzen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Wirksamkeit des „Rauchstopp“-Programms im Vergleich zu einer Selbsthilfemethode zu belegen und die Wirksamkeit hypnotherapeutischer Interventionen bei der Raucherentwöhnung zu untersuchen. Weiterhin werden der Vergleich von Einzel- und Gruppentherapie, der Einfluss von Faktoren wie Suggestibilität, psychische Belastung und Motivation auf den Erfolg sowie eine qualitative Analyse der Motive und des Erlebens von Rauchern analysiert.
Welche Methoden werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet sowohl quantitative als auch qualitative Methoden. Der quantitative Teil umfasst ein experimentelles Forschungsdesign mit einer Experimental- und einer Vergleichsgruppe. Es werden verschiedene Messinstrumente eingesetzt, darunter der Fagerströmtest für Nikotinabhängigkeit (FTNA), die Symptomchecklist nach Derogatis (SCL-90) und die Creative Imagination Scale (CIS). Der qualitative Teil beinhaltet eine Analyse der Interviews mit den Teilnehmern.
Welche Hypothesen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Hypothesen, unter anderem die Wirksamkeit der Hypnosebehandlung im Vergleich zur Vergleichsgruppe, den Vergleich von Einzel- und Gruppenbehandlung, den Einfluss der Suggestibilität, die Rolle des Rauchverhaltens und der psychischen Belastung sowie den Einfluss demografischer Variablen und der Motivation auf den Erfolg der Raucherentwöhnung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in einen Theorie- und einen Empirieteil gegliedert. Der Theorieteil behandelt die Grundlagen des Tabakkonsums, der Nikotinabhängigkeit, verschiedener Raucherentwöhnungsmethoden und der Hypnotherapie. Der Empirieteil beschreibt das „Rauchstopp“-Programm, das Forschungsdesign, die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Auswertung sowie eine abschließende Diskussion.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert quantitative Ergebnisse zur Abstinenzrate, zur Reduktion der Nikotinabhängigkeit und zum Zigarettenkonsum zu verschiedenen Messzeitpunkten. Sie analysiert den Einfluss der untersuchten Hypothesen und präsentiert qualitative Ergebnisse zu den Motiven der Teilnehmer und den Gründen für vorzeitige Programmabbruche. Die detaillierten Ergebnisse sind im Kapitel 8 (quantitative Ergebnisse) und Kapitel 9 (qualitative Ergebnisse) nachzulesen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit werden in Kapitel 10 (Diskussion und Ausblick) präsentiert. Sie beinhalten eine Diskussion der Ergebnisse, eine Methodenkritik und einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Raucherentwöhnung, Hypnotherapie, Hypnosystemischer Ansatz, Verhaltenstherapie, Motivationspsychologie, Nikotinabhängigkeit, Suggestibilität, Selbsthilfe, Erfolgsfaktoren, Qualitative Forschung, Abstinenz, Rückfallprävention.
- Citar trabajo
- Björn Riegel (Autor), 2006, Mehr Vielfalt durch Rauchstopp - Konzeption und Evaluation eines Programms zur Raucherentwöhnung mit hypnotischen Elementen, motivationspsychologischen und verhaltenstherapeutischen Einflüssen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186216