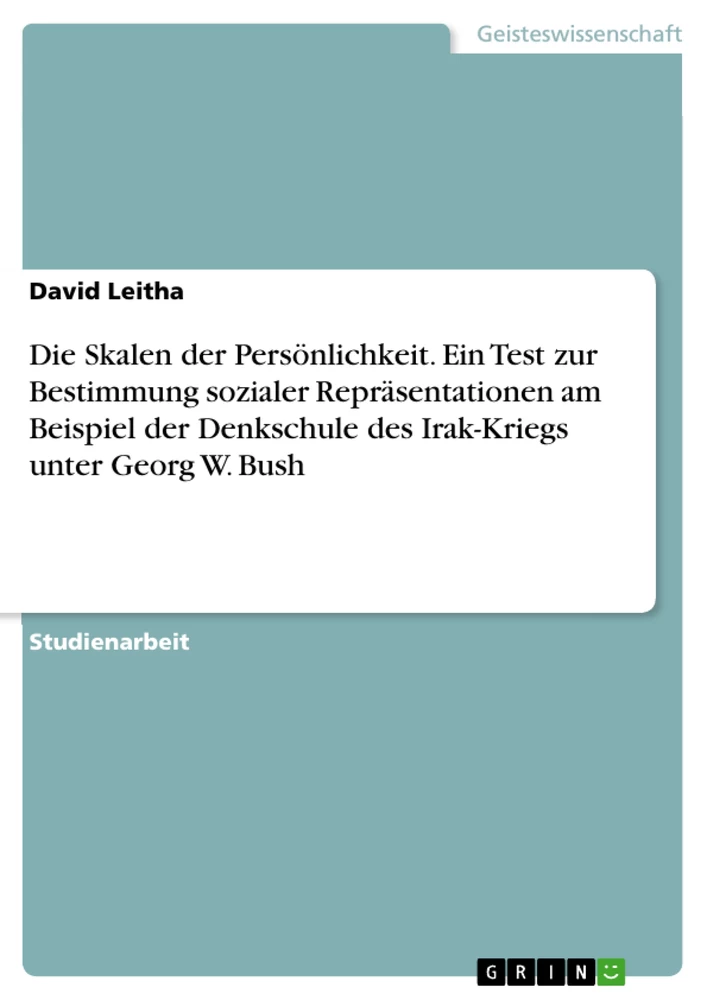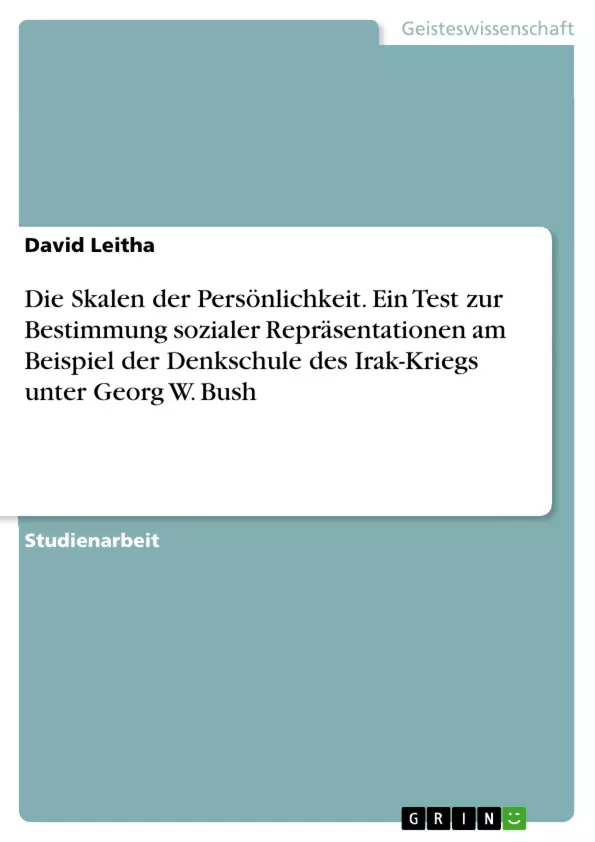Partikulogische Persönlichkeitsdiagnostik
Persönlichkeitsdiagnostik steht im Dienst der psychologischen / klin. psychologischen Beratung, psychologischen / klin. psychologischen Behandlung, sowie der Personalvorauswahl und -auswahl, der Berufseigungsüberprüfung, der Berufslaufbahnberatung, und gewiß noch einigen weiteren Fachbereichen.
Was wird diagnostiziert?
Einige Persönlichkeits-relevante Phänomene des Menschseins: Interessen, Emotionen, Lieblingsbeschäftigungen (=Hobbies), Arten von Ängsten, Neigung und Umgang bzgl. Streß(=Überbelastung), Extraversion/Introversion, und vieles ähnliche mehr.
Alle "Dienstgeber", für die eine persönlichkeitsdiagnostische Untersuchung gemacht wird, erwarten Aufklärung über die besonders ausgeprägten Eigenschaften eines Menschen, die schlechten sowie die guten. Die guten Eigenschaften interessieren immer, die schlechten nur deshalb, weil sie anstelle bestimmter guter Eigenschaften in demjenigen Menschen vorkommen.
Was ist eine gute Eigenschaft?
Im Berufsleben, betreffs Arbeitspotential, bei der Berufssuche, aber auch in der privaten Hilfebedürftigkeit, im Krankheitsfall, oder in Situationen mit besonderen Anforderungen, in Krisensituationen und ähnlichem interessieren die für all diese Belange erstrebenswerten und hilfreichen Eigenschaften zur Bewältigung der betreffenden Aufgaben. Sind diese oder manche von diesen Eigenschaften nicht gegeben, so gibt es gesetzliche, ethische, oder ungeschriebene, gesellschaftlich aber verlangte Vorgaben, wie mit dem betrefffenden Menschen umzugehen ist. Man weist hin, man bestraft, man maßregelt, man verbietet. Jeder moderne Staat hat ein Rechtssystem, in dem verschiedene Menschen mit diesen Regelungen im Bezug auf andere Menschen, denen bestimmte gute Eigenschaften fehlen, betraut sind: Polizisten, Rechtsanwälte, Detektive, Ärzte, Therapeuten, Lehrer, und so weiter.
Dieses Rechtssystem ist in verschiedenen Staaten auf verschiedene Weise weiterentwickelt, die Gesetzgebung reicht in verschiedenen Staaten unterschiedliche weit ins Verkehrstechnische, in die Medikamentenabrechnung, zum Drogenverbot und Gewaltverzicht, unterschiedlich weit also in die Infrastruktur des Berufs- und Privatlebens.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung: Bedarf eines Tests für soziale Repräsentationen
- Theorie: Auf dem kognitiven Stil der Persönlichkeit von Personen einer Gruppe aufbauend können sich für diese Gruppe bezeichnende soziale Repräsentationen entwickeln, die zusammengefasst eine Denkschule begründen.
- Hypothese: Jemand kann aufgrund seines kognitiven Stiles der Persönlichkeit (Denkstil von einem Einzelnen) eine überzufällige Neigung zu bestimmten sozialen Repräsentationen haben.
- Erklärungen zu den zentralen Begriffen im Modell
- 1. Bedarf eines Tests für Soziale Repräsentationen
- 2. Soziale Repräsentationen
- 3. Denkschule
- 4. Der Test
- 5. Die Denkschule des Irak-Kriegs
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, einen Persönlichkeitstest zu entwickeln, der soziale Repräsentationen aufdecken kann. Der Test soll auf dem kognitiven Stil der Persönlichkeit basieren und die Hypothese untersuchen, dass Personen aufgrund ihres Denkstils eine überzufällige Neigung zu bestimmten sozialen Repräsentationen haben.
- Soziale Repräsentationen als Ausdruck von Gruppendenken
- Der Einfluss des kognitiven Stils auf soziale Repräsentationen
- Entwicklung eines Persönlichkeitstests zur Erfassung sozialer Repräsentationen
- Anwendung des Tests auf die Denkschule des Irak-Kriegs
- Bedeutung der Ergebnisse für das Verständnis von sozialen Repräsentationen und Gruppendynamik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Problemstellung und den Bedarf eines Tests für soziale Repräsentationen. Es wird argumentiert, dass soziale Repräsentationen ein wichtiges Element des Gruppendenkens sind und dass ein Test, der diese Repräsentationen aufdecken kann, wertvolle Erkenntnisse liefern könnte. Das zweite Kapitel stellt die theoretischen Grundlagen des Tests vor, die auf dem kognitiven Stil der Persönlichkeit basieren. Es wird erläutert, wie sich aus dem Denkstil von Personen einer Gruppe bezeichnende soziale Repräsentationen entwickeln können, die zusammengefasst eine Denkschule begründen. Das dritte Kapitel präsentiert die Hypothese, dass Personen aufgrund ihres kognitiven Stiles der Persönlichkeit eine überzufällige Neigung zu bestimmten sozialen Repräsentationen haben. Das vierte Kapitel erläutert die zentralen Begriffe des Modells, darunter soziale Repräsentationen, Denkschule und der Test selbst. Das fünfte Kapitel analysiert die Denkschule des Irak-Kriegs unter George W. Bush anhand des entwickelten Tests. Es werden die sozialen Repräsentationen der Vordenker des Irak-Kriegs untersucht und die Ergebnisse im Kontext der Gruppendynamik interpretiert.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen soziale Repräsentationen, Denkstil, Persönlichkeit, Gruppendynamik, Denkschule, Irak-Krieg, George W. Bush, Persönlichkeitstest, kognitive Psychologie, Soziologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des hier vorgestellten Persönlichkeitstests?
Der Test soll soziale Repräsentationen aufdecken und untersuchen, ob Individuen aufgrund ihres kognitiven Denkstils eine Neigung zu bestimmten kollektiven Denkschulen haben.
Was versteht man unter einer "Denkschule"?
Eine Denkschule fasst die für eine bestimmte Gruppe bezeichnenden sozialen Repräsentationen zusammen, die auf einem gemeinsamen kognitiven Stil basieren.
Wie wird das Modell am Beispiel des Irak-Kriegs angewendet?
Die Arbeit analysiert die Denkschule der Vordenker des Irak-Kriegs unter George W. Bush und untersucht deren soziale Repräsentationen im Kontext der Gruppendynamik.
Welche Rolle spielt der kognitive Stil der Persönlichkeit?
Es wird die Hypothese aufgestellt, dass der individuelle Denkstil maßgeblich beeinflusst, welche gesellschaftlichen oder politischen Sichtweisen (soziale Repräsentationen) eine Person übernimmt.
Wofür wird Persönlichkeitsdiagnostik allgemein eingesetzt?
Sie dient der psychologischen Beratung, der Personalauswahl, der Berufseignungsprüfung sowie der Bewältigung von Krisensituationen im privaten und beruflichen Umfeld.
- Quote paper
- David Leitha (Author), 2006, Die Skalen der Persönlichkeit. Ein Test zur Bestimmung sozialer Repräsentationen am Beispiel der Denkschule des Irak-Kriegs unter Georg W. Bush, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186336