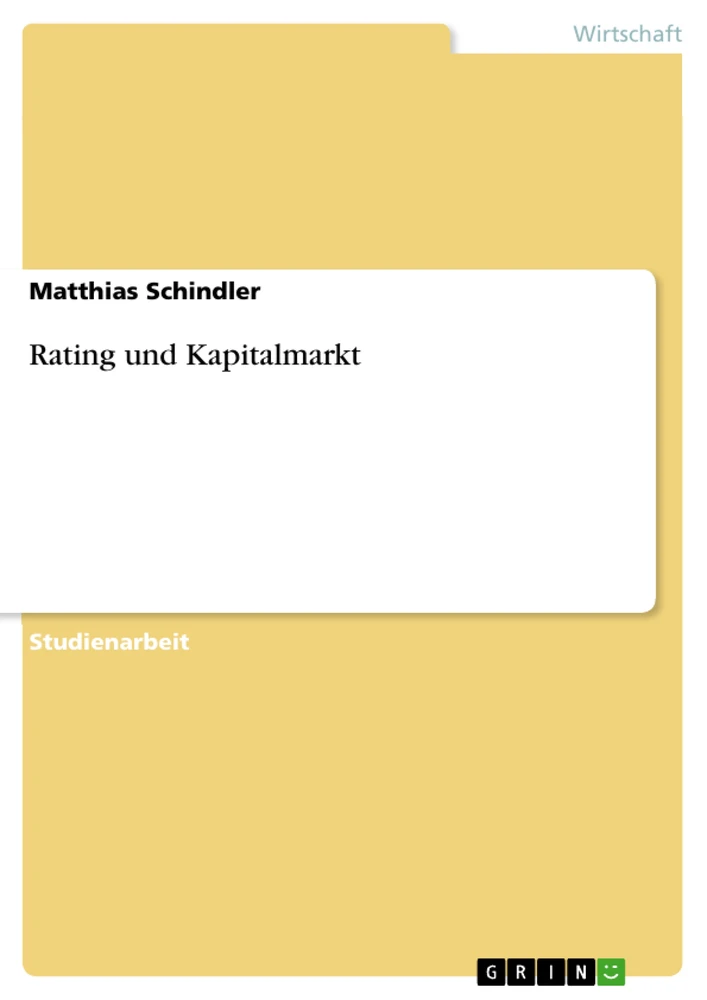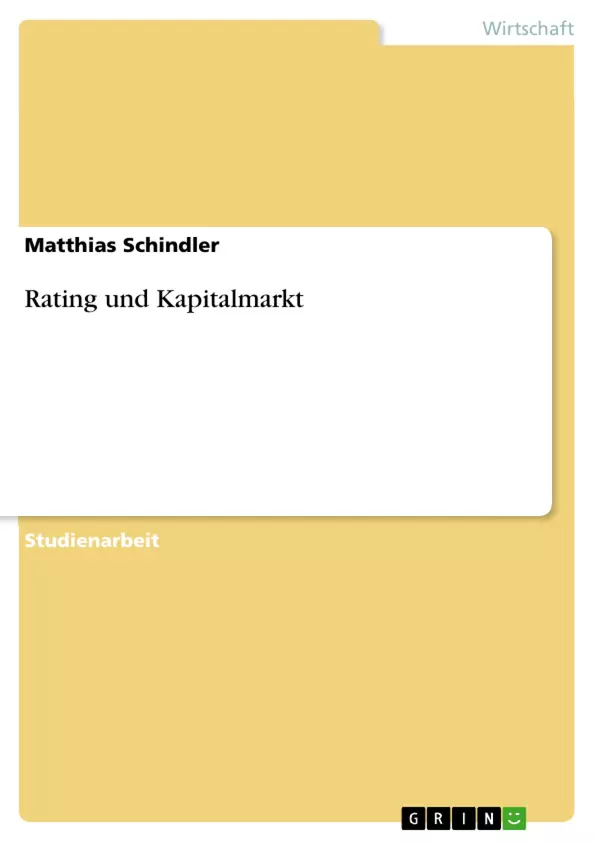Generell ist ein Rating eine Bewertung mit dem Ergebnis eines spezifisch definierten
Symbols innerhalb einer ordinalen Skala. Rating findet in allen Lebensbereichen
statt, z.B. in der Bewertung von Hotels, Restaurants, Produkten, etc. Am
Kapitalmarkt versteht man unter Rating die Bewertung der Bonität von z.B. Ländern,
Banken, Industrieunternehmen, Geldmarkt- und/oder Kapitalmarkttiteln. Bonität
ist die Fähigkeit und Bereitschaft eines Schuldners, seinen Zahlungsverbindlichkeiten
in voller Höhe und rechtzeitig nachkommen zu können. Genauer gesagt,
drücken Ratings am Kapitalmarkt Meinungen über Ausfallwahrscheinlichkeiten
von z.B. Schuldverschreibungen aus. Einem Ratingsymbol wird aber nicht genau
eine Wahrscheinlichkeit, sondern ein bestimmtes Intervall von mehreren statistisch
nachgewiesenen Wahrscheinlichkeiten zugeordnet.
Die Ratingsymbole werden als eine Buchstaben- und Zahlen-/ Zeichenkombination
ausgedrückt. Bei Standard & Poors, einer wirtschaftlich selbständigen US Ratingagentur,
geht das Ranking von AAA bis D, wobei AAA höchste und D (default)
niedrigste Bonität bedeutet. Das einzelne Ratingergebnis kann zusätzlich noch mit
einer Tendenz (+/-) versehen werden. Zwischen BBB- und BB+ erfolgt zusätzlich
eine Trennung in Investment (rel. sicher) und Speculative Grade (riskant). Um im
„Wilden Westen“ die damals erheblichen, für den Eisenbahnbau benötigten Finanzmittel
bewerten zu können, wurde 1909 von John Moody (Moody`s Investors
Service, New York) die ursprüngliche Ratingsymbolik und –struktur entwickelt.[...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Was ist das Rating und der Kapitalmarkt?
- 1.1 Rating
- 1.2 Kapitalmarkt
- 2. Status quo am Deutschen und Gesamteuropäischen Kapitalmarkt
- 2.1 Die Verbriefte Verschuldung im internationalen Vergleich
- 2.2 Die Ratingkultur an internationalen Kapitalmärkten
- 3. Nutzen und Grenzen des Ratings für die Kapitalmarktteilnehmer
- 3.1 Marktakzeptanz des Ratings
- 3.2 Was bedeutet ein Rating für den Emittenten?
- 3.2.1 Informationsgewinn für den Emittenten
- 3.2.2 Das Rating als Instrument in der Emissionspolitik
- 3.2.3 Rating als Kommunikationsinstrument für das Image
- 3.3 Was bedeutet ein Rating für den Investor?
- 3.3.1 Informationsfunktion für die Anleger
- 3.3.2 Instrument für ein aktives Portfoliomanagement
- 3.4 Was bringt ein Rating den Banken und der Finanzmarktaufsicht?
- 3.4.1 Was bedeutet das externe Rating für die Banken?
- 3.4.2 Was bedeutet das Rating für die Finanzmarktaufsicht?
- 4. Was bewirkt das Rating auf dem Finanzmarkt?
- Entwicklung und Bedeutung der Ratingkultur am Kapitalmarkt
- Nutzen und Grenzen von Ratings für Kapitalmarktteilnehmer
- Einfluss von Ratings auf die Finanzmarktentwicklung
- Vergleich der Ratingkultur in Europa und den USA
- Der Zusammenhang zwischen Ratings und der Verbriefung von Fremdkapital
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit „Rating und Kapitalmarkt“ analysiert die Bedeutung von Ratings im Kontext der Finanzmärkte und beleuchtet die Entwicklung der Ratingkultur in Europa und den USA. Sie untersucht die Vorteile und Grenzen des Ratings aus verschiedenen Perspektiven, darunter Emittenten, Investoren, Banken und Finanzmarktaufsicht.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Begriffe Rating und Kapitalmarkt. Im zweiten Kapitel wird die Situation der Verbriefung von Fremdkapital und die aktuelle Entwicklung der Ratingkultur in Europa und den USA analysiert. Das dritte Kapitel befasst sich mit der Akzeptanz des Ratings am Markt und beschreibt die Vorteile und Grenzen des Ratings aus der Sicht der Kapitalmarktteilnehmer.
Schlüsselwörter
Rating, Kapitalmarkt, Ratingkultur, Bonität, Ausfallwahrscheinlichkeit, Verbriefte Verschuldung, Finanzmarktaufsicht, Basel II, Emissionspolitik, Anleger, Banken, Investment Grade, Speculative Grade.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter einem Rating am Kapitalmarkt?
Ein Rating ist eine Meinung über die Ausfallwahrscheinlichkeit eines Schuldners, ausgedrückt durch Symbole wie AAA bis D.
Was ist der Unterschied zwischen Investment Grade und Speculative Grade?
Investment Grade (bis BBB-) gilt als relativ sicher, während Speculative Grade (ab BB+) als riskant eingestuft wird.
Welchen Nutzen hat ein Rating für einen Emittenten?
Es dient als Informations- und Kommunikationsinstrument, verbessert das Image und unterstützt die aktive Emissionspolitik am Markt.
Wer entwickelte die ursprüngliche Ratingsymbolik?
Die ursprüngliche Struktur wurde 1909 von John Moody entwickelt, um Finanzmittel für den Eisenbahnbau in den USA bewerten zu können.
Welche Rolle spielt die Finanzmarktaufsicht beim Rating?
Ratings sind zentrale Instrumente für die Aufsicht (z.B. Basel II), um die Eigenkapitalhinterlegung von Banken und die Stabilität der Märkte zu regulieren.
- Citar trabajo
- Matthias Schindler (Autor), 2001, Rating und Kapitalmarkt, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186445