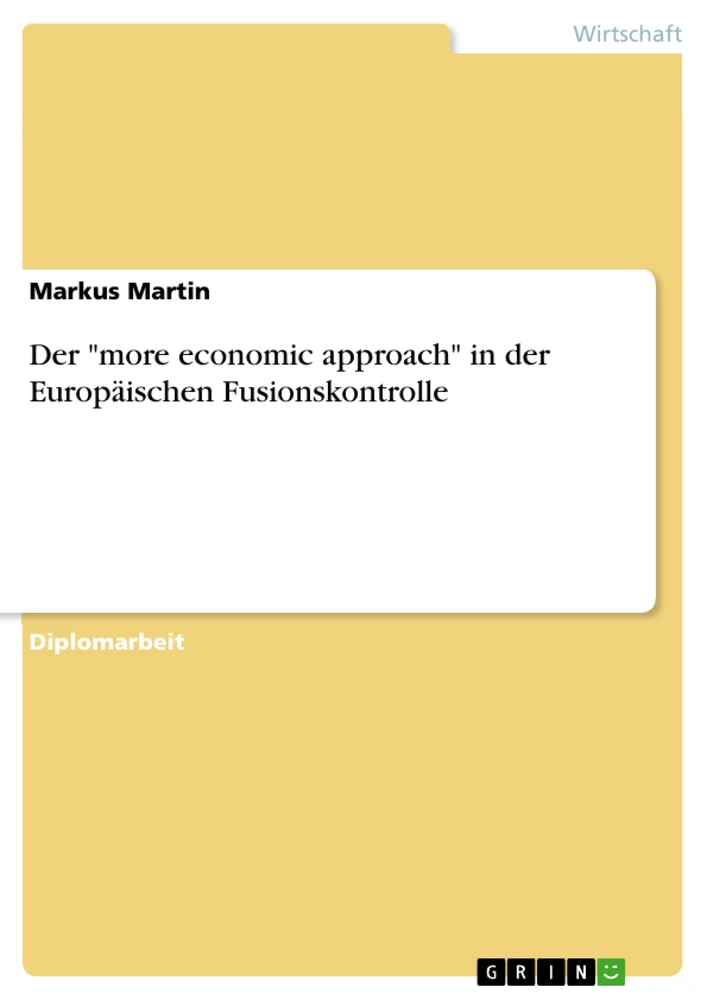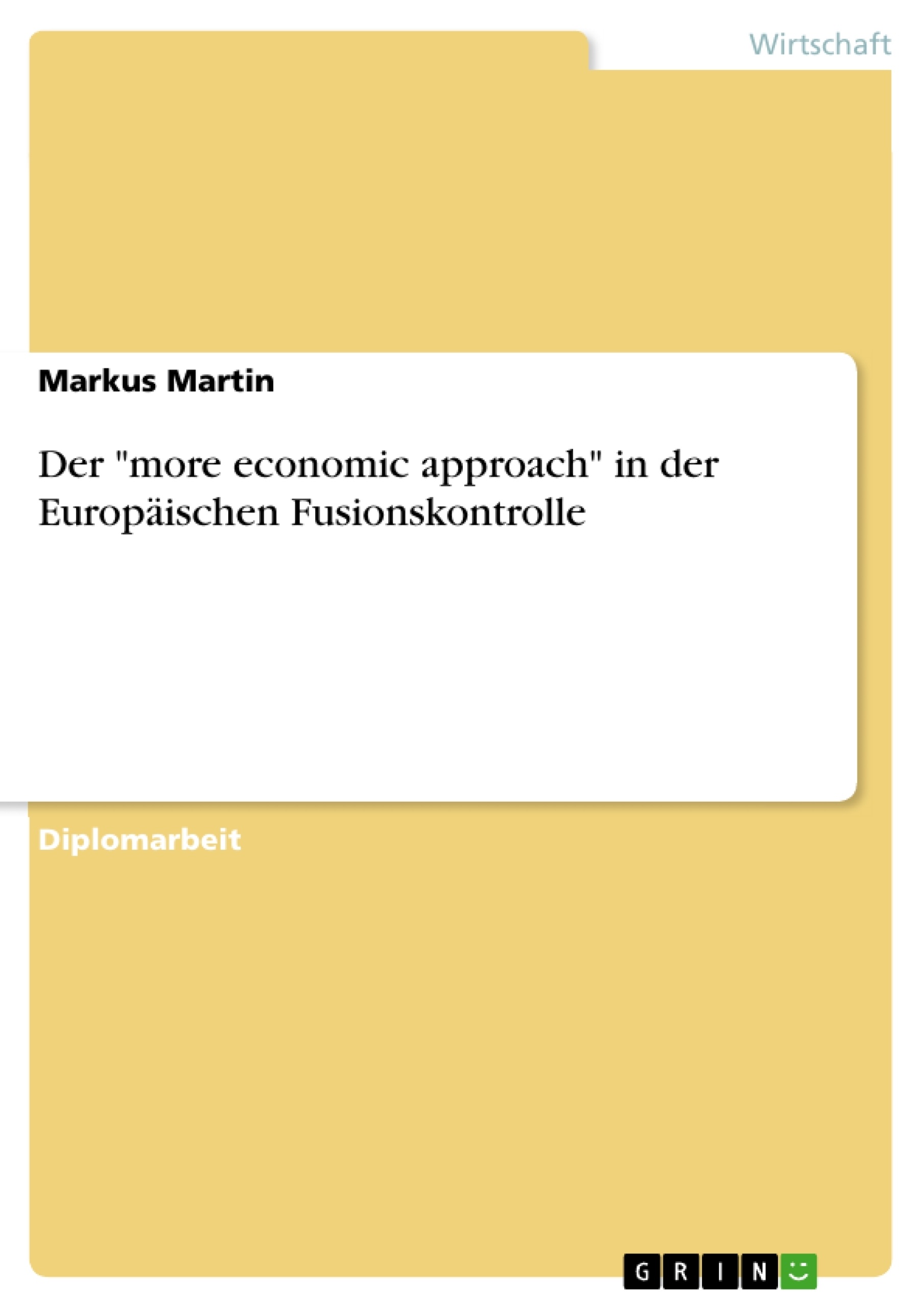Der „more economic approach“ ist zum Schlagwort des Reformprozesses geworden, der sich seit einigen Jahren im europäischen Wettbewerbsrecht vollzieht. Die Veränderungen reichen von einer Neufassung der Kartell- und Fusionskontrollverordnungen über die derzeitige Diskussion über das Missbrauchsverbot für marktbeherrschende Unternehmen bis hin zur Beihilfenkontrolle. In wenige Worte gefasst, bedeutet der „more economic approach“ eine konsequente Ausrichtung der gesamten Wettbewerbspolitik am aktuellen und wissenschaftlich anerkannten Stand der industrieökonomischen Theorie, um zu verhindern, dass ökonomisch falsche Entscheidungen getroffen werden.1 Ein Unternehmenszusammenschluss beispielsweise kann auf der einen Seite ein Übermaß an Konzentration und Marktmacht zur Folge haben, auf der anderen Seite kann er auch wünschenswerte Wohlfahrtseffekte durch die Realisierung von Effizienzgewinnen bringen.
Die Ökonomisierung des Kartellrechts versucht dem durch die verstärkte Berücksichtigung ökonomischer Konzepte Rechnung zu tragen und unternehmerisches Verhalten hinsichtlich seiner konkreten Auswirkungen im jeweils relevanten Markt zu beurteilen.
Das Ziel ist eine stärkere Ausrichtung der gemeinschaftlichen Wettbewerbspolitik auf den Schutz der Konsumentenwohlfahrt.2 So sagte etwa der ehemalige EUWettbewerbskommissar Monti: “Actually, the goal of competition policy, in all its aspects, is to protect consumer welfare by maintaining a high degree of competition in the common market.”3 Diese Ausrichtung bedeutet eine Akzentverschiebung in der Wettbewerbspolitik der Kommission mit Folgen für den Schutzgegenstand des Wettbewerbsrechts.4
[...]
1 Vgl. etwa Budzinski, (2007), S. 1; Schwalbe/Zimmer, (2006), S. 397; Röller, (2005a), S. 37ff.
2 Vgl. Albers, M., (2006), S. 1; Monti, Rede v. 7.11.2002, (Speech/02/545), S. 2; Röller, (a.a.O), S. 37.
3 Monti: „The Future for Competition Policy in the EU“, Rede v. 9.7.2001, Merchant Taylor’s Hall, Lon.
4 Vgl. Albers, M., (2006), S. 3; BKartA, Diskussionspapier v. 29.9.2004, S. 1; Budzinski, (2007), S. 1.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel: Einleitung
- Kapitel: Die Europäische Fusionskontrolle
- Entwicklung der Europäischen Fusionskontrolle
- Die Europäische Einigung und das Bedürfnis nach einer Fusionskontrolle
- Marktbeherrschung als Beurteilungsmaßstab
- Gründe für eine Reform und den „more economic approach“
- Kapitel: Der „more economic approach“ in der Fusionskontrolle
- Der „more economic approach“ in der Wettbewerbspolitik
- Quantitative Methoden zur Marktabgrenzung
- Traditionelles Bedarfsmarktkonzept
- Hypothetischer Monopolistentest
- Vergleich und Bewertung
- „SIEC“-Test als neues Untersagungskriterium
- Der „Babyfood-Merger“-Fall
- Diskussion und Kompromiss
- Verhältnis zur Marktbeherrschung
- Efficiency Defense
- Leitlinien für horizontale Unternehmenszusammenschlüsse
- Vergleich mit den US Horizontal Merger Guidelines
- Organisatorische Veränderungen
- Ergebnisse und Stellungnahme
- Kapitel: Ordnungspolitische Kritik am „more economic approach“
- Ausgangspunkt: Wettbewerbsfreiheit oder Effizienzansatz
- Leitbilder der Wettbewerbstheorie
- Workable Competition (Harvard School)
- Konzept der Wettbewerbsfreiheit
- Chicago School
- Wohlfahrtsökonomischer versus Systemtheoretischer Ansatz
- Leitbild unter der VO Nr. 4064/89 und dem „more economic approach“
- Kritik am Effizienz- und Wohlfahrtsziel des „more economic approach“
- Erkenntnistheoretische Defizite
- Wettbewerbsfreiheit und Verhinderung von Marktbeherrschung als Ziel
- Primärrechtliche Grenzen eines „more economic approach“
- „Rule of Law“ und Eigengesetzlichkeit des Rechts
- Zusammenfassung der Kritik
- Diskussion und Stellungnahme
- Kapitel: Eingreifkriterien des „more economic approach“
- Allgemeines
- Unilaterale Effekte
- Preiswettbewerb bei differenzierten Gütern (Bertrand-Wettbewerb)
- Mengenwettbewerb bei homogenen Gütern (Cournot-Wettbewerb)
- Erfassung unilateraler Effekte in den Leitlinien
- Bewertung und Modelle zur Prognose unilateraler Effekte
- Merger Simulation Models (MSM)
- Chancen und Risiken von Simulationsmodellen
- Simulationsmodelle in der Kommissionspraxis: Der Fall Oracle/PeopleSoft
- Weitere Fälle
- Ergebnisse und Stellungnahme
- Koordinierte Effekte
- Ökonomischer Hintergrund
- Erfassung koordinierter Effekte in den Leitlinien
- Der Fall Sony/BMG
- Ergebnisse und Stellungnahme
- Kapitel: Efficiency Defense
- Allgemeines
- Arten von Effizienzen bei Zusammenschlüssen
- Williamson’s Trade-off Modell
- Der maßgebende Wohlfahrtsstandard
- Effizienzen unter der VO Nr. 4064/89
- Bedingungen für Effizienzen im Rahmen des „more economic approach“
- Bewertung der Effizienzeinrede
- Unbestimmtheit des Effizienzbegriffs und Beurteilungsspielräume
- Nicht-Berücksichtigung qualitativer Effizienzvorteile
- Partialanalytisches Konzept
- Nachprüfbarkeit von Effizienzvorteilen und Erhöhung des Verfahrensaufwands
- Berechenbarkeit von Effizienzgewinnen
- Problem „Consumer pass-on“
- Einzelfallbetrachtung oder „general presumptions approach“?
- Ergebnisse und Stellungnahme
- Kapitel: Praktische Bewertung des „more economic approach“
- Allgemeines
- Auswirkungen auf die Operationalität
- Auswirkungen auf die Rechtssicherheit
- Kapitel: Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den „more economic approach“ in der europäischen Fusionskontrolle. Ziel ist es, die ökonomischen Grundlagen, die Anwendung und die ordnungspolitische Kritik dieses Ansatzes zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung und die Implikationen für die Praxis der Fusionskontrolle.
- Entwicklung und Implementierung des „more economic approach“
- Ökonomische Modellierung und Prognose von Fusionswirkungen
- Ordnungspolitische Debatte um den „more economic approach“
- Praktische Anwendung und Herausforderungen
- Rechtssicherheit und Operationalität
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel: Die Europäische Fusionskontrolle: Dieses Kapitel beschreibt die historische Entwicklung der europäischen Fusionskontrolle, beginnend mit dem Entstehen der Europäischen Einigung und dem daraus resultierenden Bedarf an einer einheitlichen Kontrollinstanz für Fusionen. Es werden die grundlegenden Beurteilungsmaßstäbe erläutert und die Gründe für die Reform hin zu einem „more economic approach“ detailliert dargelegt, unter Berücksichtigung der Herausforderungen und der Notwendigkeit einer effizienteren und ökonomisch fundierteren Bewertung von Unternehmenszusammenschlüssen.
Kapitel: Der „more economic approach“ in der Fusionskontrolle: Dieser Abschnitt analysiert den „more economic approach“ umfassend. Es werden quantitative Methoden zur Marktabgrenzung wie der hypothetische Monopolistentest und das traditionelle Bedarfsmarktkonzept vorgestellt und verglichen. Der „SIEC“-Test als neues Untersagungskriterium wird im Detail erläutert, inklusive der Diskussion um den „Babyfood-Merger“-Fall. Weiterhin werden Themen wie die „Efficiency Defense“, die Leitlinien für horizontale Unternehmenszusammenschlüsse, und ein Vergleich mit den US-amerikanischen Richtlinien behandelt, um ein umfassendes Bild des „more economic approach“ zu zeichnen.
Kapitel: Ordnungspolitische Kritik am „more economic approach“: Dieses Kapitel widmet sich der kritischen Auseinandersetzung mit dem „more economic approach“. Es werden verschiedene wettbewerbspolitische Leitbilder wie die Harvard School, die Chicago School und der wohlfahrtsökonomische Ansatz gegenübergestellt. Die Kritikpunkte konzentrieren sich auf erkenntnistheoretische Defizite, die potenzielle Vernachlässigung der Wettbewerbsfreiheit zugunsten von Effizienzgesichtspunkten, primärrechtliche Grenzen und die Frage der Rechtssicherheit. Eine eingehende Diskussion der Argumentationslinien und deren Implikationen rundet das Kapitel ab.
Kapitel: Eingreifkriterien des „more economic approach“: Hier werden die Eingreifkriterien des „more economic approach“ detailliert untersucht. Der Fokus liegt auf der Unterscheidung zwischen unilateralen und koordinierten Effekten. Für unilaterale Effekte werden verschiedene Modelle zur Prognose, wie Merger Simulation Models (MSM), vorgestellt und anhand von Fallbeispielen (z.B. Oracle/PeopleSoft) illustriert. Die Analyse koordinierter Effekte wird anhand des Sony/BMG Falls veranschaulicht. Die Stärken und Schwächen der jeweiligen Modelle werden kritisch diskutiert.
Kapitel: Efficiency Defense: In diesem Kapitel wird die „Efficiency Defense“, also die Berücksichtigung von Effizienzsteigerungen bei der Fusionskontrolle, im Detail analysiert. Das Williamson's Trade-off Modell dient als Ausgangspunkt zur Erklärung der zugrundeliegenden ökonomischen Mechanismen. Die Kapitel erörtert die Bedingungen für die Anerkennung von Effizienzen im Rahmen des „more economic approach“ und kritisiert die Unbestimmtheit des Effizienzbegriffs und die damit verbundenen Probleme der Nachprüfbarkeit und des erhöhten Verfahrensaufwands. Der „Consumer pass-on“-Effekt und die Frage nach einer Einzelfallbetrachtung versus einem „general presumptions approach“ werden ausführlich diskutiert.
Kapitel: Praktische Bewertung des „more economic approach“: Abschließend wird eine praktische Bewertung des „more economic approach“ vorgenommen. Es werden die Auswirkungen auf die Operationalität des Fusionskontrollverfahrens und die Rechtssicherheit für Unternehmen analysiert. Die Kapitel beleuchtet die praktischen Herausforderungen und die Notwendigkeit einer weiteren Entwicklung und Verfeinerung des Ansatzes.
Schlüsselwörter
Europäische Fusionskontrolle, „more economic approach“, Wettbewerbspolitik, Marktbeherrschung, Effizienz, Wohlfahrt, Simulationsmodelle, Merger Simulation Models (MSM), Koordinierte Effekte, Unilaterale Effekte, Efficiency Defense, Ordnungspolitik, Rechtssicherheit, Operationalität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Der "more economic approach" in der europäischen Fusionskontrolle
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument analysiert den "more economic approach" in der europäischen Fusionskontrolle. Es untersucht die ökonomischen Grundlagen, die Anwendung und die ordnungspolitische Kritik dieses Ansatzes, beleuchtet dessen Entwicklung und Implikationen für die Praxis der Fusionskontrolle.
Welche Kapitel umfasst das Dokument?
Das Dokument gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Die Europäische Fusionskontrolle, Der "more economic approach" in der Fusionskontrolle, Ordnungspolitische Kritik am "more economic approach", Eingreifkriterien des "more economic approach", Efficiency Defense, Praktische Bewertung des "more economic approach", Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel enthält Unterkapitel zu spezifischen Aspekten des Themas.
Was sind die Ziele und Themenschwerpunkte des Dokuments?
Das Hauptziel ist die Analyse des "more economic approach", seiner ökonomischen Grundlagen und seiner ordnungspolitischen Einordnung. Schwerpunkte sind die Entwicklung und Implementierung des Ansatzes, die ökonomische Modellierung von Fusionswirkungen, die ordnungspolitische Debatte, die praktische Anwendung und die Herausforderungen bezüglich Rechtssicherheit und Operationalität.
Welche Methoden der Marktabgrenzung werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt quantitative Methoden zur Marktabgrenzung, insbesondere den hypothetischen Monopolistentest und das traditionelle Bedarfsmarktkonzept. Diese werden verglichen und bewertet.
Was ist der "SIEC"-Test und welche Rolle spielt er?
Der "SIEC"-Test wird als neues Untersagungskriterium im Rahmen des "more economic approach" erläutert. Der "Babyfood-Merger"-Fall dient als Beispiel für dessen Anwendung und Diskussion.
Welche Rolle spielt die "Efficiency Defense"?
Das Dokument analysiert die "Efficiency Defense", also die Berücksichtigung von Effizienzsteigerungen bei der Fusionskontrolle. Es untersucht das Williamson's Trade-off Modell und die Bedingungen für die Anerkennung von Effizienzen im "more economic approach", inklusive der Kritikpunkte hinsichtlich Unbestimmtheit des Effizienzbegriffs, Nachprüfbarkeit und Verfahrensaufwand.
Welche Kritikpunkte am "more economic approach" werden genannt?
Die Kritikpunkte konzentrieren sich auf erkenntnistheoretische Defizite, die potenzielle Vernachlässigung der Wettbewerbsfreiheit zugunsten von Effizienzgesichtspunkten, primärrechtliche Grenzen und die Frage der Rechtssicherheit. Verschiedene wettbewerbspolitische Leitbilder (Harvard School, Chicago School, wohlfahrtsökonomischer Ansatz) werden gegenübergestellt.
Wie werden unilaterale und koordinierte Effekte im Dokument behandelt?
Das Dokument unterscheidet zwischen unilateralen und koordinierten Effekten als Eingreifkriterien. Für unilaterale Effekte werden Modelle zur Prognose, wie Merger Simulation Models (MSM), vorgestellt und an Fallbeispielen (z.B. Oracle/PeopleSoft) illustriert. Koordinierte Effekte werden am Beispiel des Sony/BMG Falls analysiert.
Welche praktischen Auswirkungen des "more economic approach" werden diskutiert?
Das Dokument bewertet die Auswirkungen auf die Operationalität des Fusionskontrollverfahrens und die Rechtssicherheit für Unternehmen. Es beleuchtet die Herausforderungen und die Notwendigkeit einer Weiterentwicklung des Ansatzes.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt des Dokuments?
Schlüsselwörter sind: Europäische Fusionskontrolle, "more economic approach", Wettbewerbspolitik, Marktbeherrschung, Effizienz, Wohlfahrt, Simulationsmodelle, Merger Simulation Models (MSM), Koordinierte Effekte, Unilaterale Effekte, Efficiency Defense, Ordnungspolitik, Rechtssicherheit, Operationalität.
- Quote paper
- Markus Martin (Author), 2008, Der "more economic approach" in der Europäischen Fusionskontrolle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186501