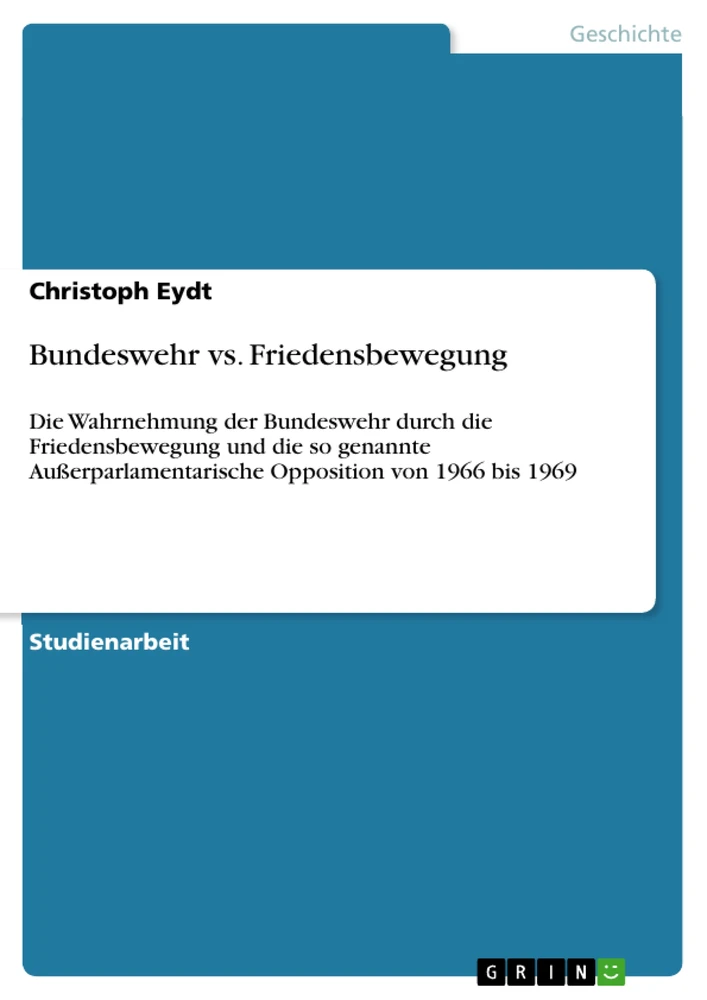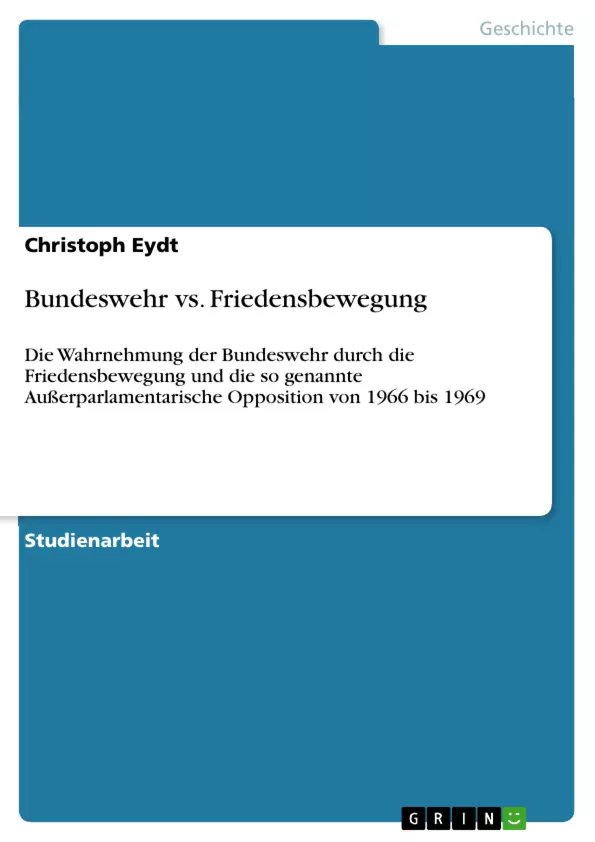Die folgende Arbeit thematisiert die Gründungsjahre der Bundeswehr und den gesellschaftlichen Konflikt mit der sogenannten Friedensbewegung und der Außerparlamentarischen Opposition (APO). Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht besonders die Zeit zwischen 1966 und 1969, da in diesen Jahren die Spannung besonders stark war. Die Arbeit ist in zwei große Bereiche gegliedert.
Der erste Teil geht auf die frühen Jahre der Bundeswehr ein. Zunächst ist es wichtig, den Beginn der Bundeswehr zu betrachten. Im folgenden Kapitel soll daher ein Überblick über die Gründung der bundesrepublikanischen Armee gegeben werden. Im Vordergrund steht dabei nicht die strategische und organisatorische Planung und Durchführung, sondern der gesellschaftliche Aspekt. Wie wurde die Neugründung in der westdeutschen Gesellschaft wahrgenommen? Inwieweit waren die Bundesbürger von der Armeeneugründung betroffen? Welche Rolle spielte die Friedensbewegung in jener Zeit?
Im zweiten Teil der Arbeit wird speziell die Zeitspanne 1966-1969 betrachtet.
Wie entwickelte sich der Status der Bundeswehr in der Gesellschaft? Wie veränderte sich die Friedensbewegung? Und wie ist der Einfluss der APO zu bewerten?
Das letzte Kapitel der Arbeit liefert eine Zusammenfassung der gewonnenen Ergebnisse. An dieser Stelle soll ein relativ kurzer Vergleich zwischen den Gründungsjahren und der Zeit zwischen 1966 und 1969 gezogen werden.
Zum Schluss findet der Leser sämtliche Literaturhinweise.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Anfang
- 2.1 Die Wehrpflicht
- 2.1.1 Die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht
- 2.1.2 Die westdeutsche Armee und die NATO
- 2.1.3 Die demokratische Tradition der Bundeswehr
- 2.2 Die traditionale Legitimität des Militärs
- 2.2.1 Die Bundeswehr und die traditionelle Legitimität
- 2.2.2 Das Militär und die Kontroverse der Legitimation
- 2.2.3 Die Aufgabe des Soldaten
- 2.2.4 Die öffentliche Meinung
- 3. Die Friedensbewegung als Problem der gesellschaftlichen Legitimität des Heeres
- 3.1 „Ohne uns\" - Das Friedensideal und seine Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Status der Bundeswehr
- 3.1.1 Die Friedensbewegung als Träger der grundlegenden Legitimationsproblematik
- 3.1.2 Die Strukturierung der Friedensbewegung anhand der Entwicklungsstufen der Bundeswehr
- 3.1.3 Vom Wertewandel zu ethischen Forderungen
- 3.2 Von der Friedensbewegung zur APO
- 3.2.1 Die erste Phase
- 3.2.2 Die zweite Phase
- 3.2.3 Die dritte Phase
- 4. Die Außerparlamentarische Opposition und ihre Wahrnehmung der Bundeswehr
- 4.1 Das Verhältnis der APO zur Militärfrage
- 4.1.1 Eine Kontinuitätslinie - Die Rüstungspolitik als Verlaufsthema von der Friedensbewegung zur APO
- 4.1.2 Das Ziel einer gewaltfreien Gesellschaft und der SDS
- 4.2 Die APO und ihr Blick auf die Bundeswehr
- 4.2.1 Der Zivildienst
- 4.2.2 Das Notstandsgesetz zur Regelung der Einsätze des Heers im Inneren
- 4.2.3 Zwischenbilanz
- 4.3 Folgen der Aktionen und Reaktionen der APO
- 4.3.1 Die Folgen für die Bundeswehr/den Zivildienst
- 4.3.2 Der Wertewandel
- 4.3.3 Das Scheitern des Idealismus der „,68er“.
- 4.4 Zwischenbilanz
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Gründungsjahre der Bundeswehr und die damit verbundenen gesellschaftlichen Konflikte mit der Friedensbewegung und der Außerparlamentarischen Opposition (APO). Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Zeit zwischen 1966 und 1969, die durch besonders starke Spannungen geprägt war.
- Die Gründung der Bundeswehr und ihre Wahrnehmung in der westdeutschen Gesellschaft
- Die Rolle der Friedensbewegung und ihre Kritik an der Bundeswehr
- Der Einfluss der Außerparlamentarischen Opposition auf die Bundeswehrdebatte
- Die Entwicklung des Status der Bundeswehr in der Gesellschaft
- Der Wandel von Werten und Normen in der Bundesrepublik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel gibt einen Überblick über die frühen Jahre der Bundeswehr, insbesondere die Einführung der Wehrpflicht und die gesellschaftliche Debatte um die Neugründung einer deutschen Armee im Kontext der NATO.
Das zweite Kapitel beleuchtet die Frage der Legitimität des Militärs in der Bundesrepublik. Hier werden die traditionellen Vorstellungen vom Militär und die Herausforderungen durch die Friedensbewegung beleuchtet.
Das dritte Kapitel untersucht die Friedensbewegung als eine zentrale Kraft, die die Legitimität der Bundeswehr in Frage stellte. Die Entwicklung der Friedensbewegung in verschiedenen Phasen wird dargestellt, sowie die sich ändernden ethischen Forderungen und die Verbindung zur APO.
Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Außerparlamentarische Opposition (APO) und ihre Wahrnehmung der Bundeswehr. Die Rüstungspolitik, der Zivildienst und das Notstandsgesetz werden als zentrale Streitpunkte analysiert.
Schlüsselwörter
Bundeswehr, Friedensbewegung, Außerparlamentarische Opposition (APO), Wehrpflicht, Legitimität, Militär, Gesellschaft, Wertewandel, Rüstungspolitik, Zivildienst, Notstandsgesetz, 1966-1969
Häufig gestellte Fragen
Wann war die Spannung zwischen Bundeswehr und Friedensbewegung am stärksten?
Die Arbeit identifiziert die Jahre 1966 bis 1969 als die Phase der stärksten gesellschaftlichen Spannungen.
Welche Rolle spielte die APO in der Bundeswehrdebatte?
Die Außerparlamentarische Opposition (APO) kritisierte die Rüstungspolitik, das Notstandsgesetz und setzte sich für eine gewaltfreie Gesellschaft sowie den Zivildienst ein.
Wie wurde die Gründung der Bundeswehr gesellschaftlich wahrgenommen?
Die Neugründung war hochumstritten; es gab starke Vorbehalte gegen eine erneute Remilitarisierung, was sich in der "Ohne uns"-Bewegung äußerte.
Was war der Kern der Kritik am Notstandsgesetz?
Kritiker befürchteten, dass das Heer im Inneren gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden könnte, was die demokratische Grundordnung gefährdet hätte.
Wie veränderte der Wertewandel der 68er das Militär?
Der gesellschaftliche Druck führte zu einer stärkeren demokratischen Kontrolle, einer Aufwertung des Zivildienstes und einer kritischeren Auseinandersetzung mit militärischer Tradition.
- Quote paper
- Christoph Eydt (Author), 2008, Bundeswehr vs. Friedensbewegung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/186959