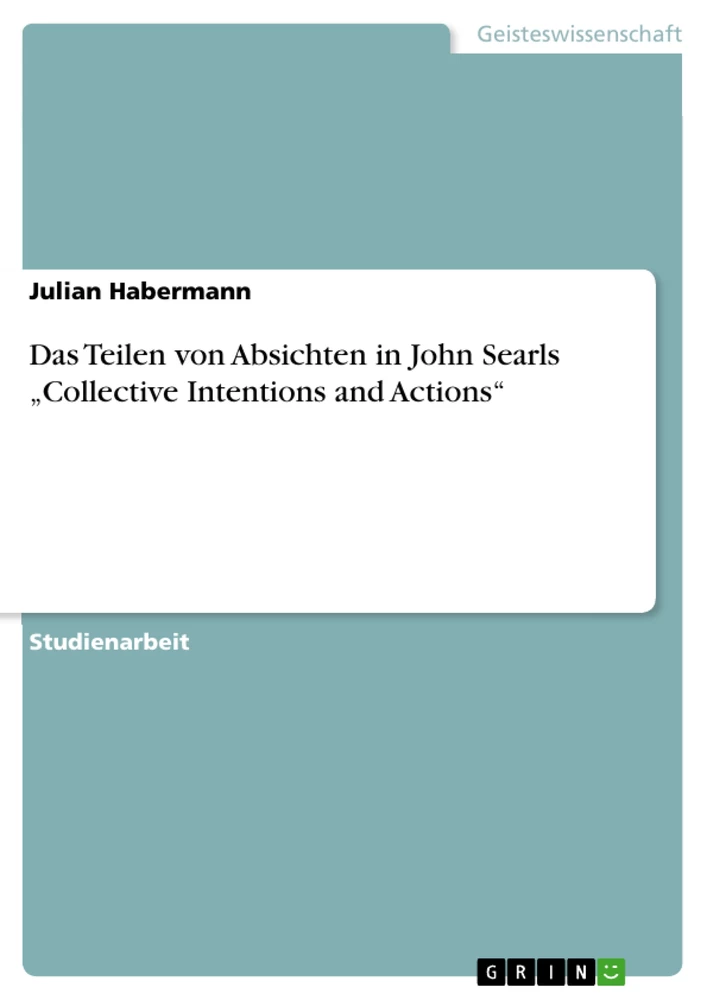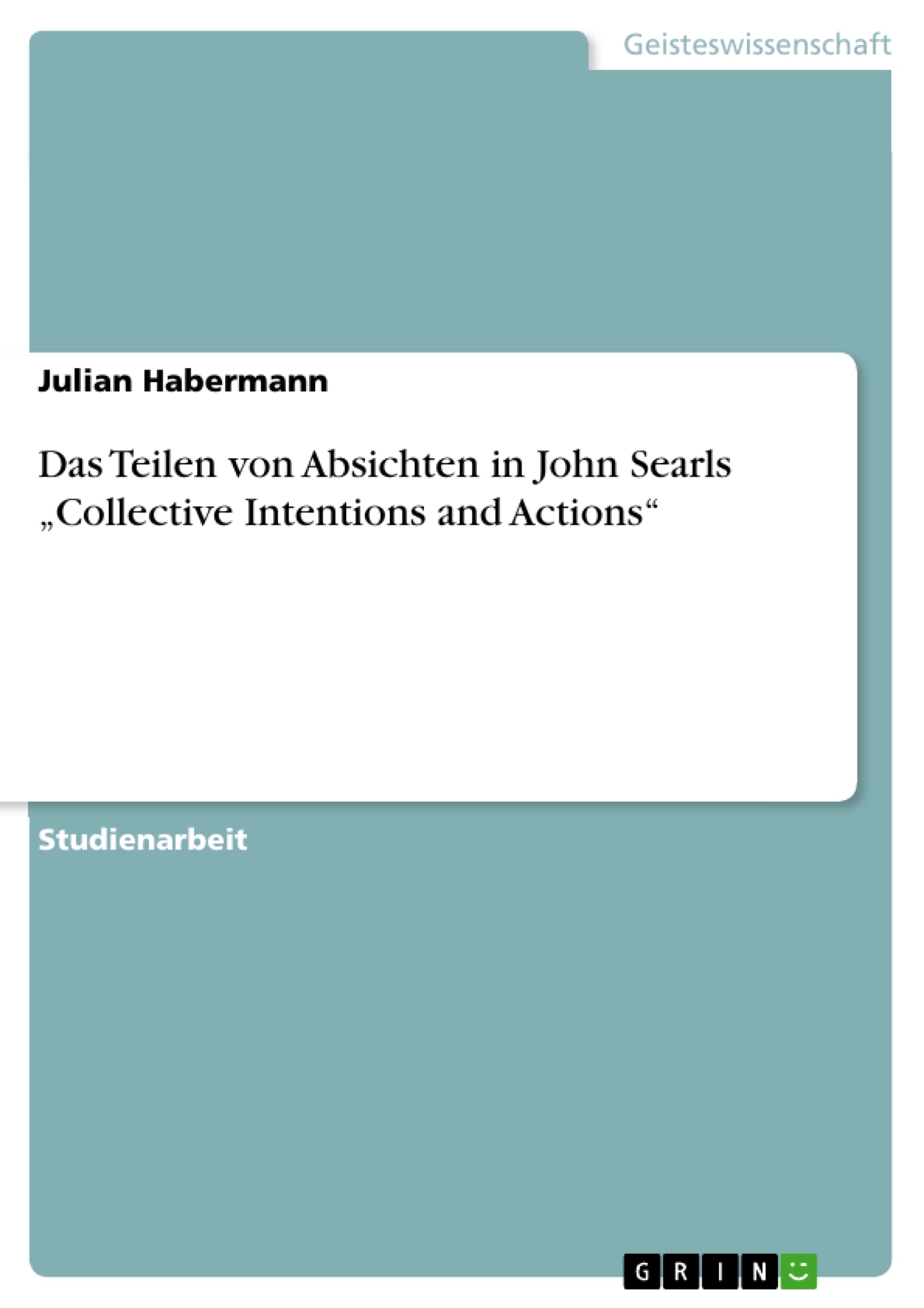Ich werde die Gliederung des Essays erläutern und versuchen zu zeigen, wie die drei Abschnitte ineinander übergreifen. Im ersten Teil führt Searle seine Intuition ein und es werden für ihre Plausibilisierung von ihm Beispiele aus dem Phänomenbereich des kooperativen Verhaltens geliefert, die auch eingeführt werden, um sich gegen die Form eines reduktiven, methodoligischen Individualismus auszusprechen. Das Scheitern einer solchen Konzeption soll besprochen und durch von mir konstruierte Beispiele des Phänomenbereichs des Teilens von Absichten weiterhin plausibilisiert werden. Im zweiten Teil des Essays schlägt Searle eine entsprechende Notation oder Formalisierung für die kollektive Intentionalität vor, die Bezug auf die mentale Ebene derer, die an einer gemeinsamen Handlung beteiligt sind, nimmt, sowie auf den (propositionalen) Gehalt ihrer geistigen Einstellung. Diese Notation soll von mir vor dem Hintergrund von Searles Ausführungen zu seiner Handlungs- und Intentionalitätstheorie in einem etwas weiteren Rahmen erläutert werden. Searles Unterfangen, mit seinem Essay das Phänomen des Teilens von Absichten in eine generelle Intentionalitätstheorie zu integrieren, wird dabei von mir nicht eigens weitergehend thematisiert. Die nähere Besprechung der Formalisierung des entsprechenden, intentionalen Phänomens erwies sich von Relevanz für die Besprechung des dritten Teils. Hier führt Searle die Voraussetzungen für die Möglichkeit des Teilens von Absichten ein. Ich werde an dieser Stelle aus weiteren Quellen Searles Konzeption des Hintergrunds ( den „Background“) mit einbeziehen, mit der Searle eine Antwort auf diese Frage zu geben versucht und die im Essay nicht eigens ausformuliert aber angedeutet wird. ch werde unter diesem Einbezug und in Anbetracht seiner (internalistischen) Konzeption des Geistes versuchen zu prüfen, inwiefern Searle seine Intuition stützen und dem Phänomen aufklärerisch angemessen begegnen kann. Ich möchte dabei auch versuchen zu zeigen, wieso man Schwierigkeiten haben könnte, ein so alltägliches, kulturelles Phänomen mit einem primitiven, psychologischen Mechanismus in Verbindung zu bringen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Intuition
- Das Scheitern der Analyse
- Searls Gegenbeispiel
- Eine Kritik des Gegenbeispiels
- Kollektive Intentionalität ohne Gruppengeist
- Die Möglichkeit des Irrtums
- Die Notation
- Die kausale Struktur kooperativen Handelns
- Die Voraussetzung
- Der Hintergrund
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert John Searles Essay „Collective Intentions and Actions“ und untersucht seine Konzeption des Teilens von Absichten und gemeinsamen Handelns. Die Arbeit erläutert die Struktur des Essays und zeigt die Verknüpfung seiner drei Hauptteile auf. Besondere Aufmerksamkeit wird Searles Intuition gewidmet und deren Plausibilität anhand von Beispielen aus dem kooperativen Verhalten diskutiert.
- Searles Intuition zum Teilen von Absichten als primitives, biologisches Phänomen
- Kritik an reduktivem, methodologischem Individualismus
- Searles Notation zur Formalisierung kollektiver Intentionalität
- Die Voraussetzungen für das Teilen von Absichten
- Der Einfluss von Searles Hintergrundkonzept auf seine Intuition
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt Searles Ansatz zum Teilen von Absichten im Vergleich zu anderen Konzeptionen dar und skizziert den Aufbau der Hausarbeit. Sie führt Searles Intuition ein und erwähnt die Verwendung von Beispielen aus kooperativem Verhalten zur Widerlegung eines reduktiven Individualismus.
Die Intuition: Dieses Kapitel beschreibt Searles These, dass die Fähigkeit zum gemeinsamen Handeln angeboren und nicht erlernt ist. Es argumentiert gegen die Reduktion von Gruppenverhalten auf individuelle Handlungen und führt die Unterscheidung zwischen „Ich“- und „Wir“-Intentionalität ein.1
Das Scheitern der Analyse: Dieser Abschnitt behandelt Searls Gegenbeispiel und Kritikpunkte daran, um die Unmöglichkeit einer Reduktion von kollektiver Intentionalität auf individuelle Intentionalität zu verdeutlichen.
Kollektive Intentionalität ohne Gruppengeist: Hier wird die Möglichkeit des Irrtums bezüglich geteilter Absichten und der Kooperationsbereitschaft anderer Personen behandelt.
Die Notation: Dieses Kapitel beschreibt Searles vorgeschlagene Notation zur Formalisierung kollektiver Intentionalität.
Die Voraussetzung und Der Hintergrund: Diese Kapitel werden in der Arbeit zusammenfassend betrachtet und erläutern die Voraussetzungen für das Teilen von Absichten und Searles Konzept des „Background“ im Kontext seiner Intentionalitätstheorie.
1 Die Intentionalität bedeutet das Gerichtetsein eines Geisteszustandes oder den repräsentativen Gehalt einer geistigen Einstellung. Beispiele für Intentionalität können neben Absichten auch Überzeugungen, Erinnerungen, Wünsche, Hoffnungen aber auch Emotionen und Wahrnehmungen sein, insofern diese geistigen Einstellungen auf etwas bezogen sind. Intentionalität ist nicht mit Bewusstsein gleich zu setzen. Das Bewusstsein von einem unbestimmten Angstgefühl oder Niedergeschlagenheit fällt nicht unter den Begriff der Intentionalität und intentionale Zustände müssen nicht immer bewusst sein (z.B. hat man Überzeugungen, ohne stets an sie denken zu müssen). Intentionalität ist für Searle ein intrinsisches Merkmal des Geistes, d.h. sie ist objektiv gegeben und nicht beobachter-relativ. Sie ist nach Searle nicht immateriell und in der Neurophysiologie realisiert als auch durch biologische (Hirn-) Zustände verursacht. Searle vertritt in Sachen Bewusstsein keine klar einzuordnende Position (weder Materialismus noch Dualismus). Ich werde die Form der kollektiven Intentionalität auch mit der „Wir-Form“ der Intentionalität und die Form der singulären Intentionalität mit der „Ich -Form“ der Intentionalität wiedergeben.Schlüsselwörter
Kollektive Intentionalität, gemeinsames Handeln, John Searle, Intentionalitätstheorie, „Wir“-Intentionalität, „Ich“-Intentionalität, methodologischer Individualismus, Kooperation, Hintergrund (Background).
- Quote paper
- Julian Habermann (Author), 2010, Das Teilen von Absichten in John Searls „Collective Intentions and Actions“ , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187638