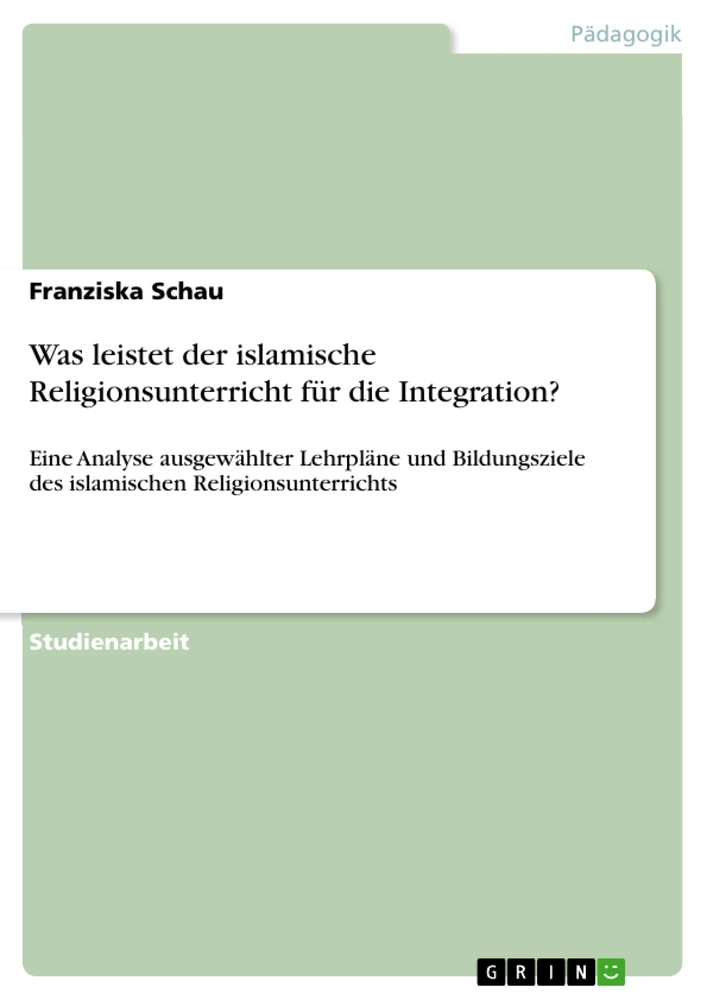Das Thema dieser Hausarbeit lautet „Was leistet der islamische Religionsunterricht für die Integration? Eine Analyse ausgewählter Lehrpläne und Bildungsziele des islamischen Religionsunterrichts“. Es wird per se auf die Bedeutung der Integration und der Assimilation eingegangen; dies geschieht durch Begriffsdefinitionen nach Hartmut Esser. Außerdem werden Lehrpläne für den islamischen Religionsunterricht vorgestellt, welche in den jeweiligen Bundesländern in Deutschland existieren. Insbesondere wird der Lehrplan des Landes Niedersachsens analysiert, im Kapitel 3.1 wird näher auf den islamischen Religionsunterricht in Niedersachsen als Modellversuch eingegangen. Auch die Ausbildung der Lehrkräfte ist themenrelevant und wird deshalb angesprochen. Außerdem wird erläutert, wer den islamischen Religionsunterricht in Deutschland verantwortet. Abschließend wird thematisiert, inwiefern der islamische Religionsunterricht den Islamismus fördern beziehungsweise unterbinden kann und ob und dieser Unterricht die Integration von muslimischen Migranten fördert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Assimilation und Integration: eine Begriffsdefinition nach Hartmut Esser
- Lehrpläne für den islamischen Religionsunterricht
- Das Beispiel Niedersachsen: Unterrichtskonstruktionen und Bildungsziele
- Lehrkräfte für den islamischen Religionsunterricht
- Wer verantwortet den Unterricht?
- Resümee: Verhindert islamischer Religionsunterricht Islamismus bzw. fördert islamischer Religionsunterricht die Integration?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit der islamische Religionsunterricht zur Integration muslimischer Migranten beiträgt. Im Zentrum der Untersuchung steht die Analyse ausgewählter Lehrpläne und Bildungsziele des islamischen Religionsunterrichts. Darüber hinaus werden die Begriffe Integration und Assimilation anhand von Hartmut Essers Definitionen beleuchtet.
- Die Bedeutung von Integration und Assimilation im Kontext der Einwanderung
- Die Gestaltung des islamischen Religionsunterrichts in Deutschland
- Der islamische Religionsunterricht in Niedersachsen als Modellversuch
- Die Rolle der Lehrkräfte und die Verantwortung für den Unterricht
- Der Einfluss des islamischen Religionsunterrichts auf Islamismus und Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit vor und gibt einen Überblick über die behandelten Aspekte. In Kapitel 2 wird die Begriffsdefinition von Assimilation und Integration nach Hartmut Esser erläutert, wobei die verschiedenen Ebenen und Formen der Assimilation beleuchtet werden. Kapitel 3 bietet einen Überblick über die Lehrpläne des islamischen Religionsunterrichts in verschiedenen Bundesländern Deutschlands, wobei der Fokus auf dem Modellversuch in Niedersachsen liegt. Hier werden die Unterrichtskonstruktionen, Bildungsziele und die Ausbildung der Lehrkräfte näher betrachtet. Darüber hinaus wird die Frage nach der Verantwortung für den islamischen Religionsunterricht behandelt. Die Hausarbeit schließt mit einem Resümee, in dem der Einfluss des islamischen Religionsunterrichts auf Islamismus und Integration diskutiert wird.
Schlüsselwörter
Islamischer Religionsunterricht, Integration, Assimilation, Hartmut Esser, Lehrpläne, Bildungsziele, Modellversuch, Niedersachsen, Islamismus, Migranten.
Häufig gestellte Fragen
Was leistet der islamische Religionsunterricht für die Integration?
Der Unterricht kann die Integration fördern, indem er muslimischen Schülern eine religiöse Beheimatung im deutschen Bildungssystem bietet und zur Identitätsbildung beiträgt.
Was ist der Unterschied zwischen Integration und Assimilation nach Hartmut Esser?
Integration bedeutet die Einbeziehung in die Gesellschaft unter Wahrung kultureller Identität, während Assimilation die vollständige Anpassung an die Aufnahmegesellschaft beschreibt.
Welches Bundesland wird in der Arbeit als Modellversuch analysiert?
Die Arbeit analysiert insbesondere den Modellversuch zum islamischen Religionsunterricht im Land Niedersachsen.
Wer trägt die Verantwortung für den islamischen Religionsunterricht in Deutschland?
Die Verantwortung liegt bei den jeweiligen Bundesländern (Kultusministerien) in Zusammenarbeit mit anerkannten islamischen Organisationen als Ansprechpartner.
Kann der Unterricht zur Prävention von Islamismus beitragen?
Ja, ein staatlich verantworteter Unterricht kann helfen, radikalen Tendenzen entgegenzuwirken, indem er eine reflektierte und historisch-kritische Auseinandersetzung mit der Religion ermöglicht.
Wie sieht die Ausbildung der Lehrkräfte für dieses Fach aus?
Die Arbeit thematisiert die Notwendigkeit einer universitären Ausbildung der Lehrkräfte in Deutschland, um fachliche und pädagogische Standards zu sichern.
- Quote paper
- Franziska Schau (Author), 2011, Was leistet der islamische Religionsunterricht für die Integration?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187653