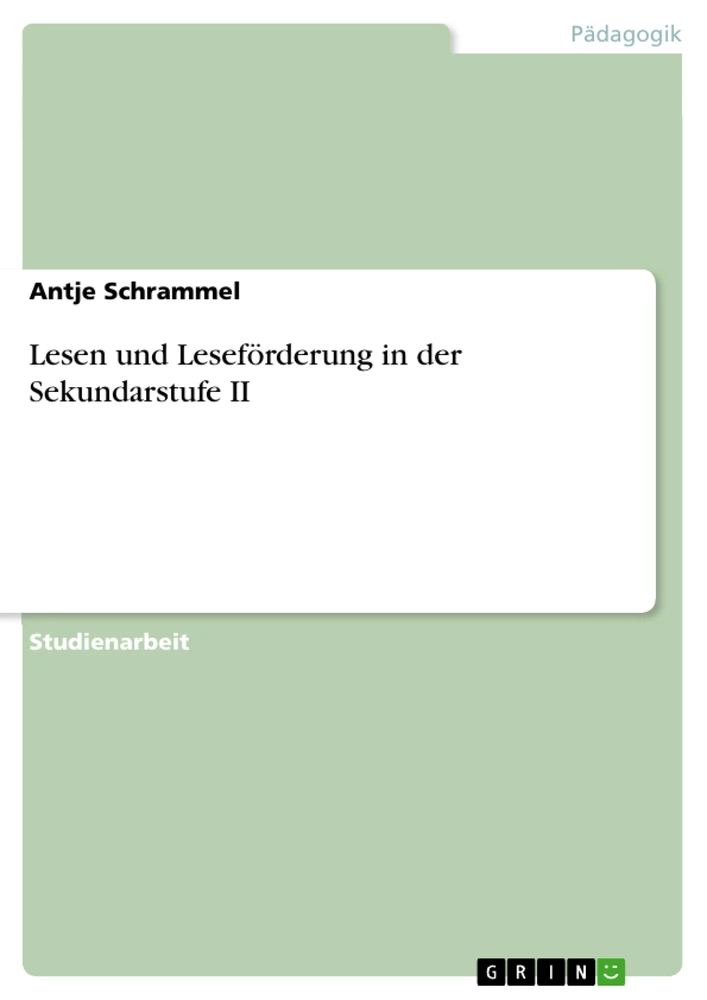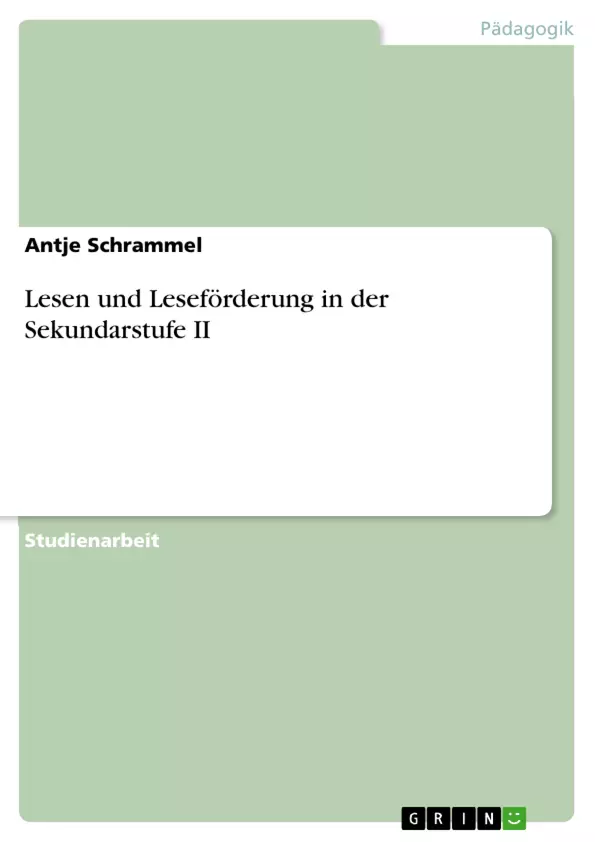Seit Anbeginn der PISA-Studie ist man sich bewusst, dass die österreichischen Schüler*innen im internationalen Vergleich relativ schlecht abschneiden und dass etwas geändert muss, damit die Schülerleistungen in diesem Bereich gesteigert werden können.
Einer der Gründe dafür ist, dass kein zeitgemäßer Unterricht mehr geboten wird. Die Kinder und Jugendlichen von heute unterscheiden sich stark von jenen der vorhergehenden Generationen, sie haben andere Interessen, Herausforderungen und Bedürfnisse, an welche sich der moderne Unterricht und im Speziellen der Leseunterricht anpassen sollte.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf einer theoretischen Grundlage für eine kompetente Leseförderung, mit Schüler*innen der Sekundarstufe II der BMHS als Zielgruppe.
Die Arbeit behandelt die aktuelle Situation von heterogenen Klassen sowie zur BMHS allgemein, danach wird auf das Thema Lesen sowie seine Prozesse und Vorgänge eingegangen und ein Bezug auf PISA 2009 aufgebaut.
Weiters werden die Ebenen des Leseprozesses sowie die darauf bauenden PISA-Kriterien angeschnitten und auf die Notwendigkeit für die heutigen Leser*innen hingewiesen, sich mit der neuen Medienlandschaft vertraut zu machen.
Der theoretische Teil thematisiert äußere Bedingungen, die das schulische Umfeld dem Lehrenden, der Leseförderung betreiben möchte, bietet. Weiters werden verschiedene Aspekte der Leseförderung wie die Geschlechterfrage oder Mehrsprachigkeit in einer Klasse präsentiert, auf welche die Maßnahmen unbedingt abgestimmt werden müssen, damit sie zielführend wirken können. Im Anschluss daran werden Lesestrategien allgemein vorgestellt und auf deren drei Ebenen eingegangen, worauf ein konkretes Modell als Beispiel folgt.
Bevor es zu einigen exemplarischen praktischen Beispielen zur Leseförderung in der Sekundarstufe II kommt, werden noch die Schlagwörter Sinn erfassendes Lesen sowie Sachtextlektüre erörtert.
Es soll speziell auf die Förderung des Sinn erfassenden Lesens von Sachtexten eingegangen werden, da die Mehrzahl der Texte, die in der Schule – in allen Fächern – sowie in der Arbeitswelt gelesen und verstanden werden müssen aus solchen bestehen. Schüler haben oft bis in die Sekundarstufe II Probleme mit weniger geläufigen Satzmustern, Argumentationsgängen und Textstrukturen, vor allem wenn diese mit spezifischem Vokabular gefüllt sind.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Allgemeines
- Das heterogene Klassengefüge
- BMHS
- Lesen
- Voraussetzungen
- Lesekompetenz
- Drei Ebenen des Leseprozesses
- Prozessebene
- Subjektebene
- Soziale Ebene
- PISA-Kriterien
- Neue Kompetenzen für das Lesen in neuen den Medien
- Drei Ebenen des Leseprozesses
- Leseförderung - theoretischer Teil
- Bedingungen in der Schule
- Geschlechterdifferenzierende Leseförderung
- Mehrsprachigkeit
- Lesestrategien
- Allgemeines
- drei Ebenen der Lesestrategien
- Konkrete Lesestrategien
- Lesemethodischer Überblick nach dem BMUKK.
- Sinnerfassendes Lesen
- Sachtextlektüre
- Leseförderung – praktischer Teil
- Schluss
- Literatur
- Nachbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Lesen und Leseförderung, insbesondere im Kontext der Sekundarstufe II. Sie untersucht die Herausforderungen, die sich aus der heterogenen Zusammensetzung der Schülerschaft und den veränderten Bedürfnissen von Jugendlichen ergeben, und analysiert die Bedeutung der Lesekompetenz im Vergleich zu den Ergebnissen der PISA-Studie.
- Heterogenität der Schülerschaft und Anpassung des Unterrichts
- Lesekompetenzentwicklung in der Sekundarstufe II
- PISA-Ergebnisse und deren Relevanz für die Leseförderung
- Entwicklung von Lesestrategien und deren Anwendung in der Praxis
- Sinn erfassendes Lesen und Sachtextlektüre als Schwerpunkt der Leseförderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Lesen und Leseförderung in den Kontext der aktuellen Diskussionen und Herausforderungen dar. Sie beleuchtet die Bedeutung der Lesekompetenzentwicklung im Lichte der PISA-Studie und die Notwendigkeit einer angepassten Leseförderung für die heutigen Schüler*innen.
Das erste Kapitel befasst sich mit der heterogenen Klassenzusammensetzung und deren Auswirkungen auf die Unterrichtsgestaltung. Es analysiert die Situation an Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) und die Rolle, die diese im Bildungssystem spielen.
Das zweite Kapitel widmet sich dem Thema Lesen und analysiert die Prozesse und Vorgänge des Lesens. Es beleuchtet die Bedeutung von Lesekompetenz, verdeutlicht die drei Ebenen des Leseprozesses und setzt die PISA-Kriterien in Bezug zur Lesekompetenzentwicklung.
Der dritte Teil der Arbeit befasst sich mit der Leseförderung auf theoretischer Ebene. Er untersucht die Bedingungen in der Schule, die Geschlechterdifferenzierung im Kontext der Leseförderung und den Einfluss von Mehrsprachigkeit. Des Weiteren werden Lesestrategien und deren Anwendung vorgestellt, wobei der Fokus auf Sinnerfassendem Lesen und der Sachtextlektüre liegt.
Schlüsselwörter
Leseförderung, Sekundarstufe II, BMHS, Heterogenität, Lesekompetenz, PISA-Studie, Lesestrategien, Sinnerfassendes Lesen, Sachtextlektüre, Mehrsprachigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Leseförderung in der Sekundarstufe II notwendig?
Schüler haben oft Probleme mit komplexen Sachtexten und Satzmustern. Da diese Texte in Studium und Beruf dominieren, ist eine gezielte Förderung der Lesekompetenz essenziell.
Was sind die drei Ebenen des Leseprozesses?
Der Leseprozess umfasst die Prozessebene (kognitive Vorgänge), die Subjektebene (persönliche Einstellung) und die soziale Ebene (Austausch über Texte).
Welchen Einfluss hat die PISA-Studie auf die Leseförderung?
Die PISA-Ergebnisse zeigten Defizite bei österreichischen Schülern auf und führten zur Entwicklung neuer Kompetenzkriterien und Unterrichtsmodelle.
Wie wirkt sich Mehrsprachigkeit auf den Leseunterricht aus?
In heterogenen Klassen muss die Leseförderung auf unterschiedliche Sprachhintergründe abgestimmt sein, um zielführend für alle Schüler zu wirken.
Was ist „sinnverstehendes Lesen“ bei Sachtexten?
Es bedeutet, nicht nur Wörter zu entziffern, sondern Argumentationsgänge und Textstrukturen zu erfassen, um den Inhalt kritisch bewerten und nutzen zu können.
- Quote paper
- Antje Schrammel (Author), 2011, Lesen und Leseförderung in der Sekundarstufe II, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187655