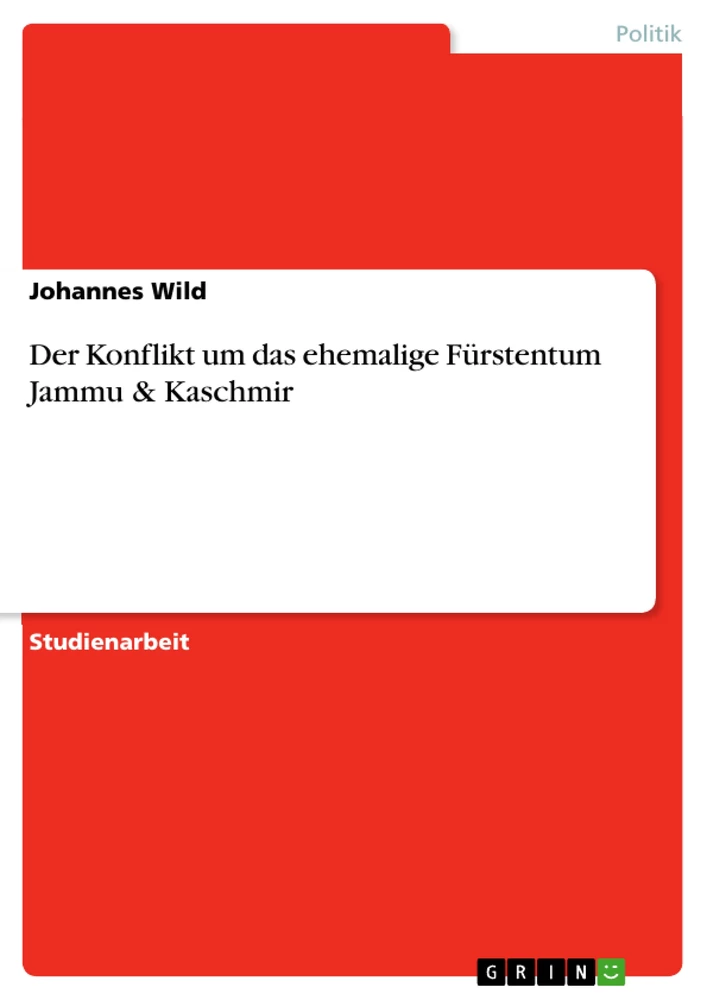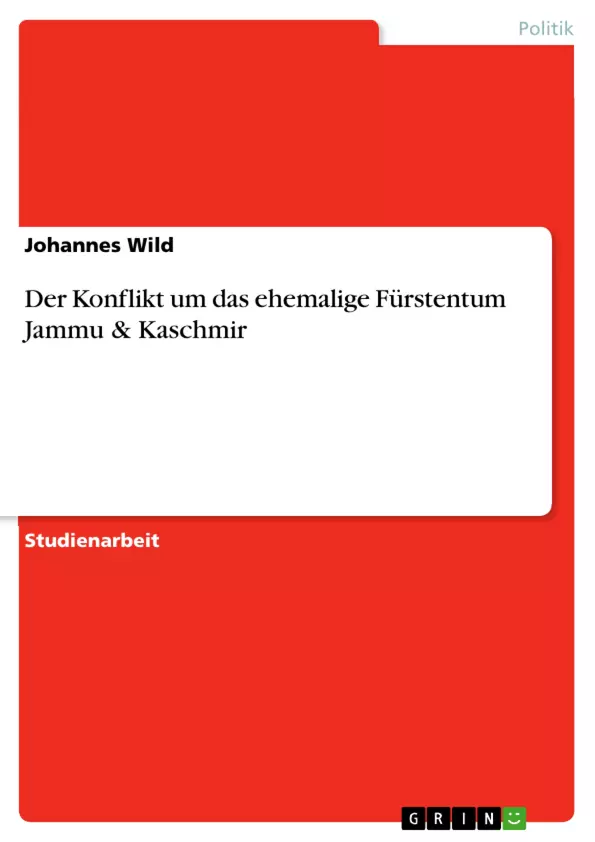Indien ist in Unternehmerkreisen als Zukunftsmarkt mit hohen Wachstumsraten und Renditeaussichten bekannt. Dies ist wenig verwunderlich, angesichts eines anhaltend hohen Wirtschaftswachstums von 8,3% sowie des enormen Investitionsbedarfs im Bereich Infrastruktur und Energieversorgungstechnik. Hinzu kommen die Absatzchancen im Hinblick auf die Befriedigung der Konsumwünsche einer stetig wachsenden Mittel- und Oberschicht bei einer Gesamtbevölkerung von 1,21 Milliarden . Will man diese Chancen als Unternehmen nachhaltig nutzen, so empfiehlt es sich neben ökonomischen Wachstumsraten und rechtlichen Rahmenbedingungen immer auch die politische Stabilität der für den unternehmerischen Erfolg entscheidenden Region zu berücksichtigen.
Indien liegt mit Asien und Ozeanien in einer Region die einerseits hohe Wachstumsraten zu verzeichnen hat und stets an ökonomischen Einfluss hinzugewinnt, andererseits aber auch durch aktuell 114 Kriege und Konflikte geprägt ist. Davon entfallen allein 21 auf den Indischen Subkontinent, was Indien 2010 den Staat mit den meisten Konflikten bzw. kriegerischen Auseinandersetzungen sein ließ. Gerade gewaltsam ausgetragene Konflikte haben unabhängig von den jeweiligen Konfliktursachen erheblichen Einfluss auf die Stabilität einer Region, bzw. bei Überschreiten einer bestimmten Intensitätsschwelle auch auf die Stabilität eines gesamten Staates. Der für die Stabilität der gesamten Region derzeit bedeutendste Konflikt ist der mit dem Übergang Indiens in die Unabhängigkeit 1947 gewaltsam ausgetragene Konflikt um das ehemalige Fürstentum Jammu & Kaschmir. Da der Kaschmir-Konflikt neben der außenpolitischen Komponente auch von erheblicher Bedeutung für innere Stabilität der indischen Nation ist und sich insbesondere aus der Entstehungsphase dieses Konflikts die Herausforderungen durch die Heterogenität Indiens verdeutlichen lassen, soll dieser im Folgenden vertieft Berücksichtigung finden.
Der Konflikt um das ehemalige Fürstentum Jammu & Kaschmir
1. Einleitung
Indien ist in Unternehmerkreisen als Zukunftsmarkt mit hohen Wachstumsraten und Renditeaussichten bekannt. Dies ist wenig verwunderlich, angesichts eines anhaltend hohen Wirtschaftswachstums von 8,3%[1] sowie des enormen Investitionsbedarfs im Bereich Infrastruktur und Energieversorgungstechnik. Hinzu kommen die Absatzchancen im Hinblick auf die Befriedigung der Konsumwünsche einer stetig wachsenden Mittel- und Oberschicht bei einer Gesamtbevölkerung von 1,21 Milliarden[2]. Will man diese Chancen als Unternehmen nachhaltig nutzen, so empfiehlt es sich neben ökonomischen Wachstumsraten und rechtlichen Rahmenbedingungen immer auch die politische Stabilität der für den unternehmerischen Erfolg entscheidenden Region zu berücksichtigen.
Indien liegt mit Asien und Ozeanien in einer Region die einerseits hohe Wachstumsraten zu verzeichnen hat und stets an ökonomischen Einfluss hinzugewinnt, andererseits aber auch durch aktuell 114 Kriege und Konflikte[3] geprägt ist. Davon entfallen allein 21[4] auf den Indischen Subkontinent, was Indien 2010 den Staat mit den meisten Konflikten bzw. kriegerischen Auseinandersetzungen sein ließ. Gerade gewaltsam ausgetragene Konflikte haben unabhängig von den jeweiligen Konfliktursachen erheblichen Einfluss auf die Stabilität einer Region, bzw. bei Überschreiten einer bestimmten Intensitätsschwelle auch auf die Stabilität eines gesamten Staates. Der für die Stabilität der gesamten Region derzeit bedeutendste Konflikt ist der mit dem Übergang Indiens in die Unabhängigkeit 1947 gewaltsam ausgetragene Konflikt um das ehemalige Fürstentum Jammu & Kaschmir. Da der Kaschmir-Konflikt neben der außenpolitischen Komponente auch von erheblicher Bedeutung für innere Stabilität der indischen Nation ist und sich insbesondere aus der Entstehungsphase dieses Konflikts die Herausforderungen durch die Heterogenität Indiens verdeutlichen lassen, soll dieser im Folgenden vertieft Berücksichtigung finden.
2. Hauptteil
2.1. Heterogenität Indiens und Wurzeln des Kaschmir-Konflikts
Hätte man zur Aufgabe einzelnen Ländern jeweils besonders treffende Begriffe zuordnen, so wäre „Heterogenität“ im Hinblick auf Indien sicherlich die naheliegendste Wahl. Kaum eine andere Nation als Indien vereinigt eine linguistische, ethnische aber auch theologische Vielfalt von diesem Ausmaß unter dem Dach eines Nationalstaats. Allein die nähere Betrachtung der linguistischen Vielfalt mit den drei großen Sprachfamilien der indo-europäischen, sino-tibetischen und dravidischen Sprachen[5], und daraus abgeleitet über 100 Sprachen und ca. 500 Dialekte, verdeutlicht das Ausmaß der Heterogenität als Erbe der vorkolonialen Geschichte Indiens.[6] Zeigt man sich in Indien im Hinblick auf Regelungen bezüglich der sprachlichen Vielfalt flexibel, allein 22 verschiedene Sprachen haben derzeit Verfassungsrang und im Amtsverkehr greift man als Kompromisslösung vorwiegend auf die englische Sprache zurück, so gelingt es gerade bei Interessengegensätzen mit ethnischem und/oder theologischem Ursprung nicht immer eine gewaltlose Konfliktlösung herbeizuführen. Vor allem zwischen den beiden größten Religionsgruppen, ca. 80% der indischen Bevölkerung sind dem Hinduismus, 13% dem islamischen Glauben zuzuordnen[7], ist ein erhebliches Konfliktpotential gegeben, welches regelmäßig zu Auseinandersetzungen mit hohen Opferzahlen führt.[8] Vor dem Hintergrund dieses enormen Konfliktpotentials ist es als herausragende zivilisatorische Leistung einzuschätzen, dass Indien nach der Unabhängigkeit aus der britischen Kolonialherrschaft 1947, ein in den Grundelementen funktionierendes demokratisches System aufgebaut und trotz der umfassenden Herausforderungen auch beibehalten hat. Einen wesentlichen Beitrag hierzu dürfte sicherlich das indische Modell eines „multiethnischen Föderalismus“ geleistet haben[9]: Die indische Verfassung gewährt den Bundesstaaten abgesehen von der Außen- und Währungspolitik weitreichende Kompetenzen. Des Weiteren wurde bei der seit der Unabhängigkeit schrittweise erfolgenden Aufteilung des Staatsgebietes in Bundesstaaten immer auch der linguistischen wie auch ethnischen Heterogenität Rechnung getragen.[10] Dadurch konnte das umfassende Konfliktpotential zumindest partiell verringert werden und so die im Rahmen eines demokratischen Systems notwendige Stabilität aufrechterhalten werden.
Der die indische Nation seit ihrer Unabhängigkeit 1947 begleitende Kaschmir-Konflikt zeigt, dass derartige Lösungsansätze gerade bei theologisch/ideologisch bedingten Konflikten an ihre Grenzen stoßen können, gerade wenn eine der Konfliktparteien ein Interesse an der Aufrechterhaltung des Konflikts hat. Will man die Kernursachen dieses Konflikts um den territorialen Status des ehemaligen Fürstentums Kaschmir verstehen, so ist es notwendig zunächst die Beziehungen zwischen der muslimischen Minderheit und der hinduistischen Mehrheit im Vorfeld der Unabhängigkeit aus der britischen Kolonialherrschaft zu untersuchen: Bereits mit Beginn des 20. Jahrhunderts wurden den Muslimen Sonderrechte in den mehrheitlich von Hindus bewohnten Provinzen im Süden und im Zentrum des damaligen Britisch-Indiens zugestanden, um so einen entsprechenden Minderheitenschutz zu gewährleisten.[11] Dieses Modell funktionierte zunächst auch erfolgreich, erst mit zunehmender Intensität der Unabhängigkeitsbestrebungen Ende der 20er Jahre traten durch die Abgrenzung der hinduistischen Mehrheit von allem „nichtindischen“ Spannungen auf.[12] Diese Spannungen wurden von den politischen Führern auf Seiten der Muslime zum Anlass genommen, die Möglichkeit einer friedvollen Koexistenz von Hindus und Muslimen in einem mehrheitlich hinduistisch geprägten Staat grundsätzlich zu verneinen und Forderungen nach einem eigenständigen muslimisch geprägten Staat zu erheben.[13] Die Gründung Pakistans auf dem Gebiet der mehrheitlich muslimisch geprägten Provinzen im Norden und Osten des damaligen Britisch-Indiens zeigt, dass die politische Führung der Muslime im Rahmen der Entscheidungsfindungsprozesse um den zukünftigen territorialen Status der ehemaligen Kolonie ihre Interessen durchsetzen konnte. Hierbei ist nochmals zu betonen, dass erst im Vorfeld der Unabhängigkeit 1947 eine deutliche Differenz zwischen der muslimischen Minderheit und der hinduistischen Mehrheit entstanden ist. Vor diesem Zeitraum stand die religiöse Differenz zwischen diesen beiden Glaubensrichtungen nicht im Vordergrund, was sicherlich auch daraus resultiert, dass die theologische Differenz zwischen beiden Glaubensgruppen nicht durch eine ethnische ergänzt wird, da es sich bei den Muslimen auf dem Gebiet des ehemaligen Britisch-Indiens in der Mehrheit nicht um die Nachfahren arabischer Eroberer und Händler sondern um Konvertiten handelt.[14]
[...]
[1] Vgl. CIA, 2011.
[2] Vgl. Government of India, 2011.
[3] Vgl. Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung, 2011, S.2.
[4] Vgl. Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung, 2011, S.53.
[5] Vgl. Karte, abgerufen von: http://lexikon.freenet.de/Datei:Indien_Sprachfamilien.png.
[6] Vgl. Wilke, 1997, S.46.
[7] Vgl. CIA, 2011.
[8] Beispiel hierfür sind unter anderem das Pogrom von Hindunationalisten an ca. 2000 Muslimen im indischen Bundesstaat Gujarat 2002, unter nachgewiesener Beteiligung der in Gujarat regierenden hindunationalistischen Bharatia Janata Party (Vgl. Siddarth, 2002, S.75-134).
[9] Vgl. Wagner, 2006, S.86.
[10] Auch bei den derzeit stattfindenden Verhandlungen zwischen der indischen Zentralregierung und der National Democratic Front of Bodoland ist die Abspaltung eines Gebiets des derzeitigen Bundesstaats Assam als eigenständiger Bundestaat „Bodoland“ Gegenstand der Verhandlungen (Vgl. South Asia Terrorism Portal 2011(I), S.1).
[11] Vgl. Rothermund, 2006, S.71.
[12] Vgl. Wilke, 1997, S.59.
[13] Vgl. Rothermund, 2006, S.90-95.
Häufig gestellte Fragen zum Konflikt um das ehemalige Fürstentum Jammu & Kaschmir
Worum geht es in dem Text?
Der Text befasst sich mit dem Konflikt um das ehemalige Fürstentum Jammu & Kaschmir zwischen Indien und Pakistan, der seit der Unabhängigkeit Indiens im Jahr 1947 besteht. Er untersucht die Ursachen und Hintergründe des Konflikts, insbesondere im Hinblick auf die Heterogenität Indiens und die Beziehungen zwischen Hindus und Muslimen.
Warum wird Indien als Zukunftsmarkt betrachtet?
Indien wird aufgrund seines hohen Wirtschaftswachstums, des enormen Investitionsbedarfs im Bereich Infrastruktur und Energieversorgungstechnik sowie der Absatzchancen durch eine wachsende Mittel- und Oberschicht als Zukunftsmarkt mit hohen Renditeaussichten angesehen.
Welche Bedeutung hat die Heterogenität Indiens für den Kaschmir-Konflikt?
Die Heterogenität Indiens, insbesondere die linguistische, ethnische und theologische Vielfalt, spielt eine wichtige Rolle im Kaschmir-Konflikt. Spannungen zwischen der hinduistischen Mehrheit und der muslimischen Minderheit haben im Vorfeld der Unabhängigkeit zugenommen und führten zur Forderung nach einem eigenständigen muslimisch geprägten Staat, was letztendlich zur Teilung des Landes und zum Kaschmir-Konflikt beitrug.
Welche Rolle spielt Religion in dem Konflikt?
Die religiöse Differenz zwischen Hindus (ca. 80% der indischen Bevölkerung) und Muslimen (ca. 13%) ist ein zentrales Konfliktpotential. Vor der Unabhängigkeit gab es Spannungen zwischen den beiden Gruppen, die von politischen Führern genutzt wurden, um die Notwendigkeit eines separaten muslimischen Staates zu betonen. Obwohl die theologische Differenz nicht durch eine ethnische ergänzt wird, spielt sie dennoch eine entscheidende Rolle im Konflikt.
Was ist das indische Modell des "multiethnischen Föderalismus"?
Das indische Modell des "multiethnischen Föderalismus" gewährt den Bundesstaaten weitreichende Kompetenzen, abgesehen von der Außen- und Währungspolitik. Bei der Aufteilung des Staatsgebietes in Bundesstaaten wurde auch der linguistischen und ethnischen Heterogenität Rechnung getragen, um das Konfliktpotential zu verringern und die Stabilität aufrechtzuerhalten.
Warum konnte das Modell des "multiethnischen Föderalismus" den Kaschmir-Konflikt nicht verhindern?
Der Kaschmir-Konflikt zeigt, dass derartige Lösungsansätze bei theologisch/ideologisch bedingten Konflikten an ihre Grenzen stoßen können, insbesondere wenn eine der Konfliktparteien ein Interesse an der Aufrechterhaltung des Konflikts hat.
Was waren die Ursprünge der Spannungen zwischen Hindus und Muslimen vor der Unabhängigkeit?
Obwohl den Muslimen bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts Sonderrechte in den mehrheitlich von Hindus bewohnten Provinzen zugestanden wurden, um einen Minderheitenschutz zu gewährleisten, traten mit zunehmender Intensität der Unabhängigkeitsbestrebungen Ende der 20er Jahre Spannungen durch die Abgrenzung der hinduistischen Mehrheit von allem „nichtindischen“ auf. Diese Spannungen wurden von muslimischen Führern genutzt, um die Möglichkeit einer friedvollen Koexistenz in einem mehrheitlich hinduistisch geprägten Staat zu verneinen.
- Citation du texte
- Johannes Wild (Auteur), 2011, Der Konflikt um das ehemalige Fürstentum Jammu & Kaschmir, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/187905