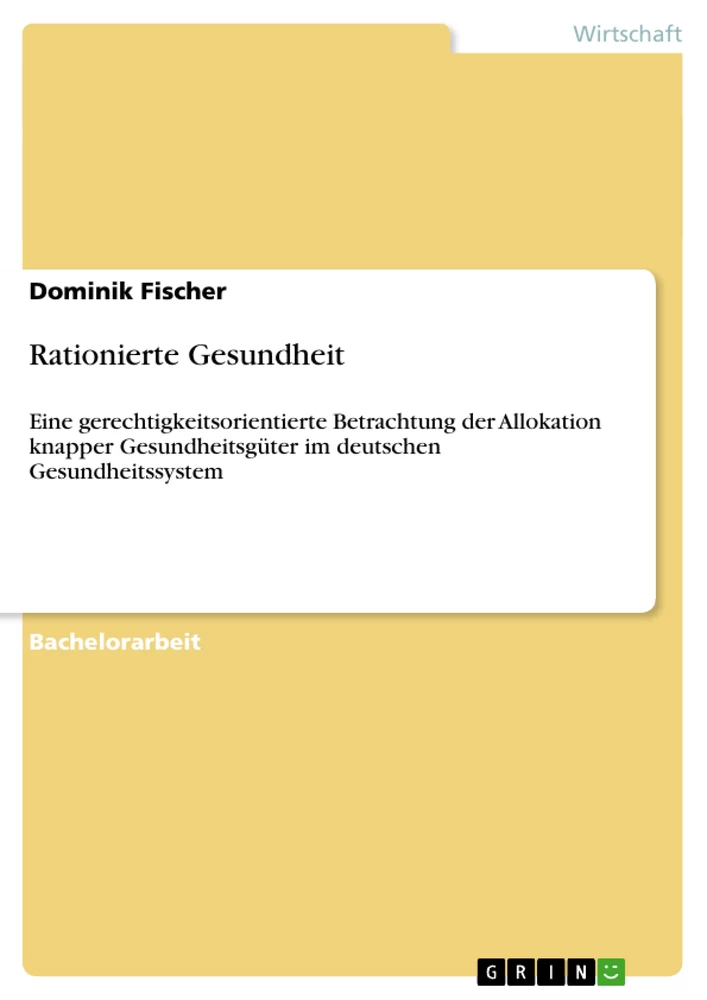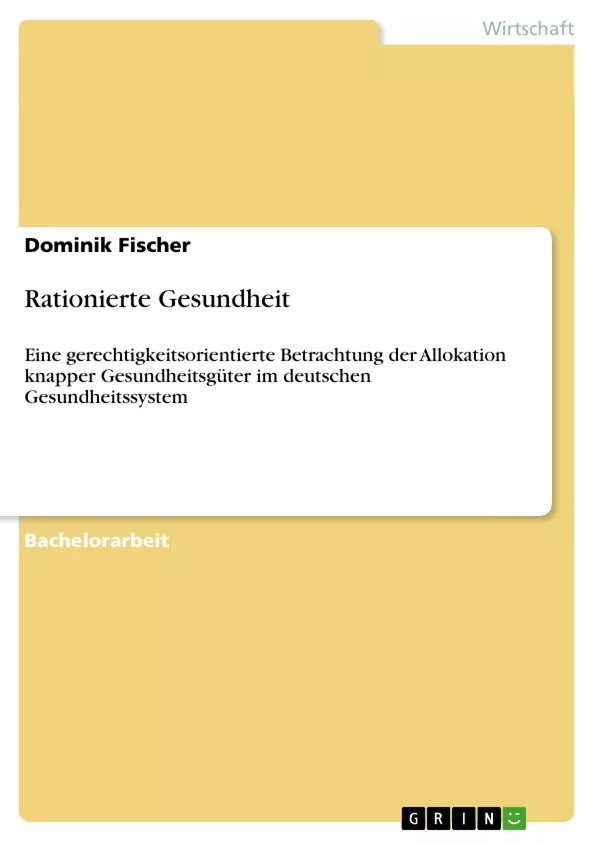Ausgehend von der in Expertenkreisen vielfach geteilten Meinung, dass in Zukunft das medizinisch und das finanziell Machbare zunehmend divergieren und damit Leistungsbegrenzungen in der Gesundheitsversorgung mittelfristig unumgänglich sind, stellt sich die Frage nach dem ‚Wie‘ einer Allokation knapper Gesundheitsgüter, insbesondere in Hinblick auf die Erfüllung moralischer Gerechtigkeitserwartungen und –anforderungen. Die in diesem Zusammenhang häufig genannten zentralen Begriffe Rationierung und Priorisierung beschreiben die Methoden, mit denen eine Versorgung unter Knappheit gestaltet werden kann.
Die Analyse gerechtigkeitsrelevanter ethischer Denkansätze zeigt klar, dass keine dieser Theorien für die Bewältigung komplexer realer Allokationsprobleme geeignet ist, jedoch lassen sich relevante Prinzipien einer gerechten Gesundheitsversorgung identifizieren. Alles überragend stellt sich die Gleichheit als grundlegendes Element von sozialer Verteilungsgerechtigkeit heraus, verbunden mit dem Prinzip der Lebenswertindifferenz und der unbedingt einzuhaltenden Vorrangigkeit von Bedürftigkeitskriterien vor Aspekten der Effizienz, was auch die besondere Behandlung der am schlechtesten gestellten Gesellschaftsmitglieder umfasst. Hervorstechend ist die Forderung nach der expliziten Umsetzung von Leistungsbegrenzungen, die grundlegend für die gesellschaftliche Akzeptanz derselben erscheint und auf den Prinzipien der Transparenz und Konsistenz basiert. Um die für Kriterienentwicklung und –anwendung Zuständigen moralisch zu entlasten, sollten diese so weit wie möglich anonym-abstrakt auf patientenfernen Entscheidungsebenen und unter Partizipation von potentiell Betroffenen vorgenommen werden. Als elementare Hemmnisse jeglicher Rationierungsvorhaben stellt sich die Unmöglichkeit einer objektiven Quantifizierung und Grenzziehung bezüglich menschlicher Werte und Bedürfnisse dar, die für die konsistente Anwendung expliziter Rationierungskriterien oftmals erforderlich wäre, ebenso wie die ethische Verwerflichkeit und damit Nichtanwendbarkeit einer monetären Bewertung konkreten menschlichen Lebens. Daraus folgernd lässt sich festhalten, dass speziell soziale Rationierungskriterien nicht mit moralischen Gerechtigkeitsvorstellungen vereinbar sind.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1
- 1.1 Thema und Fragestellung
- 1.2 Aufbau der Arbeit
- 1.3 Untersuchungsmethodik und -materialien
- Kapitel 2
- 2.1 Das besondere Gut Gesundheit
- 2.2 Rationierung
- 2.3 Priorisierung
- Kapitel 3
- 3.1 Die Systemfrage
- 3.2 Knappheit im öffentlichen Gesundheitssystem
- 3.3 Die Verschärfung der Knappheitssituation
- Kapitel 4
- 4.1 Soziale Gerechtigkeit in Zusammenhang mit Egalitarismus und Liberalismus
- 4.2 Gerechtigkeit- utilitaristische Gesichtspunkte
- 4.3 Zwischenfazit
- Kapitel 5
- 5.1 Konzeptionelle Aspekte von Rationierung und Priorisierung
- 5.1.1 Makroebene I
- 5.1.2 Makroebene II
- 5.1.3 Mikroebene I
- 5.1.4 Mikroebene II
- 5.2 Formen der Rationierung
- 5.2.1 Explizite versus implizite Rationierung
- 5.2.2 Harte versus weiche Rationierung
- 5.2.3 Direkte versus indirekte Rationierung
- 5.2.4 Primäre und sekundäre Rationierung
- 5.3 Verfahrensprinzipien
- 5.3.1 Transparenz
- 5.3.2 Partizipation
- 5.3.3 Beachtung rechtsstaatlicher Aspekte
- 5.3.4 Einheitlichkeit
- 5.3.5 Nachvollziehbarkeit, Begründbarkeit
- 5.3.6 Revisionsoffenheit
- 5.3.7 Valide Datenbasis
- 5.1 Konzeptionelle Aspekte von Rationierung und Priorisierung
- Kapitel 6
- 6.1 Bedürftigkeit
- 6.2 Effektivität
- 6.3 Kosteneffektivität - Effizienz
- 6.4 Lebensalter
- 6.5 Soziale Rolle, sozialer Wert
- 6.6 Selbstverschulden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bachelor-Thesis „Rationierte Gesundheit“ befasst sich mit der gerechtigkeitsorientierten Betrachtung der Allokation knapper Gesundheitsgüter im deutschen Gesundheitssystem. Sie analysiert die Herausforderungen, die durch die Knappheit an Ressourcen im Gesundheitswesen entstehen, und untersucht verschiedene ethische und konzeptionelle Ansätze zur Rationierung und Priorisierung von Gesundheitsleistungen.
- Knappheit im deutschen Gesundheitssystem
- Ethische Prinzipien der Gerechtigkeit in der Gesundheitsversorgung
- Konzeptionelle Aspekte von Rationierung und Priorisierung
- Inhaltliche Rationierungskriterien und deren Anwendung
- Herausforderungen und Chancen der Rationierung und Priorisierung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung Dieses Kapitel führt in das Thema der Rationierung im Gesundheitswesen ein, stellt die Fragestellung der Arbeit dar und erläutert den Aufbau der Arbeit. Zudem werden die gewählte Untersuchungsmethodik und die genutzten Materialien vorgestellt.
Kapitel 2: Grundlegende Betrachtungen In diesem Kapitel werden die Besonderheit des Gutes Gesundheit, die Notwendigkeit der Rationierung und die verschiedenen Aspekte der Priorisierung beleuchtet. Die Kapitel analysieren die Herausforderungen, die sich aus der Knappheit an Gesundheitsgütern ergeben und die Notwendigkeit, diese effektiv und gerecht zu verteilen.
Kapitel 3: Das Entstehen von Knappheit an Gesundheitsgütern Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursachen für die Knappheit an Gesundheitsgütern im deutschen Gesundheitssystem. Die Systemfrage, die Knappheit im öffentlichen Gesundheitssystem und die Verschärfung der Knappheitssituation werden detailliert beleuchtet.
Kapitel 4: Ethische Grundpositionen – Was ist Gerechtigkeit In diesem Kapitel werden unterschiedliche ethische Grundpositionen im Zusammenhang mit der Rationierung von Gesundheitsgütern beleuchtet. Die Kapitel behandelt die Konzepte der sozialen Gerechtigkeit, des Egalitarismus, des Liberalismus und des Utilitarismus.
Kapitel 5: Konzeptionelle Aspekte von Rationierung und Priorisierung Dieses Kapitel untersucht verschiedene konzeptionelle Aspekte der Rationierung und Priorisierung. Es werden verschiedene Ebenen der Rationierung (Makro- und Mikroebene) sowie verschiedene Formen der Rationierung (explizit vs. implizit, hart vs. weich, direkt vs. indirekt, primär vs. sekundär) analysiert. Darüber hinaus werden wichtige Verfahrensprinzipien der Rationierung, wie Transparenz, Partizipation, Rechtsstaatlichkeit und Nachvollziehbarkeit, besprochen.
Kapitel 6: Inhaltliche Rationierungskriterien Dieses Kapitel beschäftigt sich mit verschiedenen inhaltlichen Rationierungskriterien. Es werden Kriterien wie Bedürftigkeit, Effektivität, Kosteneffektivität, Lebensalter, soziale Rolle und Selbstverschulden beleuchtet. Die Kapitel analysiert die Anwendung dieser Kriterien im Kontext der Gesundheitsversorgung und deren ethische und praktische Implikationen.
Schlüsselwörter
Rationierung, Priorisierung, Gesundheitswesen, Knappheit, Gerechtigkeit, Egalitarismus, Liberalismus, Utilitarismus, Effektivität, Kosteneffektivität, Lebensalter, Soziale Rolle, Selbstverschulden, Deutschland
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Rationierung und Priorisierung?
Priorisierung legt eine Rangfolge fest, welche Leistungen zuerst erbracht werden; Rationierung ist die vorenthaltung notwendiger Leistungen aufgrund von Knappheit.
Warum wird im Gesundheitswesen rationiert?
Weil das medizinisch Machbare und die verfügbaren finanziellen Ressourcen aufgrund von Alterung und technischem Fortschritt zunehmend auseinanderklaffen.
Welche ethischen Prinzipien gelten bei der Verteilung?
Zentrale Prinzipien sind die Gleichheit, die Bedürftigkeit und das Verbot, menschliches Leben monetär zu bewerten.
Was bedeutet „explizite Rationierung“?
Es ist die offengelegte, nachvollziehbare Entscheidung über Leistungsausschlüsse, im Gegensatz zur heimlichen (impliziten) Rationierung durch Zeitmangel.
Darf das Lebensalter ein Kriterium für die Behandlung sein?
Die Arbeit diskutiert dies kritisch und weist darauf hin, dass soziale Kriterien oft mit Gerechtigkeitsvorstellungen kollidieren.
- Citation du texte
- Dominik Fischer (Auteur), 2011, Rationierte Gesundheit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188245