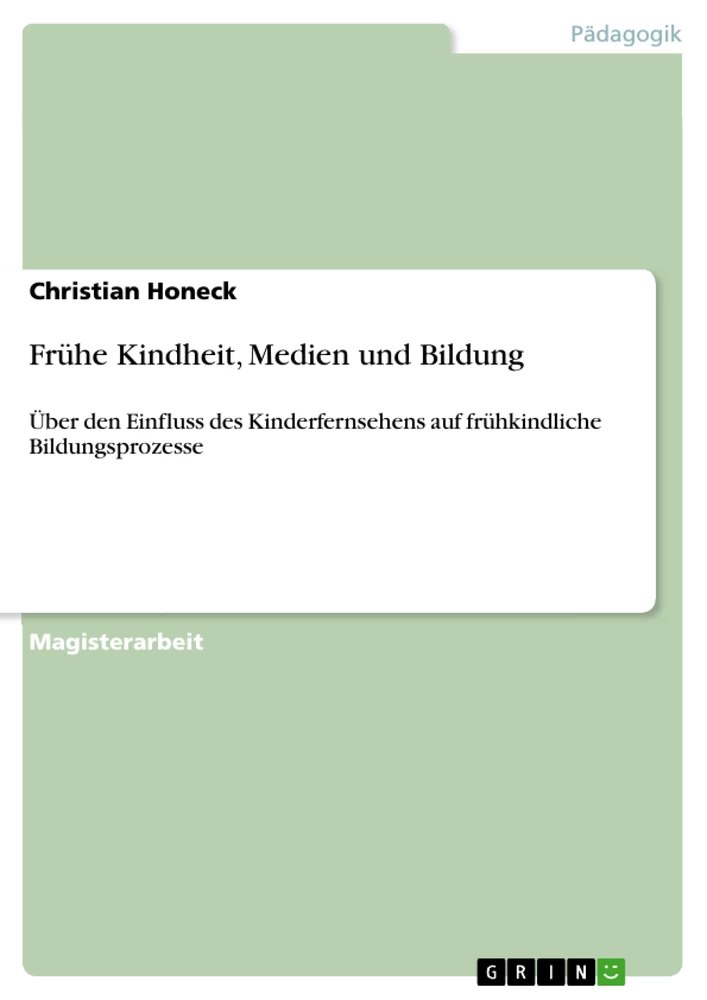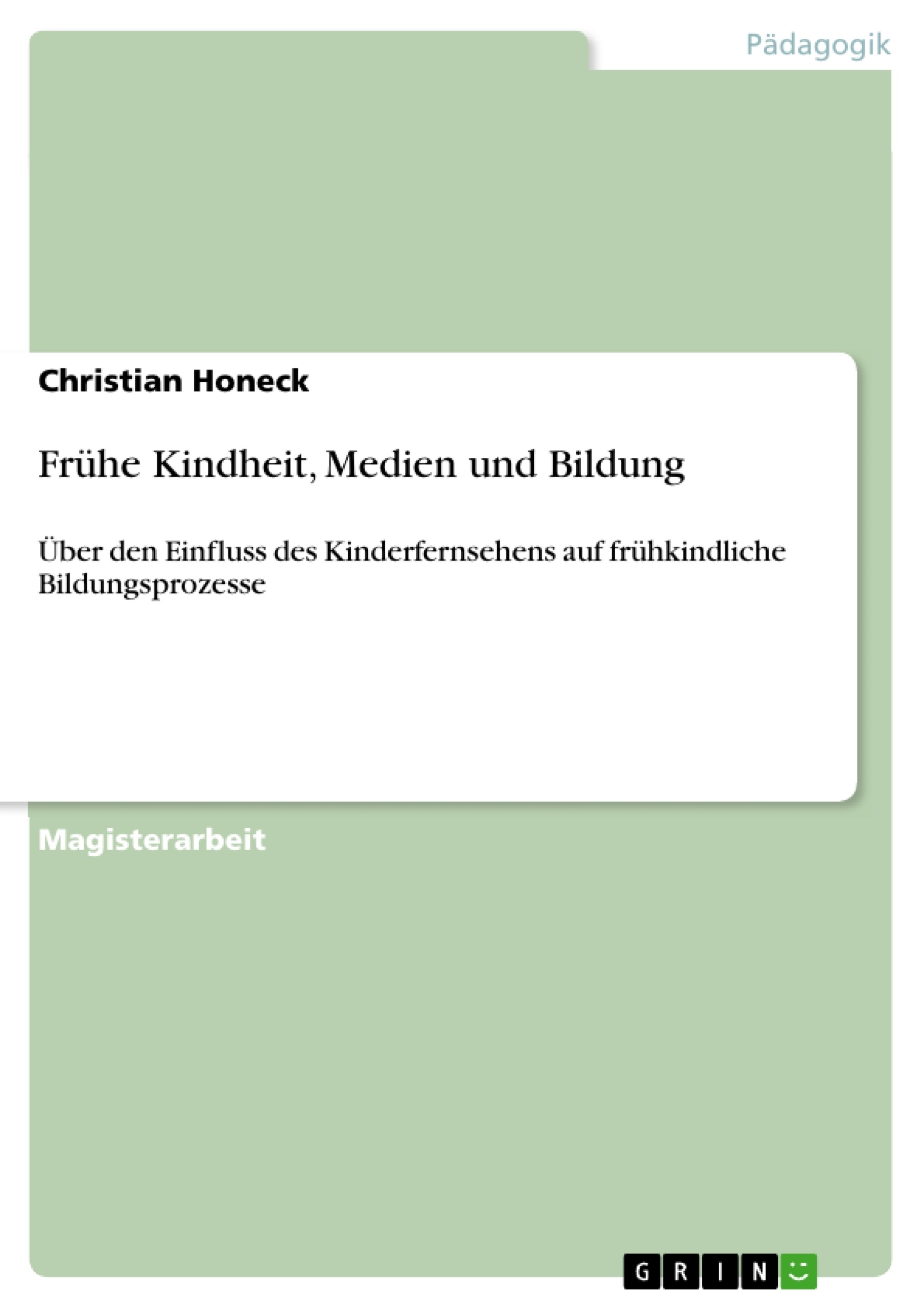Die Kontroverse um den Einfluss des Fernsehens und der „neuen“ Medien auf Kinder ist allgegenwärtig. In regelmäßigen Abständen, häufig in Folge von Gewaltausbrüchen von Kindern und Jugendlichen, welche in der Öffentlichkeit meist unweigerlich mit einem medialen Einfluss in Verbindung gebracht werden, wird heftig über das Für und Wider des Medienkonsums debattiert. Die Diskussion, in welcher alle beteiligten Parteien meist recht monokausal argumentieren, zirkuliert immer um die gleichen Grundfragen: Ist Fernsehen schädlich? Führt es zu einer Überreizung und seelischen Abstumpfung? Macht Fernsehen gewalttätig oder gar dumm?
Die meist ergebnislos geführten Debatten machen deutlich, dass ein breites Bedürfnis nach Antworten besteht, dass Ängste gegenüber dem Medium mit seiner inzwischen nahezu unüberschaubaren Programmvielfalt herrschen. Ängste, die auch daher rühren, dass der Medienkonsum in immer jüngeren Jahren beginnt. Schon Klein- und Kleinstkinder schauen täglich im Durchschnitt 71 Minuten fern. Hierbei scheinen die möglichen Auswirkungen des Fernsehens eine besonders große Rolle zu spielen, versuchen doch zahlreiche wissenschaftliche Studien zu belegen, dass gerade in jenen jüngsten Jahren der Kindheit auf Einflüsse der Umgebung besonders stark reagiert wird.
Des Weiteren zeigen sich in jüngster Zeit vermehrt Forderungen von Politik und Gesellschaft, immer früher mit gezielten Bildungsmaßnahmen auf die Kinder einzuwirken. Vielleicht auch mit initiiert durch den „Pisa-Schock“, macht das geflügelte Wort „Frühförderung“ die Runde in Familien, Kindergärten und Vorschulen und nicht zuletzt auch in den Medien. Gerade in Bezug auf die Medien stellt sich die Frage, ob und wie es möglich sei, auf möglichst förderliche Weise auf die kindliche Entwicklung Einfluss zu nehmen. Die lieben Kleinen sollen auch beim Fernsehen etwas „lernen“. Dieser Ansatz trägt mindestens zur Imagepflege der Fernsehmacher bei, kann aber auch durchaus ernst gemeinte Ziele verfolgen. Aber ist frühkindliche Bildung tatsächlich gleichzusetzen mit Lernen? Kann man davon ausgehen, dass durch den gezielten Einsatz des Fernsehens Kindern Wissen und Bildung vermittelt werden kann? Oder handelt es sich bei frühkindlicher Bildung nicht vielleicht um mehr als nur um reines „Kompetenztraining“?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Frühe Kindheit und Bildung
- Vorüberlegungen zum Begriff der Bildung
- Frühkindliche Bildung
- Frühkindliche Bildung als selbständiger Weltaneignungsprozess
- Frühkindliche Bildung als Prozess in Abhängigkeit kultureller und sozialer Gegebenheiten
- Frühkindliche Bildung als ästhetische Bildung
- Historische Denklinie I: Jean Jacques Rousseau
- Historische Denklinie II: Maria Montessori
- Frühkindliche Bildungsprozesse im Kontext der klassischen Bildungstheorie
- Zusammenfassung: Versuch einer Bestimmung des Begriffes frühkindlicher Bildung mit allgemeinpädagogischem Anspruch
- Frühe Kindheit, Medien und Bildung
- Medien und Bildung
- Fernsehen als Vermittler und Nachbildner der Welt
- Wesenszüge einer zur Industrie gewordenen Kultur und das Fernsehen als Repräsentant derselben
- Der Einfluss des Fernsehens auf Prozesse der Urteilsbildung
- Kritik der Kritiker – Überlegungen zu einer anderen Sicht auf das Fernsehen
- Fernsehen als Unterstützung frühkindlicher Bildungsprozesse
- Fernsehen als Handeln
- Die pädagogische Relevanz der phänomenologischen Betrachtung des Fernsehens als Handeln
- Zusammenfassung: Möglichkeiten und Grenzen der medialen Einflussnahme auf frühkindliche Bildungsprozesse
- Medien und Bildung
- Frühe Kindheit und Medien in der Praxis
- Die Geschichte des Kinderfernsehens in Deutschland: Ein (kritischer) Überblick
- Die Sendung mit dem Elefanten“: Rückbesinnung auf die pädagogische Phase des Kinderfernsehens
- Besondere Merkmale der „Sendung mit dem Elefanten“
- Der „Elternticker“: Ratgeber und Handlungsaufforderung für Eltern
- Das Forschungsprojekt „Frühe Kindheit, Medien und Bildung“
- Methode und Fragestellung
- Auswertung des Leitfadeninterviews
- Allgemeine Haltung zum medialen Einfluss und Fernsehkonsum von Kindern im Alltag
- Beurteilung der „Sendung mit dem Elefanten“
- Beurteilung des „Elterntickers“
- Zusammenfassung
- Fazit: Über den Einfluss des Kinderfernsehens auf frühkindliche Bildungsprozesse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht den Einfluss des Kinderfernsehens auf frühkindliche Bildungsprozesse. Ziel ist es, den komplexen Begriff der frühkindlichen Bildung im Kontext des Medienkonsums zu klären und die Möglichkeiten und Grenzen des Fernsehens als Einflussfaktor auf die kindliche Entwicklung zu beleuchten. Ein allgemeinpädagogischer Ansatz wird verfolgt, der psychologische und medienwirkungs-theoretische Erklärungsmodelle weitgehend vermeidet.
- Begriffsbestimmung von frühkindlicher Bildung
- Fernsehen als Vermittler von Wirklichkeit
- Positive und negative Einflüsse des Fernsehens auf die kindliche Entwicklung
- Pädagogischer Umgang mit dem Medium Fernsehen
- Empirische Untersuchung der Sendung "Die Sendung mit dem Elefanten"
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht den Einfluss des Fernsehens auf frühkindliche Bildungsprozesse vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Debatte um Medienkonsum und Frühförderung. Sie setzt einen allgemeinpädagogischen Ansatz und zielt darauf ab, den Begriff der frühkindlichen Bildung zu klären und die Rolle des Fernsehens darin zu beleuchten, ohne sich auf psychologische oder medienwirkungs-theoretische Erklärungsmodelle zu konzentrieren. Die Einleitung legt den Fokus auf die kontroverse Diskussion um den Einfluss von Medien auf Kinder und die Notwendigkeit einer umfassenderen Betrachtungsweise.
Frühe Kindheit und Bildung: Dieses Kapitel befasst sich mit dem komplexen Begriff der frühkindlichen Bildung. Es werden verschiedene Perspektiven vorgestellt, inklusive der Betrachtung als selbstständiger Weltaneignungsprozess, als Prozess in Abhängigkeit kultureller und sozialer Gegebenheiten, sowie als ästhetische Bildung. Historische Denklinien von Rousseau und Montessori werden analysiert, um die Entwicklung des Verständnisses von frühkindlicher Bildung zu beleuchten. Abschließend wird der Begriff im Kontext der klassischen Bildungstheorie positioniert und eine umfassende Bestimmung angestrebt.
Frühe Kindheit, Medien und Bildung: Dieses Kapitel untersucht das Fernsehen in seinem Verhältnis zur frühkindlichen Bildung. Es analysiert das Fernsehen als Vermittler und Nachbildner der Welt, beleuchtet die kritischen Positionen von Platon, Adorno und Postman und diskutiert die potenziellen negativen Auswirkungen des Fernsehens. Gleichzeitig werden auch positive Aspekte und Möglichkeiten der medialen Einflussnahme im Kontext frühkindlicher Bildung erörtert. Der Fokus liegt auf der Relevanz der vom Fernsehen behandelten Themen für die kindliche Lebenswelt.
Frühe Kindheit und Medien in der Praxis: Dieses Kapitel präsentiert eine empirische Untersuchung. Es bietet einen Überblick über die Geschichte des Kinderfernsehens in Deutschland und analysiert die Sendung "Die Sendung mit dem Elefanten" als Beispiel für einen pädagogisch orientierten Ansatz. Die Auswertung von Leitfadeninterviews gibt Einblicke in die Einstellungen von Eltern zum medialen Einfluss und Fernsehkonsum ihrer Kinder, sowie zur Bewertung der Sendung und des „Elterntickers“.
Schlüsselwörter
Frühkindliche Bildung, Medienpädagogik, Kinderfernsehen, Bildungsprozesse, Medienkonsum, „Sendung mit dem Elefanten“, Medienwirkung, allgemeinpädagogischer Ansatz, Weltaneignung, Selbsttätigkeit, Kultur, Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: "Der Einfluss des Kinderfernsehens auf frühkindliche Bildungsprozesse"
Was ist der Gegenstand der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den Einfluss des Kinderfernsehens auf frühkindliche Bildungsprozesse. Sie beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen des Fernsehens als Einflussfaktor auf die kindliche Entwicklung und klärt den komplexen Begriff der frühkindlichen Bildung im Kontext des Medienkonsums.
Welcher Ansatz wird verfolgt?
Es wird ein allgemeinpädagogischer Ansatz verfolgt, der psychologische und medienwirkungs-theoretische Erklärungsmodelle weitgehend vermeidet. Der Fokus liegt auf einer umfassenden Betrachtung der frühkindlichen Bildung und der Rolle des Fernsehens darin.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Begriffsbestimmung von frühkindlicher Bildung, das Fernsehen als Vermittler von Wirklichkeit, positive und negative Einflüsse des Fernsehens auf die kindliche Entwicklung, den pädagogischen Umgang mit dem Medium Fernsehen und eine empirische Untersuchung der Sendung "Die Sendung mit dem Elefanten".
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zu früher Kindheit und Bildung, früher Kindheit, Medien und Bildung, früher Kindheit und Medien in der Praxis und ein Fazit. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte sowie Schlüsselwörter.
Was wird in Kapitel "Frühe Kindheit und Bildung" behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit verschiedenen Perspektiven auf frühkindliche Bildung: als selbstständiger Weltaneignungsprozess, als Prozess in Abhängigkeit kultureller und sozialer Gegebenheiten und als ästhetische Bildung. Es analysiert historische Denklinien von Rousseau und Montessori und positioniert den Begriff im Kontext der klassischen Bildungstheorie.
Was wird in Kapitel "Frühe Kindheit, Medien und Bildung" behandelt?
Dieses Kapitel analysiert das Fernsehen als Vermittler und Nachbildner der Welt und diskutiert kritische Positionen zum Fernsehkonsum. Es erörtert sowohl potenziell negative als auch positive Auswirkungen des Fernsehens auf die frühkindliche Bildung und konzentriert sich auf die Relevanz der vom Fernsehen behandelten Themen für die kindliche Lebenswelt.
Was wird in Kapitel "Frühe Kindheit und Medien in der Praxis" behandelt?
Dieses Kapitel präsentiert eine empirische Untersuchung mit einem Überblick über die Geschichte des deutschen Kinderfernsehens. Es analysiert "Die Sendung mit dem Elefanten" und wertet Leitfadeninterviews mit Eltern zum medialen Einfluss und Fernsehkonsum ihrer Kinder aus.
Welche Sendung wird empirisch untersucht?
Die empirische Untersuchung konzentriert sich auf die Sendung "Die Sendung mit dem Elefanten" und deren pädagogischen Ansatz. Die Auswertung von Elterninterviews umfasst die Beurteilung der Sendung selbst und des "Elterntickers".
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Frühkindliche Bildung, Medienpädagogik, Kinderfernsehen, Bildungsprozesse, Medienkonsum, „Sendung mit dem Elefanten“, Medienwirkung, allgemeinpädagogischer Ansatz, Weltaneignung, Selbsttätigkeit, Kultur, Gesellschaft.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Untersuchung zum Einfluss des Kinderfernsehens auf frühkindliche Bildungsprozesse zusammen. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Fazit der Magisterarbeit detailliert beschrieben.
- Citation du texte
- Christian Honeck (Auteur), 2010, Frühe Kindheit, Medien und Bildung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/188325